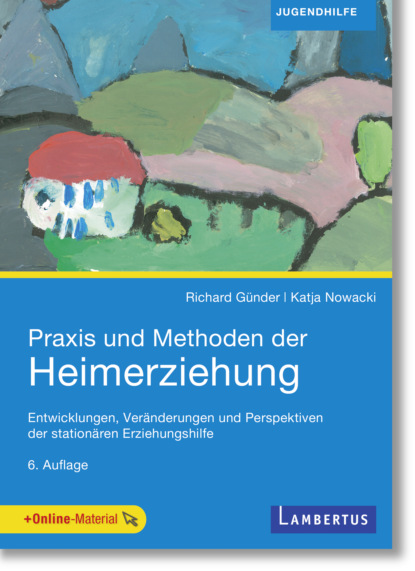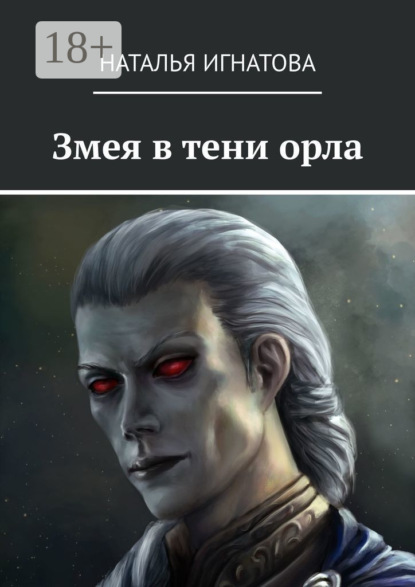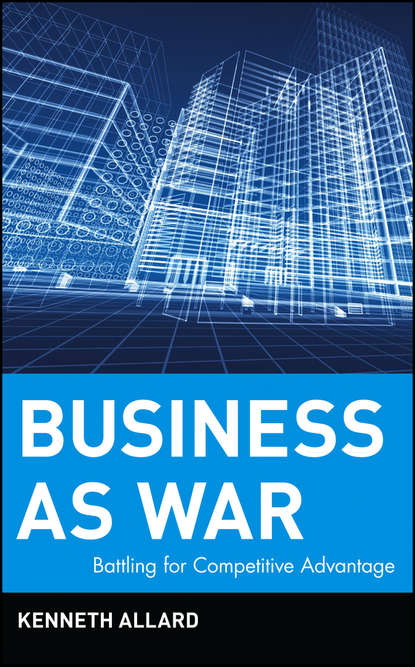- -
- 100%
- +
•eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
•die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
•eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.
Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.“
Die in § 35 erwähnte Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung berücksichtigt die diesbezügliche pädagogische Differenzierung der Heimerziehung und meint damit beispielsweise auch länger andauernde Projekte der Erlebnispädagogik. Diese werden besonders eingesetzt für junge Menschen, die aufgrund ihrer individuellen (oft negativen) Sozialisationserfahrungen in der klassischen Gruppenform einer stationären Erziehungshilfe an Grenzen stoßen. Die Mitwirkung der beteiligten Personensorgeberechtigten und des Kindes oder Jugendlichen werden in § 37 festgelegt. Diese sind vor der Inanspruchnahme einer Hilfe zur Erziehung ausführlich zu beraten. Wenn eine Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich ist, so sind die Erziehungsberechtigten und der junge Mensch bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Wenn nicht unverhältnismäßige Mehrkosten auftreten, so ist ihren Wünschen zu entsprechen.
Wenn Hilfe zur Erziehung über einen längeren Zeitraum zu leisten ist, soll nach § 36 ein Hilfeplan im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und zusammen mit den Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen erstellt werden. Dies bedeutet für die Heimerziehung, dass Hilfepläne beispielsweise in Teamarbeit von Gruppenerzieher*innen, gruppenübergreifenden Diensten und den zuständigen Fachkräften des Jugendamtes zu erstellen sind, wobei Eltern und die betroffenen Minderjährigen zu beteiligen sind.
Neu geregelt werden durch das KJHG auch die rechtliche Zuständigkeit und damit die Finanzierung der Heimerziehung. Nach dem alten JWG konnte im Einzelfall je nach pädagogischer Etikettierung und Gefährdungseinschätzung entweder das örtliche oder das überörtliche Jugendamt zuständig sein. Gemäß § 85 KJHG ist nun stets das Jugendamt für die Gewährung von Leistungen zur Hilfe zur Erziehung zuständig, in dem das Kind oder der/die Jugendliche seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diese örtliche Zuständigkeit ist im Sinne einer regionalen Inanspruchnahme, Verantwortung und Sorge zu begrüßen. Sie kann jedoch zu einer pädagogisch unreflektierten Vermeidung von Heimerziehung führen, wenn generell oder in einzelnen kommunalen Haushalten besondere finanzielle Probleme vorhanden sind. In der Praxis wird tatsächlich ein großer Unterschied in der Gewährung von verschiedenen Hilfen durch die Jugendämter unterschiedlicher Kommunen beklagt. So stellt der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung heraus, dass die Anzahl der gewährten Hilfen in den Kommunen mit den meisten Bewilligungen viermal so hoch ist wie in den Kommunen mit den niedrigsten Bewilligungen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2017, S. 436). Die Personensorgeberechtigten haben nach § 27 KJHG Anspruch auf Förderungsmaßnahmen der Hilfe zur Erziehung für ihr Kind, wenn ansonsten das Wohl des Kindes gefährdet wäre und wenn die beanspruchte Hilfe für seine Entwicklung und Neigung notwendig ist. Insofern könnten Eltern im konkreten Einzelfall Heimerziehung für ihr Kind auch einklagen. Da Eltern von Kindern, die auf Heimerziehung angewiesen sind, in der Regel aber aus unterprivilegierten Schichten stammen und/oder sich in sehr schwierigen Lebenslagen befinden, ist diese Klagemöglichkeit wohl eher theoretisch, sie wird in der Praxis kaum einmal vorkommen.
Ähnlich verhält es sich, wenn die Maßnahme Heimerziehung für junge Erwachsene über das 18. Lebensjahr hinaus fortgesetzt werden soll. Nach § 41 KJHG soll jungen Volljährigen (in begründeten Einzelfällen auch über das 21. Lebensjahr hinaus) Hilfe für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden. Die individuelle Situation des jungen Menschen bestimmt, ob und wie lange die Hilfe notwendig ist. Dies gilt entsprechend für die Maßnahme Heimerziehung oder Betreutes Wohnen. Gegenwärtig kann allerdings immer häufiger beobachtet werden, dass Jugendämter nicht mehr bereit sind, junge Erwachsene über das 18. Lebensjahr hinaus in stationären Institutionen der Jugendhilfe weiterhin zu fördern (Nüsken 2008). Die jungen Menschen könnten auch hier versuchen, ihr Recht auf Jugendhilfe einzuklagen, aber die wenigsten werden diesen Schritt tun.
Einbezug seelisch Behinderter
Der Gesetzgeber hat in § 35a des KJHG ausdrücklich auch solche Kinder und Jugendliche aufgenommen, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Diese, bezogen auf die Gesamtgruppe der Kinder und Jugendlichen, welchen Hilfe zur Erziehung gewährt wird, relativ kleine Gruppe hat Anspruch auf Eingliederungshilfe und im Bedarfsfall auch Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, somit auch auf stationäre Erziehungshilfen. Mit der Berücksichtigung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher im KJHG beendete der Gesetzgeber den jahrzehntelang andauernden Streit, ob diese Minderjährigen durch Maßnahmen der Sozial- oder der Jugendhilfe gefördert werden sollen. Im Zuge der Novellierung des KJHG (1. Oktober 2005) wurde der § 35a ergänzt. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nun hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit die fachliche Stellungnahme eines/einer entsprechenden Fachärzt*in oder Psychotherapeut*in einzuholen. Als seelisch behindert werden jene Personen angesehen, die als chronisch psychisch krank gelten und die oftmals längere Aufenthalte in Psychiatrien durchlebt haben. Bei ihnen wurde eine psychische Störung festgestellt, welche die Voraussetzungen erfüllt, ihre Teilhabefähigkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Der Begriff der seelischen Behinderung ist nicht als statisch zu verstehen, sondern z. B. gesellschaftlichen Veränderungen und Einstellungen unterworfen (Kronenberger 2017, S. 743). Bei Kindern und Jugendlichen handelt es sich aus traditioneller Sichtweise vor allem um solche mit autistischen und anderen psychotischen Syndromen, mit Persönlichkeitsstörungen auf der Grundlage schwerwiegender Neurosen oder mit Befindlichkeiten nach hirnorganischen Erkrankungen. Mueller berichtet, dass bei 61 % fremduntergebrachter seelisch behinderter jungen junger Menschen Verhaltens- und emotionale Störungen, bei 16 % neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen vorlagen (2000, S. 127). Eine Einrichtung der Heimerziehung, in der seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgenommen werden, benötigt die entsprechenden Voraussetzungen und personellen Rahmenbedingungen, damit erzieherische und therapeutische Prozesse erfolgreich verlaufen können und eine Integration als Zielsetzung realistisch bleibt.
„Der psychisch auffällige junge Mensch benötigt demnach Schutz auch innerhalb der Einrichtung vor Übergriffen, unnötiger Ablehnung, Abwertung und Ausgrenzung durch in Betreuungsverantwortung stehende Fachkräfte, Eltern, Schule etc.“ (Mueller 2000, S. 128).
Fegert gibt in einer Abhandlung zum § 35a zu bedenken, dass die Anwendung des Begriffs „Seelische Behinderung“ im Kindes- und Jugendalter sehr problematisch sei, da beim Behinderungsbegriff die Chronizität des Leidens immer eine große Rolle spiele. Er legt daher sein Hauptaugenmerk auf den Bedrohungsgedanken.
„Dies bedeutet, dass eine umfassende Diagnostik, die neben der Feststellung der jeweiligen psychopathologischen Symptomatik auch eine differenzierte Einschätzung des Entwicklungsstandes, des Intelligenzniveaus, körperlicher Begleiterkrankungen oder Grunderkrankungen, und unterschiedlicher psychosozialer Risiken beinhaltet, eine Feststellung zulässt, ob die Kinder bei Unterbleiben geeigneter Hilfs- und Entwicklungsmaßnahmen von einer Entwicklung bedroht sind, die sie in ihren Beziehungen beeinträchtigt, die ihr Leistungsniveau herabsetzen, die ihre spätere Teilnahme am regulären Arbeitsprozess infrage stellt, und die sie subjektiv mehr oder weniger erheblich beeinträchtigt (je nach Krankheitsbild teilweise schweregradunabhängiger, völlig unterschiedlicher Leidensdruck)“ (Fegert 2004, S. 210).
Außerdem weist er darauf hin, dass viele bestehende Behinderungen wie beispielsweise Körperbehinderung, Sprachbehinderung, Lernbehinderung und geistige Behinderung sehr häufig mit sekundären psychischen Beeinträchtigungen einhergehen, auf deren Grundlage sich eine psychische Behinderung entwickeln kann (Fegert 2004, S. 212 f.). Die zuletzt genannten Behinderungsformen werden jedoch vom § 35a nicht erfasst, da dieser Personenkreis der Eingliederungshilfe gemäß dem BSHG unterliegt. Dennoch muss zumindest die Einbeziehung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in das Leistungsangebot des KJHG als zu begrüßender Fortschritt gewertet werden, da im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ihnen alle Rechte und Freiheiten vergleichbar zu Kindern ohne Behinderung garantiert werden müssen (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017a). Eine Einbeziehung aller Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in das Kinder- und Jugendhilfegesetz, also die sogenannte „Inklusive Lösung“, ist bisher aber noch nicht umgesetzt worden (Beauftragter der Bundesregierung für Belange von Menschen mit Behinderungen 2017b), obwohl damit eine Ungleichbehandlung aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten und Hilfesysteme vorliegt.
Das neue Bundesteilhabegesetz macht deutlich, dass Behinderung als Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung und umwelt- oder einstellungsbedingten Barrieren zu verstehen ist. Hilfen zur Erziehung für alle Kinder und Jugendlichen könnten hier ansetzen, insbesondere um umweltbedingte Barrieren abzubauen. Allerdings müssen dafür die öffentlichen und freien Träger der Erziehungshilfe ihre personellen, räumlichen und fachlichen Standards erweitern und benötigen eine gute Lösung, die allen Schnittstellenproblematiken gerecht wird, um den hohen Verwaltungsaufwand zu rechtfertigen, der mit der Umstellung der Systeme verbunden ist (Finke 2019, S. 14).
Sozialdatenschutz
Grundsätzlich ist die Praxis der Hilfen zur Erziehung auf Kooperation und Vertraulichkeit mit Familien und Minderjährigen angelegt, die solche Leistungen erhalten. Entsprechend gelten die strengen Vorschriften des Sozialdatenschutzes für die Mitarbeiter*innen freier Träger ebenso wie im öffentlichen Trägerbereich. Soziale Daten und Tatbestände, die im Rahmen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen bekannt und gesammelt werden, dürfen nur mit dem Einverständnis der Betroffenen weitergegeben werden (§ 65 KJHG). Auch betroffene Minderjährige, die über eine entsprechende Einsicht verfügen, müssen vor der Offenbarung ihrer Sozialdaten um ihre Einwilligung gefragt werden (Frankfurter Kommentar 2019, S. 791 ff.). Eine Weitergabe von geschützten Sozialdaten kann beispielsweise bei Hilfeplangesprächen fachlich notwendig sein. Entsprechend der Sozialdatenschutzvorschriften müssen daher die Betroffenen über die Teilnehmer*innen eines Hilfeplangesprächs im Vorhinein informiert werden, damit sie ihre Ablehnung oder Zustimmung äußern können. Bei der Weitergabe von Berichten zwischen öffentlichem und freiem Träger müssen die Vorschriften des Datenschutzes nach §§ 61 ff. SGB VIII genau geprüft werden. Insbesondere die Einwilligung der Betroffenen ist hierbei eine wesentliche Voraussetzung, ein weiterer Rechtfertigungsgrund ist die Gefährdung des Kindeswohls und die Anweisung durch das Familiengericht (s. § 65 SGB VIII).
Betroffenenbeteiligung bei der Hilfeauswahl
Im Gegensatz zum alten JWG, in dem Jugendhilfemaßnahmen überwiegend als Eingriffsmaßnahmen galten, die mehr oder weniger „von oben“ angeordnet wurden, geht das KJHG von Leistungen aus, welche in partnerschaftlicher Kooperation mit den Betroffenen zu klären, abzuwägen und abzustimmen sind. Diese grundsätzlich neue und verbindliche Leitidee findet ihren Niederschlag an verschiedenen Stellen des KJHG: Nach § 5 KJHG haben die Leistungsberechtigten, in der Regel also die Eltern, ein Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Einrichtungen und Dienste verschiedener Träger und bezüglich der Gestaltung der Hilfe. Auf dieses Recht müssen die Betroffenen ausdrücklich hingewiesen werden. Das Wunsch- und Wahlrecht findet dann seine Begrenzung, wenn es mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre. In § 8 KJHG wird geregelt, dass Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind. Gemäß ihrem Entwicklungsstand sind ihre Vorstellungen, Meinungen, Ängste und Wünsche ernst zu nehmen, es soll nicht über sie entschieden werden, sondern in partnerschaftlicher Abwägung sollen gemeinsam zu akzeptierende Lösungen und Perspektiven entwickelt werden.
Nach § 36 KJHG sind die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten, wobei auf mögliche Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen ist.
Wenn Hilfe für einen voraussichtlich längeren Zeitraum zu leisten ist, soll in Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten und im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte (also im Team) über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart entschieden werden. Dies gilt insbesondere bei Erziehungshilfen, die außerhalb der eigenen Familie stattfinden, so z. B. bei der Heimerziehung.
Partizipation von Kindern und Jugendlichen im gesamten Hilfeprozess
Jugendhilfe kann im eigentlichen Sinne nur dann lebenswelt- und ressourcenorientiert sein, wenn die aktive Beteiligung – die Partizipation – der betroffenen jungen Menschen nicht nur gefordert, sondern innerhalb der Praxis systematisch und kontinuierlich realisiert wird.
In den Hilfen zur Erziehung ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zwar gesetzlich normiert, die praktizierte Wirklichkeit des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zeigt allerdings auf, dass trotz der eindeutigen gesetzlichen Regelungen eine erhebliche Diskrepanz zwischen Forderungen und der Beachtung sowie der Realisierung einer Partizipation besteht. Verschiedene empirische Studien zur Betroffenenbeteiligung im Rahmen der Hilfeplanung belegen jeweils äußerst geringe Quoten der Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen am Hilfeplanungsprozess. In einer Befragung von Kindern und Jugendlichen zu ihrer Aufnahme in eine Einrichtung der stationären Erziehungshilfe beschrieben viele Kinder und Jugendliche ein Gefühl der Hilflosigkeit, da sie sich nicht genügend in den Prozess der Entscheidung über die Hilfe einbezogen fühlten. Ihnen fehlten nach ihren Aussagen sogar genügend Informationen zum Hintergrund und Ziel der Unterbringung (Nowacki/Remiorz, 2014, S. 127).
Eine deutliche Erhöhung der Beteiligungsquote wäre alleine nicht ausreichend, wenn die Fachkräfte nicht Haltungen einnehmen und für Rahmenbedingungen sorgen, welche die echte innere Beteiligung eines betroffenen jungen Menschen in vielen Fällen erst ermöglicht. Alles andere wäre nur eine Quasi-Beteiligung oder anders ausgedrückt, eine Alibi-Funktion.
„Für die Kinder- und Jugendhilfe gelten Mitwirkung und Aushandlung als zentrale Maximen. Kinder- und Jugendhilfe hat einen (Einmischungs-)Auftrag, offensiv darauf Einfluss zu nehmen, dass die Beteiligung und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Bereichen ermöglicht werden“ (Rätz-Heinisch/Schröer/Wolff 2014, S. 275).
Die formal abgesicherten Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte von jungen Menschen, die in den Institutionen der stationären Erziehungshilfe leben, sind eher gering. Wo Kinder, Jugendliche und ihre Eltern auf professionelle Fachkräfte treffen, ist eine Beteiligung auf Augenhöhe eher schwierig (Stork 2017, S. 48). Die Gefahr besteht, dass Fachkräfte die Haltung haben, sie wüssten schon, was für die Kinder und Jugendlichen das Beste sei. Beteiligungen der jungen Menschen sind dann zwar auch anzutreffen, aber diese nehmen eher einen gelegentlichen, zufälligen oder auch vom zeitweisen Wohlwollen der Erwachsenen geprägten Charakter ein. Systematisch zugestandene und auch formal abgesicherte Möglichkeiten und Wege der Partizipation sind unter solchen Verhältnissen nicht anzutreffen.
Für die stationäre Erziehungshilfe ist die Partizipation ein wichtiges Element, da es eine zentrale Grundlage demokratischer Strukturen auch in der Sozialen Arbeit darstellt (Stork 2017, S. 46) und damit auch für das Erleben der Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen ein wesentliches Mittel ist.
Im Zuge der Skandalisierung der Heimerziehung und der sich daraus ableitenden ersten Reformen wurden Instanzen der Partizipation in der Heimerziehung durchaus verwirklicht: In verschiedenen Institutionen bildeten sich beispielsweise Heimräte, es wurden Vollversammlungen einberufen und Gruppen- sprecher*innen gewählt. Die nachhaltigen Reformen und Strukturveränderungen der Heime, die Dezentralisation großer Einrichtungen und die allgemeine liberalere Erziehungspraxis haben solche Instrumentarien der Partizipation zumeist überholt und vergessen lassen. Heimräte oder Gruppensprecher*innen verdeutlichen sehr das Negativbild von Institutionen und es ist zu hinterfragen, ob solche oder andere Mitbeteiligungswege in heute durchweg reformierten und vor allem in kleineren Institutionen überhaupt noch notwendig sind. Kommt es nicht mehr und vor allem auf die Haltungen der pädagogischen Mitarbeiter*innen an, welche die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen wie selbstverständlich akzeptieren und fördern müssen? Andererseits gilt zu bedenken, dass demokratische Errungenschaften – gleich in welchem Bereich – keine Selbstläufer sind. Sie wurden immer mühsam erkämpft; es besteht immer die Gefahr, dass sie schnell beseitigt werden. Klar strukturierte und auch schriftliche fixierte Wege der Partizipation können das Selbstverständnis dieser Errungenschaften verfestigen.
„Beteiligung kann darüber hinaus in den Hintergrund geraten, wenn pädagogische Fachkräfte Machtansprüche nicht aufgeben wollen oder können bzw. wenn Konkurrenzen die Zusammenarbeit stören. Aufseiten der betroffenen Kinder, Jugendlichen oder Eltern kann die Mitwirkungsbereitschaft eingeschränkt sein, wenn sie die Abläufe nicht verstehen und einschätzen können bzw. wenn sie verunsichert oder zu wenig informiert sind“ (Rätz-Heinisch/Schröer/Wolff 2009, S. 230).
Die moderne Heimerziehung gibt gegenwärtig vor, lebensweltorientiert zu sein und die Ressourcen der betroffenen jungen Menschen zu nutzen. Dies setzt unter anderem die aktive Beteiligung nicht nur als gelegentliche zugestandene Möglichkeit, sondern als festgelegtes Grundprinzip voraus. Beispiele solcher festgelegten Beteiligungsrechte, die kontinuierlich überprüft und nachgewiesen werden müssen, könnten sein:
•Kinder und Jugendliche haben Mitspracherechte bei den Gruppenregeln, sie können diese hinterfragen und Änderungen verlangen.
•Bei Urlaubsfahrten sind die jungen Menschen die Hauptbetroffenen. Ihre Vorschläge und Wünsche sind richtungsweisend, „altbewährte“ Urlaubsziele der Gruppe können abgelehnt werden.
•Beim Kauf neuer Möbel wird nicht über den Kopf der Kinder und Jugendlichen hinweg entschieden. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten haben diese immer ein Mitentscheidungsrecht.
•Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen ist regelmäßig die Meinung der Kinder und Jugendlichen einzuholen, ihr Votum kann ausschlaggebend sein.
•Über voraussehbare Neuaufnahmen sollten die Kinder und Jugendlichen informiert werden, ihre Meinung ist wichtig bei der Entscheidung, ob ein bestimmtes neues Kind in der gegenwärtigen Situation in die Gruppe passt.
Die Partizipation von jungen Menschen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen wurde auch vom neuen Bundeskinderschutzgesetz berücksichtigt und im Sozialgesetzbuch VIII stärker implementiert. Geregelt wurde beispielsweise das Verfahren der Beteiligung von Minderjährigen an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie das Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten (§ 8b SGB VIII). Letzterem kann in der Heimerziehung mit der Implementierung von Ombudsfrauen oder Ombudsmännern Rechnung getragen werden (Meysen/Eschelbach 2012, S. 170). 2012 wurde ebenfalls in § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII aufgenommen, dass für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine (teil-)stationäre Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe „zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden“ müssen. Die gesetzliche Grundlage für Beteiligungsprozesse ist damit klar geschaffen worden. Inhaltlich muss sie aber auch konsequent umgesetzt werden.
„Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe vollzieht sich selten von alleine, sie muss gewollt sein. Die Aufgabe der Wahrnehmung und Erschließung von Teilnahmechancen und Teilgabepotenzialen liegt bei den Fachkräften. Die Erfahrung hat gezeigt, dass beteiligende Beratung erst gelingen kann, wenn die Fachkräfte an der Basis hierfür Rückendeckung von den Führungskräften sozialer Institutionen erhalten“ (Rieger 2013, S. 33).
Hilfeplanung
Die gemeinsame Planung und Abstimmung der erforderlichen und zu leistenden Hilfe unterstreicht den Kooperationsgrundsatz im Umgang mit und in der Leistung von erzieherischen Hilfen. Wenn Hilfe voraussichtlich über einen längeren Zeitraum zu leisten ist, soll die Hilfeplanung unter Hinzuziehung mehrerer Fachkräfte und mit partnerschaftlicher Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie der Minderjährigen ablaufen. Unter erzieherischen Hilfen, die voraussichtlich für einen längeren Zeitraum geleistet werden, sind insbesondere auch Erziehungshilfen zu verstehen, die außerhalb der eigenen Familie stattfinden, also beispielsweise in einer Vollzeitpflegestelle oder im Rahmen der Heimerziehung. Für diesen Personenkreis sieht das KJHG (§ 37) eine besonders intensive Zusammenarbeit von Pflegepersonen, den Gruppenerzieher*innen eines Heimes, von gruppenübergreifenden Diensten, den zuständigen Fachkräften des Jugendamtes und anderen professionellen Kräften vor, welche die jeweilige Situation des jungen Menschen gut kennen und beurteilen können. Die Personensorgeberechtigten und die Kinder/Jugendlichen sind an diesem Hilfeplanungsprozess integrativ beteiligt. Betroffene und Fachkräfte sollen in gemeinsamer Abstimmung die bisherige erzieherische Hilfe bewerten, neue pädagogische Notwendigkeiten und Ziele formulieren und Lebensperspektiven herausbilden.
Eine solche Hilfeplanung wird in etwa folgenden Schritten ablaufen: Nachdem sich die Personensorgeberechtigten (Eltern) und/oder Minderjährigen mit ihren speziellen Problemen und Hilfebedürfnissen an das Jugendamt gewandt haben, kommt es zunächst zu einem Beratungsgespräch, in welchem der/die zuständige Sozialarbeiter*in umfangreich berät und Vorteile und Nachteile der eventuellen Hilfe offenlegt. Wird die Gewährung einer Hilfe für notwendig gehalten und sind sich alle Beteiligten über Form und Ausgestaltung der Hilfe einig, so kommt es in einem nächsten Schritt zu einem Hilfeplanprozess.
Dieser Hilfeplanprozess besteht in der Regel aus zwei Teilen: dem Fachgespräch und dem Hilfeplangespräch. Am Fachgespräch oder der Expert*innenrunde nehmen die zuständige Fachkraft des Jugendamtes teil und in der Regel weitere Kolleg*innen von öffentlichen oder freien Trägern der Jugendhilfe. Hinzugezogen werden sollen auch Vertreter*innen anderer Fachdienste oder Spezialdienste, so z. B. Psycholog*innen, Ärzt*innen und Lehrer*innen. Nachdem im Fachgespräch eine umfassende Darstellung des individuellen Falles erfolgte und Vorgeschichte, sowie mögliche Ursachen erörtert wurden, beginnt eine Diskussion über mögliche Interventionen.
Bei dem nun folgenden Hilfeplangespräch sind die Eltern und Minderjährigen in jedem Fall zu beteiligen und weitere Vertrauenspersonen können auf Wunsch hinzugezogen werden (z. B. Freund*innen, Verwandte). Insbesondere Entscheidungen über Art und Umfang der zu leistenden Erziehungshilfe sollen von allen Beteiligten mitgetragen werden können und es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen und das Lebensumfeld der Eltern und des Kindes angemessen berücksichtigt werden. Auch haben die Hilfeempfänger*innen ein Wunsch- und Wahlrecht in Bezug auf konkrete Einrichtungen und Träger, dem nachgekommen werden muss, wenn keine erheblichen Mehrkosten dadurch entstehen. In der Praxis sind hier ebenfalls praktische Fragen z. B. der jeweils aktuellen Platzkapazität zu berücksichtigen. Die Erziehungshilfe soll außerdem so angelegt sein, dass sie letztlich Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet.