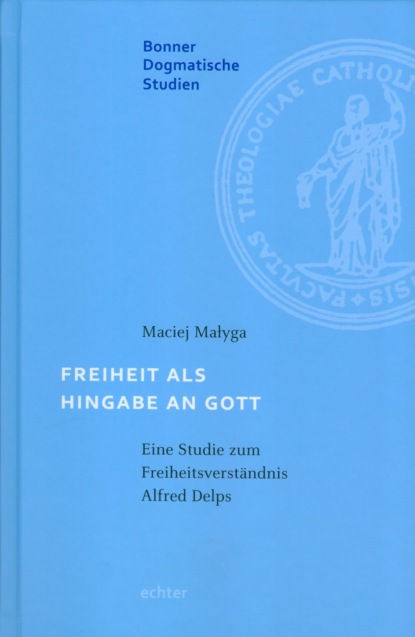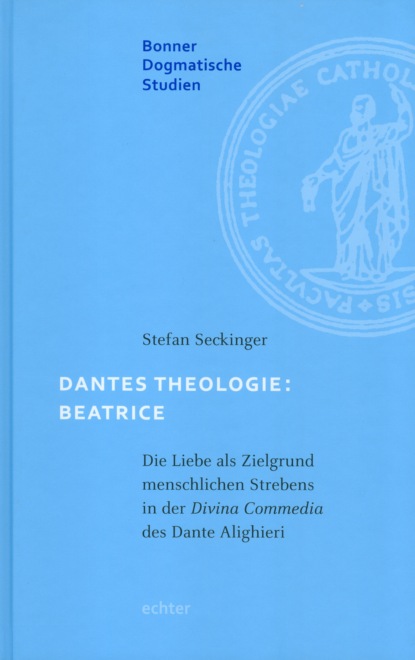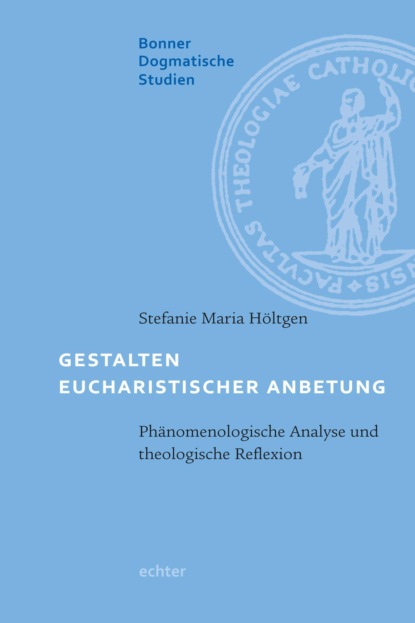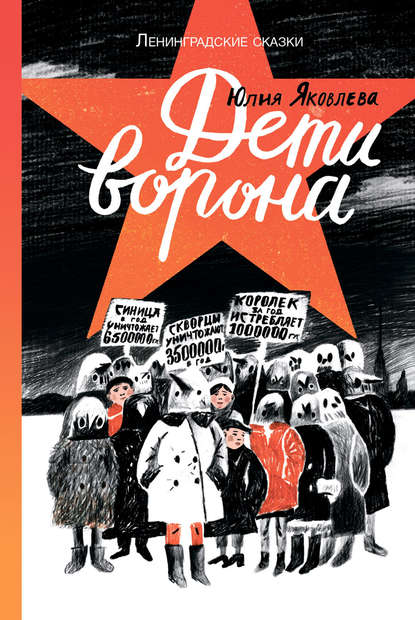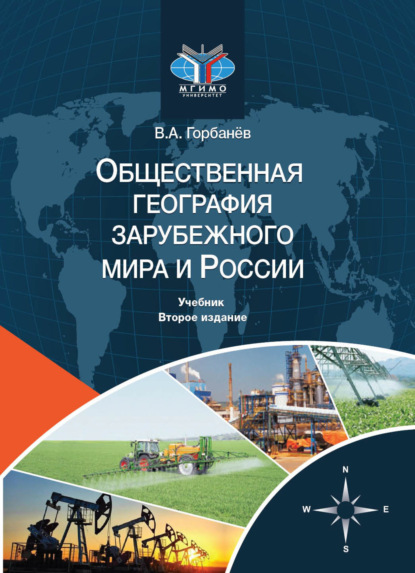Logos Gottes und Logos des Menschen
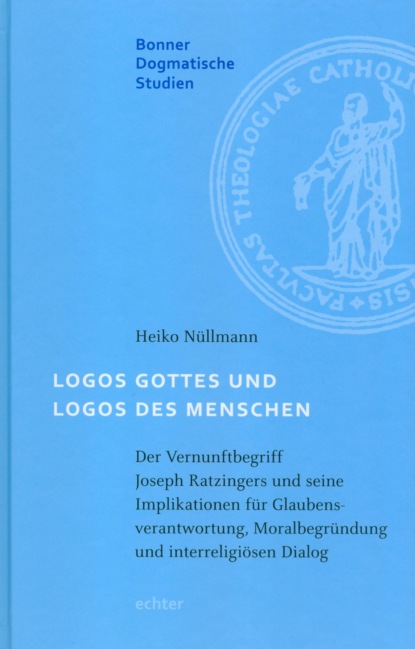
- -
- 100%
- +
Der große Fehler der christlichen Soziallehre liegt nach Meinung Ratzingers nun darin, dass sie die Geschichte zugunsten des Spekulativen vernachlässigt hat. „Sie hat sich diesem Faktum der Geschichtlichkeit weitgehend entzogen und in abstrakten Formeln eine überzeitliche Sozialdogmatik zu formulieren versucht, die es so nicht geben kann.“17 Ratzingers Auffassung von ‚Naturrecht‘ ist hier dagegen die eines sich in Geschichte konkretisierenden Rechts, das aus den Traditionen der Menschheit und aus der christlichen Glaubenstradition schöpft, ohne die es nicht denkbar wäre.18
Schon in seinem 1962 erschienenen Aufsatz Gratia praesupponit naturam hatte Ratzinger diese Geschichtsbezogenheit der menschlichen Natur in Anlehnung an Bonaventura und Paulus herausgestellt. Dabei stellt er im Hinblick auf die Frage der Beziehung von Natur und Gnade fest, dass Bonaventura zufolge die Natur des Menschen nicht rein biologisch an dessen Geist und freiem Willen vorbei bestimmt werden kann. Der menschliche Wille überschreitet nach Ansicht Bonaventuras „als eine eigene Zwischenordnung zwischen bloßer Natur und Gottes eigener Freiheit“19 den allgemeinen biologischen Naturbegriff: Durch den Geist ist die menschliche Natur mehr als Natur im allgemeinen biologischen Sinn.20 Wenn aber die Bestimmung der menschlichen Natur die Freiheit des Geistes umfasst und nicht unabhängig von dieser Freiheit bestimmt werden kann, so bedeutet dies für Ratzinger, dass sie „nicht an ihrer Geschichte vorbei bestimmt werden darf. Es gibt dann keine geschichtslose Natürlichkeit des Menschen.“21 Denn der Geist des Menschen entfaltet sich in der Geschichte und nicht unabhängig von ihr.
Auch hier zeigt sich also wieder der Primat der Geschichte vor der geschichtslosen Ontologie eines Naturrechts. Eine solche Ontologie aber kommt für Ratzinger trotzdem auch bei Bonaventura zum Vorschein, denn der franziskanische Lehrer kennt neben der Betrachtung der Natur ‚von unten‘ auch eine Betrachtungsweise ‚von oben‘: „Betrachtet man aber die Natur von ihrem wahren Bezugspunkt, von Gott her, so zeigt sich, dass im Letzten alle Natur ‚Gnade‘ ist … Die ganze Natur ist in ihrer innersten Tiefe Ausfluss eines Willens, ist voluntarisch strukturiert von dem schöpferischen Urwillen her, dem allein sie ihren Bestand verdankt.“22 Der Schöpfungsgedanke und mit ihm der Gedanke der Schöpfungsordnung werden hier also ganz eng mit dem freiheitlichen Gnadenhandeln Gottes in Verbindung gebracht.23
So kann Ratzinger sagen, dass für Bonaventura Natur von einer doppelten Freiheit umgriffen ist: „von der Freiheit Gottes und der eigenen Freiheit des Menschen.“24 Dies impliziert ihre Einbindung in die Geschichte des Menschen mit Gott, der ihn ruft und dessen Ruf er sich immer wieder verschließt, weil er „den Aufbruch über sich hinaus scheut und so gerade sich selbst verfehlt.“25
Auf ein ähnliches Bild stößt Ratzinger in der paulinischen Theologie. Paulus gebraucht den Naturbegriff einerseits in Bezug auf das Abstammungsmerkmal Jude – Nicht-Jude, andererseits wendet er am Anfang des Römerbriefs einen Naturbegriff an, der ihm nach Ratzinger „offensichtlich aus der stoischen Popularphilosophie zukam, also Natur nicht im Sinne einer blutsmäßig-biologischen Größe, sondern im Sinne einer rational gefassten Wesensstruktur verstand.“26 Den Nicht-Juden, die das jüdische Gesetz nicht kennen, gibt nach diesen Gedanken des Paulus die metaphysisch verfasste Natur das Gesetz ein (vgl. Röm 2,14). Ratzinger weist hier aber darauf hin, dass in den konkreten Anwendungen dieses Gesetzes bei Paulus „der biologische Einschlag in den metaphysischen Begriff sehr stark ist: Eine konkrete biologische Gegebenheit bietet Wegweisung.“27 Er führt als Beispiele Röm 1,26, wo Paulus sich auf den widernatürlichen sexuellen Verkehr bezieht, sowie 1 Kor 11,14 an, wo der Apostel betont, schon die Natur lehre es, dass der Mann kurze, die Frau aber lange Haare tragen müsse.
Neben dieser positiven metaphysisch-biologischen Bestimmung von Natur findet sich bei Paulus aber natürlich auch die theologische Sichtweise einer auf die Gnade Gottes angewiesenen, verderbten Natur des Menschen: Ob Jude oder Nicht-Jude, „das bloß naturale Dasein ist in jedem Falle heillos.“28 Dies ist so, weil die Natur „nicht unmittelbar von Gott auf den Menschen zukommt, sondern geprägt und verunstaltet ist durch eine lange menschliche Vorgeschichte, die auf ihr liegt.“29 So findet nach Paulus der Mensch die Erfüllung seines Lebens eben nicht im reinen Hören auf seine Natur, sondern im Gegenteil nur in der Begegnung mit Christus im Glauben. Die Natur kann für Paulus zwar „sehr wohl das Zeichen des Schöpfers sein, aber sie ist es nicht ungetrübt, weil sie auch Ausdruck der Eigenmächtigkeit des Menschen ist. Wiederum finden wir, wie bei Bonaventura, die Natur des Menschen im Spannungsfeld zwischen zwei Freiheiten, Gottes und des Menschen.“30
Beide Positionen zu einer Synthese zusammenführend kann Ratzinger nun sagen, dass einerseits die Schöpfungsordnung in keinem Menschen ganz erloschen ist und sich ins konkrete Dasein des Menschen hinein auswirkt.31 Es gibt also „so etwas wie den gesunden Menschenverstand, in dem sich das Bewusstsein der verbliebenen Schöpfungsordnung meldet, von dem sich der Mensch immer wieder korrigieren und auf den Boden der Wirklichkeit zurückrufen lassen soll.“32 Andererseits ist diese Schöpfungsbezogenheit des Menschen, die man als seine erste und ursprüngliche Natur bezeichnen kann, überdeckt von seiner sündigen Geschichte. „Der Mensch hat sich selber eine zweite Natur zugelegt, deren Kern die Ichverfallenheit – die concupiscentia – ist.“33 Die göttliche Gnade kann deshalb für den Menschen nur eins bedeuten, nämlich das Aufbrechen dieser zweiten Natur, „das Aufbrechen der harten Schale der Selbstherrlichkeit, welche die Gottesherrlichkeit in ihm überdeckt.“34
Dieses Motiv des ‚Aufbrechens‘ der Ichbezogenheit des Menschen ist für Ratzinger im Symbol des Kreuzes ausgedrückt. Denn „erst die Menschlichkeit, die durch das Kreuz hindurchgegangen ist, bringt den wahren Menschen ans Licht.“35 Doch diese durch das Kreuz markierte Umkehr ist für Ratzinger nichts dem menschlichen Wesen Fremdes, sondern entspricht zutiefst seiner geistigen Natur. Denn wie bei Bonaventura gesehen, besteht die Natur des menschlichen Geistes ja gerade darin, „über alle ‚Natur‘ hinauszusein, in der Selbstüberschreitung zu stehen. Es ist dem Geist wesentlich, sich nicht selbst zu genügen, den Richtungspfeil über sich hinaus in sich zu tragen.“36 Dies aber bedeutet, dass das ‚Aufbrechen‘ der sündigen Ichverfallenheit des Menschen durch das Kreuz gerade seine „wahre Heilung“ ist, „die ihn vor der trügerischen Selbstgenügsamkeit rettet, in der er nur sich selbst verlieren, die unendliche Verheißung, die in ihm liegt, versäumen kann um des spießigen Linsenmuses seiner vermeintlichen Natürlichkeit willen.“37 Durch die geschichtliche Gnadentat Gottes wird der Mensch von seiner verderbten Natur weg- und zu seiner wahren, schöpfungsgemäßen Natur hingeführt.
Diese Argumentationsstruktur Ratzingers lässt drei Pole erkennen, die für ihn in Bezug auf die Rede von Natur und Naturrecht wichtig sind: erstens die Natur als Ausdruck des Willens Gottes und somit als ursprüngliche Schöpfungsordnung; zweitens die Natur als Ausdruck des Willens des Menschen, als seine geistige Natur und somit als geschichtlich bedingte und damit auch durch die menschliche Sünde entstellte Natur; drittens Gottes geschichtliches Heilshandeln an der entstellten Natur des Menschen, das ihn sozusagen zu einer ‚Umkehr‘ in seine wahre schöpfungsgemäße Natur herausfordert. Kurz könnte man diese drei Pole unter den Stichworten Ontologie, Geschichte und Glaube zusammenfassen.
Wie an den analysierten Ausführungen Ratzingers gut zu sehen war, setzt er in diesen frühen Veröffentlichungen einen starken Akzent auf Geschichte und Glaube, um sich vom zu sehr ontologisch geprägten neuscholastischen Naturrechtsbegriff abzugrenzen. Der ontologische Pol taucht in seinen Argumentationen nur sehr am Rande auf, wenn er vom ‚gesunden Menschenverstand‘ spricht, der sich auf die verbliebene Schöpfungsordnung bezieht. Weitaus wichtiger ist ihm der Bezug des Glaubens an die göttliche Gnade auf die Geschichte des Menschen, wie es dann zwei Jahre später auch sein Aufsatz über die Soziallehre der Kirche herausstellt, in dem die Ontologie fast völlig in Geschichte aufgelöst wird.
Die Kritik Ratzingers an der ontologischen Naturrechtsidee bezieht sich dabei, wie gesehen, einerseits auf die Verankerung von Glaubensaussagen im Naturrecht, die dort seiner Ansicht nach nicht hingehören; andererseits scheint ihm hier ein Begriff von Natur vorzuliegen, der sich zu stark am Biologischen orientiert. Wie sich besonders bei seinem Hinweis auf die paulinischen Anwendungen von Röm 2,14 zeigt, scheint ihm gerade der Bezug des Naturrechts auf die stoische Philosophie Normen zu sehr aus einem noch sehr stark biologisch geprägten Naturbegriff ableiten zu wollen. „Die Grundeinstellung des stoischen Ethos darf man, unbeschadet seiner geistigen Höhe, insofern als Naturalismus bezeichnen, als die Stoa in der durchgotteten Natur zugleich das wegweisende Wirken des Logos, des allwaltenden göttlichen Sinnes fand. Demgemäß erschien ihr als die umfassende Norm des Ethos das ‚kata physin‘, die Naturgemäßheit.“38
2.1.2. Die moralische ‚Vernunft der Natur‘
Aus der Kritik Ratzingers am Naturrechtsgedanken lässt sich nun allerdings keine Abkehr vom moralisch-ontologischen Denken ableiten. Zwar betont er, wie gesehen, im Zuge dieser Kritik besonders die historische Verfasstheit des Menschen und scheint in seinem Aufsatz von 1964 die Ontologie sogar fast in Geschichte aufzulösen. Dies geschieht aber offensichtlich nur im Zuge der Polemik gegen ein sich von aller Tradition und Geschichtlichkeit befreiendes naturrechtliches Denken, da er sofort wieder betont, dass es „das alle Menschen umgreifende Rechte“39 gibt. Wie schon festgestellt, bewegt sich das Denken Ratzingers in Bezug auf die moralischen Einsichten des Menschen zwischen den Polen Ontologie, Geschichte und Glaube. Betont Ratzinger in den 60er Jahren gegen die klassische Naturrechtslehre besonders die Geschichte und den sich in ihr konkretisierenden Glauben, so verschiebt sich der Schwerpunkt ab den 70er Jahren zusehends auf den ontologischen Pol der Naturrechtslehre und somit vom heilsgeschichtlichen Denken hin zu metaphysischem Denken. Dies soll nicht heißen, dass das metaphysische Element vorher im Denken Ratzingers nicht vorhanden war. Es scheint vielmehr so zu sein, dass er sich genötigt sah, gegen nachkonziliare theologische Verkürzungen dieses Element seines Denkens mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Umgekehrt lässt sich, wie zu zeigen sein wird, aus der Betonung des ontologischen Pols nicht schließen, dass die anderen Aspekte völlig ausfallen.
Im Zuge der stärkeren Betonung der Ontologie in Bezug auf die moralische Botschaft der Natur kommt dem Begriff der Vernunft eine Schlüsselstellung zu. Denn der Grund, warum das ontologische Verständnis des Naturrechts unglaubwürdig geworden war, liegt nach Ansicht Ratzingers, wie gesehen, in dem mit ihm verbundenen, stark biologisch geprägten Begriff von Natur, „in dem Natur und Vernunft ineinander greifen, die Natur selbst vernünftig ist.“40 Diese enge Verbindung von Vernunft und Natur ist mit der Durchsetzung der Evolutionstheorie unglaubwürdig geworden, denn diese betrachtet Ratzinger zufolge als grundlegendes Strukturelement der Natur nicht etwa die Vernunft, sondern den Zufall.41 Ein Naturrecht, das den Naturbegriff rein biologisch versteht, kann daher heute nicht mehr an die Vernunft des Menschen anknüpfen, weil Natur eben nicht mehr a priori als vernünftig gilt.
‚Moral‘ würde nach Ansicht Ratzingers unter diesen Umständen in der Nachbildung der Evolution bestehen: „Das optimale Überleben der Art ‚Mensch‘ wäre nun der moralische Grundwert; die Regeln, nach denen man es macht, wären die einzelnen moralischen Ordnungen.“42 Doch eine solche moralische Nachbildung der Evolution hat nichts mehr mit dem Hören der Vernunft auf die moralische Weisung der Natur zu tun. Vielmehr wird in der verabsolutierten evolutiven Sinnlosigkeit die Vernunft des Menschen vom Kalkül und Machtstreben abgelöst.43 Doch durch diese Aufhebung der moralischen Vernunft hebt der Mensch sich nach Ratzinger selbst auf: „Die Moral ist abgetreten, und der Mensch als Mensch ist abgetreten. Warum man sich an das Überleben dieser Art klammern soll, ist nicht mehr einsichtig zu machen.“44
Ein Naturrecht, das Natur rein biologisch versteht, muss Ratzinger zufolge den Menschen also zwangsläufig als im Letzten unvernünftiges, vom reinen Naturtrieb gesteuertes Wesen betrachten und hat daher zu heutigen moralischen Fragen, „die die Vernunft des Menschen geschaffen hat und die ohne Vernunft nicht beantwortet werden können“45, nichts beizutragen. „Die physikalisch-chemische Struktur des Menschen gibt nun einmal keine Aussagen im Sinn der traditionellen Moraltheologie ab, überhaupt keine ethischen Aussagen“46.
Folglich muss ein heutiges Naturrecht laut Ratzinger, will es den Menschen nicht nur als Gattungswesen verstehen, sondern ihm als einem die reine Natur in seiner Vernunft überschreitendes Wesen gerecht werden, Vernunftrecht sein: „Das Naturgesetz ist ein Vernunftgesetz: Vernunft zu haben, ist die Natur des Menschen.“47 Der Mensch muss vom Naturrechtsdenken als vernünftiges und somit das rein Biologische überschreitendes Wesen ernst genommen werden.
Für das moralische Verhalten des heutigen Menschen ist deshalb Ratzinger zufolge die Frage unumgänglich, ob es nicht auch angesichts des Evolutionsgedankens „eine Vernunft der Natur und so ein Vernunftrecht für den Menschen und sein Stehen in der Welt geben könne.“48 Es geht Ratzinger also um das Finden einer über das rein Biologische und somit über die klassische Naturrechtskonzeption hinausreichenden ‚Vernunft der Natur‘, auf die sich der Mensch mittels seiner Vernunft beziehen kann. Um angesichts der Evolutionstheorie den ontologischen Pol des naturrechtlichen Denkens aufrechtzuerhalten, ist Ratzinger also darauf angewiesen, in der vernünftigen Strukturiertheit der Wirklichkeit, die das theoretische Denken findet, auch gleichzeitig eine vorgegebene Strukturiertheit des Seins im Hinblick auf die moralische Vernunft anzunehmen.
Dazu greift er auf Überlegungen des deutschen Physikers Werner Heisenberg zurück.49 Heisenberg spricht von einer ‚zentralen Ordnung‘ der Wirklichkeit, auf welche ihre mathematische Strukturiertheit verweist. Er macht sich nun Gedanken über eine mögliche personale Verfasstheit dieser ‚zentralen Ordnung‘, indem er sich z.B. die Frage stellt, ob man ihr als Mensch so nahe sein kann, „wie dies bei der Seele eines anderen Menschen möglich ist“50. Von der Bejahung dieser Frage ausgehend gelangt Heisenberg dann zur Beschreibung der ‚zentralen Ordnung‘ als einem Kompass, „nach dem wir uns richten sollen, wenn wir unseren Weg durchs Leben suchen.“51 So kann Ratzinger zusammenfassend feststellen: „Schöpfung ist nicht nur eine Sache der theoretischen Vernunft, des Schauens und Staunens, sie ist ein ‚Kompass‘“52.
Der geistige Gehalt der Schöpfung ist für Ratzinger also „nicht nur mathematisch-mechanisch. Das ist die Dimension, die die Naturwissenschaft in den Naturgesetzen erhebt. Aber es ist mehr an Geist, an Naturgesetzen in der Schöpfung. Sie trägt eine innere Ordnung in sich und zeigt sie uns auch an. Wir können aus ihr die Gedanken Gottes und die richtige Art ablesen, wie wir leben sollen.“53 Der Logos des Schöpfers zeigt sich nach Ansicht Ratzingers dem Menschen also nicht nur in naturwissenschaftlicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die moralische Vernunfterkenntnis des Menschen. Auch die moralische Vernunft des Menschen erlangt ihre Erkenntnis im Nachdenken der ihr vorgegebenen Vernunft Gottes.54
Somit existieren nach Auffassung Ratzingers zwei „Ordnungen der Natur“:55 Neben der empirisch erfassbaren biologischen Ordnung gibt es eine der moralischen Vernunft zugängliche moralische Schöpfungsordnung. Dies wird für Ratzinger am Beispiel der Ehe deutlich: In ontologisch-moralischer Hinsicht führt die Natur Mann und Frau zueinander und schafft so den familiären Raum für die Entwicklung neuen Menschseins.56 Andererseits erfährt der Mensch in biologischer Hinsicht auch immer die Tendenz zu sexueller Promiskuität, die der Logik von Ehe und Familie zuwiderläuft. „Das eine stellt sich wirklich als die Botschaft der Schöpfung dar – das andere als die Selbstverfügung des Menschen.“57 Nicht die Konzentration des Menschen auf die biologische Ordnung der Natur, sondern nur das Hören auf die moralische Vernunft der Natur kann ihm also moralische Werte an die Hand geben.
Auch wenn Ratzinger also ‚Naturrecht‘ im klassischen Sinne nicht mehr als glaubwürdig erscheint, so bleibt der Grundgedanke des Begriffs seines Erachtens doch bestehen: „Es gibt das von ‚Natur‘, vom Kompass der Schöpfung her Rechte, das zugleich Völkerrecht über die Grenzen der einzelnen staatlichen Rechtssetzungen hinweg ermöglicht.“58 Der Gedanke einer die Wirklichkeit strukturierenden schöpferischen Vernunft, auf den schon das naturwissenschaftliche Denken stößt, kommt auf diese Weise auch im Hinblick auf die moralische Vernunft des Menschen zum Tragen und ermöglicht Ratzinger eine Rehabilitation des Naturrechtsgedankens auf einer das Biologische transzendierenden metaphysischen Ebene.
Für diese Arbeit ist es von Bedeutung, dass Ratzinger in dieser Argumentation explizit dem Vorbild Platons folgt. Denn auch „Platon stellt, auf Sokrates gestützt, dem Naturrecht des Schlau-Starken das Naturrecht des Seins entgegen, in dem dem Einzelnen ein Plan im Ganzen zukommt.“59 Platon nimmt dabei den sophistischen Begriff des Naturrechts also bewusst auf, „interpretiert ihn aber nicht individualistisch und rationalistisch, sondern als Gerechtigkeit des Seins, die dem Einzelnen und dem Ganzen Existenzmöglichkeit gibt.“60 Natur wird demnach bei Platon ganz analog zu Ratzinger nicht im Sinne des Rechts des Stärkeren verstanden, sondern als Quelle ethischer Einsichten für die Gemeinschaft, die Polis. Auf einer metaphysischen Ebene fallen sowohl für Platon als auch für Ratzinger Natur und moralische Vernunft zusammen.61
2.2 Gewissen: Die moralische Vernunft im Menschen
2.2.1. Reduktion des Gewissens auf Subjektivität
Der Begriff des Gewissens ist für Ratzinger zentral für die nähere Bestimmung des Bezugs des Menschen zur moralischen Vernunft des Seins. Er grenzt sich dabei von einem Gewissensverständnis ab, welches die Subjektivität des Menschen zum letzen Maßstab moralischer Entscheidungen erhebt.62 In diesem Verständnis erscheint Gewissen seiner Ansicht nach als ein „Bollwerk der Freiheit gegenüber den Einengungen der Existenz durch die Autorität“63, als die „oberste Norm … der der Mensch – auch gegen die Autorität – zu folgen hat.“64 Eine besondere Schärfe gewinnt diese Auffassung von Gewissen in Bezug auf das Verhältnis gläubiger Christen zum kirchlichen Lehramt, denn das „Gewissen vieler Christen harmoniert keineswegs einfachhin mit den Aussagen des kirchlichen Lehramts; es erscheint im Gegenteil weithin als die eigentliche Legitimationsinstanz für den Dissens.“65
Dass einer klaren Gewissensweisung immer zu folgen ist, ist auch für Ratzinger unbestritten. „Aber ob das Gewissensurteil oder was man für ein solches ansieht, auch immer recht habe, ob es unfehlbar sei, ist eine andere Frage.“66 Denn eine solche Auffassung würde die Existenz einer vom rein Subjektiven unabhängigen moralischen Wahrheit der Wirklichkeit abstreiten, moralische Wahrheit ins rein Subjektive verlegen und sie somit auf bloße Wahrhaftigkeit reduzieren.67 Dieses Abschneiden des subjektiven Denkens von einer objektiven moralischen Wahrheit führt nun aber nach Überzeugung Ratzingers zu verheerenden Konsequenzen für das moralische Empfinden des Menschen. Denn von dieser Überzeugung her wäre ja z.B. die Ansicht vertretbar, „dass Hitler und seine Mittäter, zutiefst von ihrer Sache überzeugt, gar nicht anderes handeln durften und daher – bei aller objektiven Schrecklichkeit ihres Tuns – subjektiv moralisch gehandelt hätten.“68
Aus diesen Überlegungen folgt für Ratzinger eindeutig die Unzulänglichkeit eines solchen rein subjektiv verstandenen Gewissensbegriffs. Gewissen muss seiner Auffassung nach dagegen sehr wohl etwas mit einer moralischen Wahrheit zu tun haben, die vom rein subjektiven Empfinden unabhängig ist. Denn nur dann kann ja überhaupt die Rede davon sein, dass das Handeln eines Menschen durch sein Gewissen infrage gestellt wird.69
Bleibt diese kritische Aufgabe des Gewissens unerfüllt, kann das nach Ratzinger zu einer inneren Abkapselung und somit zu einer Beeinträchtigung der Beziehungsfähigkeit des Menschen führen, wie er am neutestamentlichen Vergleich des büßenden Zöllners mit dem selbstgerechten Pharisäer deutlich macht: „Der Pharisäer weiß nicht mehr, dass auch er Schuld hat. Er ist mit seinem Gewissen völlig im Reinen. Aber dieses Schweigen des Gewissens macht ihn undurchdringlich für Gott und die Menschen, während der Schrei des Gewissens, der den Zöllner umtreibt, ihn der Wahrheit und der Liebe fähig macht.“70 Ein Mensch, der sich seiner selbst völlig sicher ist und sich von nichts mehr infrage stellen lässt, ist nicht mehr imstande, sich auf die Beziehung zu anderen Menschen geschweige denn zu Gott einzulassen und somit zur Liebe unfähig. Ohne Wahrheit ist Liebe für Ratzinger folglich nicht möglich.71
So geht es für Ratzinger nicht an, das Gewissen des Menschen einfach mit dessen subjektiver Gewissheit gleichzusetzen. Denn ein solches Selbstbewusstsein des Menschen kann sich ja auch einfach nach den gerade in seinem Umfeld angesagten Meinungsbildern richten, ohne diese kritisch zu hinterfragen. Deshalb wirkt die Reduktion des Gewissens auf die menschliche Subjektivität auch nicht als Befreiung des Menschen, sondern im Gegenteil als seine Versklavung, denn sie führt in die totale Abhängigkeit von den herrschenden Meinungen: „Wer das Gewissen mit oberflächlicher Überzeugtheit gleichsetzt, identifiziert es mit einer schein-rationalen Sicherheit, die aus Selbstgerechtigkeit, Konformismus und Trägheit gewoben ist. … Die Reduktion des Gewissens auf subjektive Gewissheit bedeutet zugleich den Entzug der Wahrheit.“72 Ein solches Gewissensverständnis, das den Relativismus gewissermaßen kanonisiert, ist in Ratzingers Augen in der Gegenwart vorherrschend.73
2.2.2. Gewissen als Organ der moralischen Vernunft
Gewissen hat für Ratzinger also im Gegensatz zum beschriebenen subjektivistischen Verständnis etwas mit objektiver Wahrheitserkenntnis zu tun. Seine Auffassung, dass der Mensch fähig ist, eine objektive moralische Wahrheit in der Wirklichkeit mittels seiner Vernunft zu erkennen, ist seiner Meinung nach auch genau der Standpunkt, den schon Sokrates und Platon gegen die Sophisten bezogen haben. In diesem antiken Streit sieht Ratzinger die Parallele zum heutigen Disput um die Wahrheitsfähigkeit des Menschen, „in dem der Urentscheid zwischen zwei Grundhaltungen durchgeprobt worden ist: dem Vertrauen auf die Wahrheitsfähigkeit des Menschen einerseits und einer Weltsicht andererseits, in der nur der Mensch sich selbst seine Maßstäbe schafft.“74
Auch im Römerbrief des Paulus findet sich ein Plädoyer für die Wahrheitsfähigkeit des Menschen, wenn Paulus sagt, „dass die Heiden sehr wohl auch ohne Gesetz wussten, was Gott von ihnen erwartet (Röm 2,1–16).“75 In Röm 2,14f schreibt Paulus: „Wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist“. Ratzinger folgert daraus: „Es gibt die gar nicht abzuweisende Gegenwart der Wahrheit im Menschen – jener einen Wahrheit des Schöpfers, die in der heilsgeschichtlichen Offenbarung auch schriftlich geworden ist. Der Mensch kann die Wahrheit Gottes auf dem Grund seines Geschöpfseins sehen.“76
An dieser Stelle muss natürlich auffallen, dass gerade die von Paulus behauptete natürliche moralische Erkenntnis aus Röm 2,14 von Ratzinger selbst im Zuge seiner Auseinandersetzung mit dem Naturrechtsgedanken kritisiert worden war. Grund dafür war der stark stoisch geprägte biologische Einschlag des paulinischen Naturbegriffs, der sich nach Ratzinger besonders in Röm 1,26 und 1 Kor 11,14f zeigt.77 Wenn Röm 2,14f nun trotzdem zum Zentrum der Argumentation Ratzingers wird, macht das deutlich, dass der Gedanke einer Ausrichtung der moralischen Vernunft des Menschen an einer übergeschichtlichen moralischen Wahrheit stärker in den Mittelpunkt von Ratzingers Denkens gerückt ist als zu Anfang seiner Schaffenszeit.78