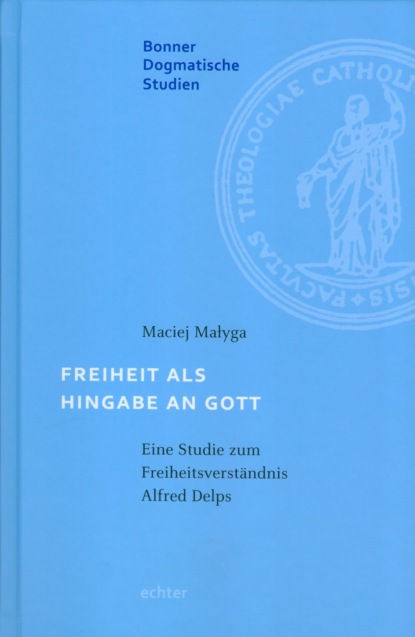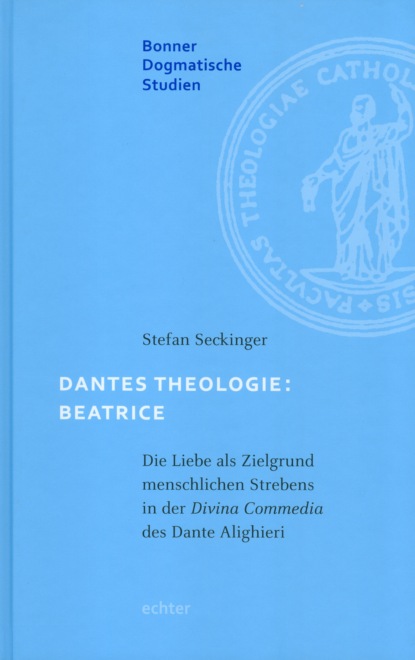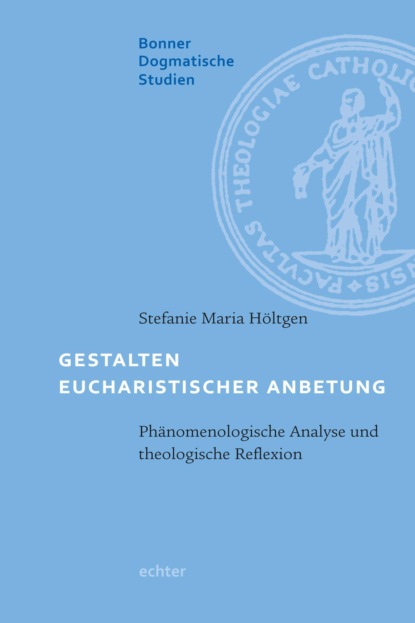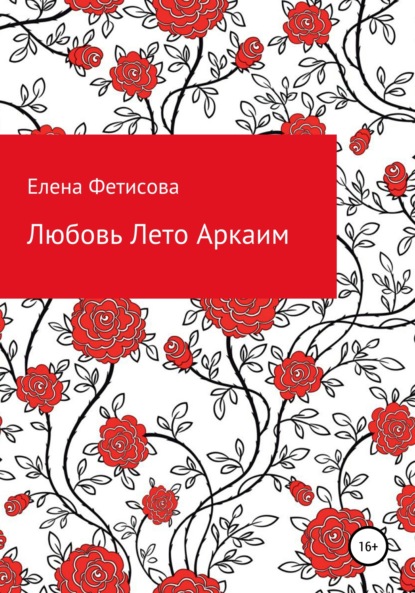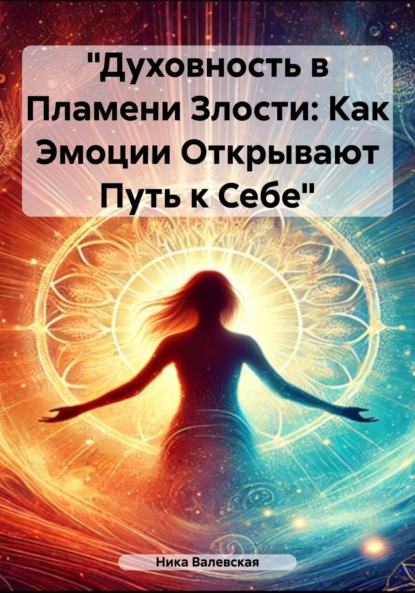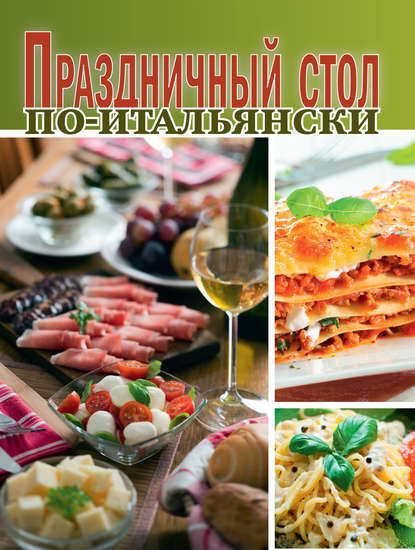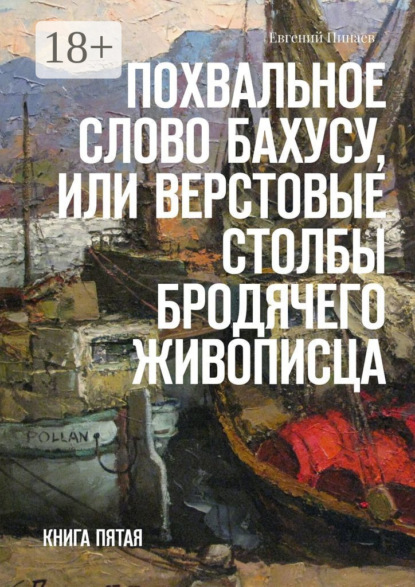Logos Gottes und Logos des Menschen
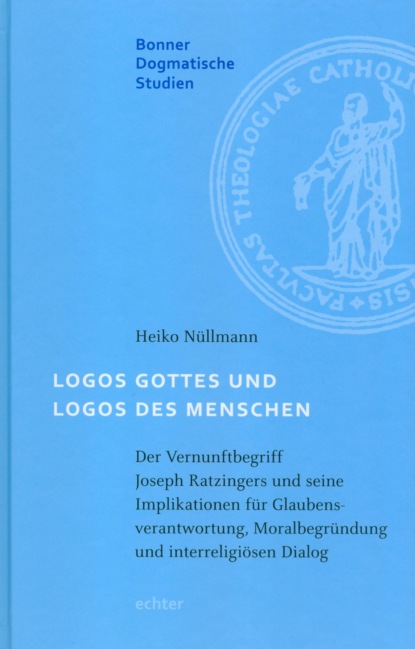
- -
- 100%
- +
Des Weiteren muss hier der Bezug zum Schöpfungsgedanken unterstrichen werden: Moralische Wahrheit hat für Ratzinger offensichtlich etwas mit der im Menschen anwesenden Schöpfungsordnung Gottes zu tun. „Im Gewissen, im stillen Mitwissen des Menschen mit dem innersten Grund der Schöpfung, ist der Schöpfer als Schöpfer dem Menschen gegenwärtig.“79 Dazu passt auch Ratzingers Bezug zum Gewissensbegriff John Henry Newmans, den er als „die Aufhebung der bloßen Subjektivität in der Berührung zwischen der Innerlichkeit des Menschen und der Wahrheit von Gott her“80 beschreibt.
Ratzinger sieht also im Gewissen den inneren Ort der Begegnung des Menschen mit der Wahrheit des Schöpfers, die er dort ganz unabhängig vom Glauben an die Offenbarung einsehen kann. „Gewissen heißt, ganz einfach gesagt, den Menschen, sich selbst und den anderen, als Schöpfung anerkennen und in ihm den Schöpfer respektieren.“81 Das Gewissen bringt dem Menschen seine „seinshafte Verwiesenheit auf Gott“82 zu Bewusstsein. „Unser ganzes eigenes Sein sagt uns doch, dass wir uns weder selbst gemacht haben noch selbst machen können. Dass wir voneinander und letzten Endes alle miteinander von dem abhängig sind, was nicht in unseren Händen steht.“83 Ratzinger beschreibt das Bewusstsein dieser Abhängigkeit des Menschen von seinem Schöpfer als Erfahrung, „die zur metaphysischen Urerfahrung eines jeden Menschen gehört“84.
Diesen auf die moralische Schöpfungsordnung bezogenen Charakter des Gewissens beschreibt Ratzinger nun mit dem platonischen Begriff der ‚Anamnesis‘. Platon versteht unter diesem Begriff die Erinnerung der Seele an ihre unmittelbare Schau der Ideen vor ihrem Eintreten in den Körper.85 Ratzinger findet auch in Röm 2,14f das Motiv der Erinnerung und kann so den philosophischen Begriff der Anamnesis auf den paulinischen Gedanken des den Heiden ins Herz geschriebenen moralischen Gesetzes beziehen. „Die … ontologische Schicht des Phänomens Gewissen besteht darin, dass uns so etwas wie eine Urerinnerung an das Gute und an das Wahre (beides ist identisch) eingefügt ist; dass es eine innere Seinstendenz des gottebenbildlich geschaffenen Menschen auf das Gottgemäße hin gibt.“86 Ratzinger beschreibt diese „Anamnese des Ursprungs, die sich aus der gottgemäßen Konstitution unseres Seins ergibt“87, nicht etwa als ein inhaltliches Wissen von bestimmten Normen, sondern vielmehr als einen ‚inneren Sinn‘, „eine Fähigkeit des Wiedererkennens, sodass der davon angesprochene und inwendig nicht verborgene Mensch das Echo darauf in sich erkennt. Er sieht: Das ist es, worauf mein Wesen hinweist und hin will.“88 Der Mensch erinnert sich also gewissermaßen an einen ihm als Geschöpf vom Schöpfer eingeprägten Begriff des moralisch Richtigen. Er findet auf dem Grund seines Seins seine ursprüngliche, verschüttete Natur, die schöpferische Vernunft seines Seins.
Bei aller Bezogenheit auf den Schöpfer ist es nun aber wichtig, das Gewissen nicht selbst mit der Stimme Gottes im Menschen zu verwechseln. Eine solche Interpretation würde seine Unverletzlichkeit zwar auch klar herausstellen, kann aber sich widersprechende Gewissensentscheidungen bei verschiedenen Menschen nicht erklären: „Sagt denn Gott zu verschiedenen Menschen Widersprüchliches? Widerspricht Gott sich selbst? Verbietet er dem einen bis hin zur Martyriumspflicht, was er dem anderen erlaubt oder sogar gebietet?“89 Für Ratzinger erweist sich eine solche problembeladene Identifizierung von Gewissensurteilen mit der Rede Gottes als nicht schlüssig. Dagegen sagt er mit Bezug auf Robert Spaemann: „Das Gewissen ist ein Organ, kein Orakel. Es ist ein Organ, d.h.: es ist etwas uns Gegebenes, zu unserem Wesen Gehöriges, nicht etwas von außen Gemachtes.“90 Das Gewissen ist also nicht selbst die moralische Wahrheit, sondern ein Organ für diese Wahrheit, die von außen auf den Menschen zukommt. „Aber als Organ bedarf es des Wachstums, der Bildung und der Übung.“91 Mit Spaemann vergleicht Ratzinger die Bildung des Gewissens mit der Entwicklung der Sprache eines Menschen: „Der Mensch ist von sich selbst her ein sprechendes Wesen, und er wird es doch nur, indem er von anderen das Sprechen lernt.“92 Zwar ist die Sprachfähigkeit im Menschen angelegt, doch sie bedarf der Formung von außen. Analog verhält es sich mit der Gewissensbildung. Der Mensch ist für Ratzinger „von sich selbst her ein Wesen, das ein Organ des inneren Wissens um Gut und Böse hat. Aber damit er wird, was er von sich her ist, bedarf er der Hilfe der anderen: Das Gewissen bedarf der Formung und der Erziehung“93. Bleibt eine solche Erziehung aus, kann es zur Verkümmerung des Gewissens kommen, zur Unfähigkeit des Menschen, Schuld zu empfinden.94
Vor diesem Hintergrund wird nun auch deutlich, in welcher Hinsicht das Gewissen des Menschen fehlbar ist und warum ein Mensch in objektiver Hinsicht moralisch schlecht handeln kann, obwohl er seinem Gewissen folgt, also ‚nach bestem Wissen und Gewissen‘ handelt. Denn wenn das Gewissen nicht selbst als Stimme der moralischen Wahrheit, sondern nur als Organ für diese aufgefasst wird, kann es auch im Menschen verkümmert sein, sodass er in diesem Fall die moralische Wahrheit des Seins mittels seines Gewissens nicht zu vernehmen vermag. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass seine Handlung nicht dem moralischen Sollen des Seins gemäß ist und der Mensch sich objektiv schuldig macht, obwohl er nach seinem Gewissen gehandelt hat. „Es ist nie Schuld, der gewonnenen Überzeugung zu folgen – man muss es sogar. Aber es kann sehr wohl Schuld sein, dass man zu so verkehrten Überzeugungen gelangt ist und den Widerspruch der Anamnese des Seins niedergetreten hat. Die Schuld liegt dann woanders, tiefer: nicht in dem jetzigen Akt, sondern in der Verwahrlosung meines Seins, die mich stumpf gemacht hat für die Stimme der Wahrheit und deren Zuspruch in meinem Innern.“95
Der Mensch ist der Verkümmerung seines Gewissens allerdings nicht gänzlich schutzlos ausgeliefert, als ob er nur Opfer einer schlechten Erziehung wäre. Ratzinger betont nämlich in Anlehnung an Augustinus, dass für die moralische Erkenntnisgewinnung der Wille des Menschen eine große Rolle spielt. Augustinus sah es zwar nicht als Schuld des Menschen an, nicht im Besitz von Erkenntnis zu sein, sehr wohl aber, nicht nach dieser zu streben.96 „Ob hier etwas erkannt oder nicht erkannt wird, hängt immer auch vom Willen des Menschen ab, der Erkenntnis versperrt oder zur Erkenntnis führt.“97 Der Mensch ist nach Ratzinger also imstande, seine vorgegebene moralische Prägung durch seinen Willen entweder weiter zu entstellen oder aber zu reinigen.98 Auf diesem Wege entgeht Ratzinger einem Gewissens-Determinismus, der den Menschen als Opfer seiner Umwelt der Verantwortung für seine Taten entheben könnte.
Unterschiedliche Gewissensentscheidungen unterschiedlicher Menschen bedeuten folglich für Ratzinger auch nicht, dass es unterschiedliche Wahrheiten gäbe. Die Wahrheit ist nur eine einzige, und deshalb ist auch der „Weg des Gewissens, der Ausschau hält nach der Wahrheit und dem objektiv Guten … nur ein Weg, auch wenn er gemäß der Vielheit der Menschen und ihrer Situationen viele Gestalten hat.“99 Menschen können bei ihrer Suche nach der Wahrheit aufgrund ihres nicht hinreichend geformten Gewissens irren, die Wahrheit bleibt indessen immer dieselbe.
Ausgehend von diesen Überlegungen kann das Gewissen als konstitutiver Bestandteil der moralischen Vernunft des Menschen bezeichnet werden. Es ist das „Organ für die Wahrheit“100, mit welchem der Mensch die moralische Seite des Schöpfungslogos erkennen kann. Im Idealfall ist dann „die Sprache des Seins, die Sprache der ‚Natur‘, identisch mit der Sprache des Gewissens.“101 Ratzingers doppelpoliges Verständnis des Vernunftbegriffs tritt hier sehr deutlich hervor: Es gibt auf der einen Seite die Vernunft des Menschen als ‚Organ‘, auf der anderen Seite die Vernunft des Schöpfers als bleibende, übergeschichtliche Wahrheit, auf welche sich die Vernunft des Menschen bezieht.102
2.2.3. Notwendiges Leiden für die Wahrheit
Weil das Gewissen nach Ansicht Ratzingers das Organ für die moralische Wahrheit des Seins ist, kann es dem Menschen als ein objektiver Maßstab in moralischen Fragen dienen. Aufgrund dieser Objektivität fällt es nicht zusammen „mit den eigenen Wünschen und dem eigenen Geschmack; es fällt nicht zusammen mit dem, was das sozial Günstigere ist, mit dem Konsens der Gruppe, mit den Ansprüchen politischer und sozialer Macht.“103 Es generiert vielmehr Widerspruch gegen Lebensumstände, die der moralischen Vernunft der Wirklichkeit, die es dem Menschen zugänglich macht, zuwiderlaufen. So ist für Ratzinger ein Mann des Gewissens auch jemand, „der niemals Verträglichkeit, Wohlbefinden, Erfolg, öffentliches Ansehen und Billigung von Seiten der herrschenden Meinung durch den Verzicht auf Wahrheit erkauft.“104 Eine solche Haltung impliziert notwendigerweise eine Leidensbereitschaft für die Wahrheit: Der „Höhenweg zur Wahrheit, zum Guten ist nicht bequem. Er fordert den Menschen.“105 Denn als Mensch ist man nach Ansicht Ratzingers immer versucht, unter dem Vorwand der Gutmütigkeit etwa Bequemlichkeit oder gutes Ansehen der Wahrheit überzuordnen.106
Doch auch wenn die Option für die Wahrheit den Menschen mehr fordert als ihr Ignorieren, bleibt ihm nach Ratzinger keine wirkliche Wahl, denn mit der Unwahrheit kann der Mensch auf Dauer nicht glücklich werden. „[N]icht das bequeme Bleiben bei sich selbst erlöst ihn; darin verkümmert er und verliert sich.“107 Ganz im Gegenteil braucht der Mensch einen moralischen Maßstab, nach dem er sein Leben ausrichten kann, wie Ratzinger mit einem Verweis auf die seines Erachtens moralisch unterforderte Jugend feststellt.108 „Irgendwo steckt das im Menschen drin, dass er weiß: Ich muss gefordert werden und ich muss mich nach einem höheren Maß bilden und mich zu geben und zu verlieren lernen.“109 Der Mensch braucht das Herausgerissen-werden aus seinem nach Bequemlichkeit strebendem Eigenwillen hin zum ihn fordernden und leiden lassenden moralischen Logos, welcher der Wille des Schöpfers ist. Ratzinger folgt mit dieser Auffassung ganz seinem eingangs beschriebenen Verständnis der menschlichen Natur, die zwischen dem Eigenwillen des Menschen und dem Willen des Schöpfers angesiedelt ist.110
Wo der Mensch sich nun aber scheut, den unbequemen Weg der Wahrheit zu gehen, verfehlt er nach Ratzinger den Sinn seines Daseins, denn eine solche Leidverweigerung, die nichts anderes ist als die Verweigerung seiner eigenen Kreatürlichkeit, „ist letzten Endes die Verweigerung der Liebe selbst, und das ruiniert den Menschen.“111 Wieder kommt hier die enge Verbindung von Wahrheitsorientierung und Liebesfähigkeit bzw. Beziehungsfähigkeit des Menschen zur Sprache: Ohne die Ausrichtung des Menschen an der moralischen Wahrheit ist ihm auch die Fähigkeit der Liebe verwehrt; die Verweigerung der Wahrheit impliziert die Verweigerung der Liebe. Weil Leben und Leiden für Ratzinger untrennbar zusammengehören, ist Leidflucht für ihn außerdem identisch mit Lebensflucht.112
Seine Erfüllung findet der Mensch also nicht in der Loslösung von der moralischen Vernunft des Seins zugunsten seiner subjektiven Interessen, sondern im Gegenteil durch den Aufbruch zur Wahrheit, im Hören auf die Stimme seines Gewissens. „In der Bergwanderung des Guten entdeckt er immer mehr die Schönheit, die in der Mühsal der Wahrheit liegt und dass gerade sie für ihn das Erlösende ist.“113 Das Erlösende besteht dabei gerade in der Selbstlosigkeit der Wahrheit, denn diese führt den Menschen über seine Subjektivität hinaus; sie macht ihn frei von der Abhängigkeit vom eigenen Geschmack und von der herrschenden Meinung.
Die durch das Gewissen in der Wirklichkeit vorgefundene Wahrheit ist für den Menschen also nicht primär eine Einschränkung, sondern wirkt vielmehr erlösend und befreiend. „Freiheit und Bindung werden hier, im Innersten menschlichen Wesens, identisch.“114 Denn die moralische Vernunft der Wirklichkeit ist gleichzeitig der Wille des Schöpfers und dieser Wille „ist für den Menschen nicht eine fremde, von außen kommende Gewalt, sondern die Richtung seines Wesens.“115 Die Bindung des Eigenwillens des Menschen an die moralische Vernunft, an den Willen des Schöpfers, führt den Menschen zu seiner wahren Natur und somit zur wahren Freiheit.116
2.2.4. Das Ausstrecken des Gewissens auf den Erlösungsglauben hin
Diese im Gewissen und damit im moralischen Vernunftvermögen des Menschen angetroffene Erkenntnis der moralischen Schöpfungsordnung wird von Ratzinger zunächst einmal unabhängig von der Glaubensentscheidung des Menschen gedacht. Jeder Mensch kann also nur mittels seines moralischen Vernunftvermögens, im Hören auf die Stimme seines Gewissens, die moralische Vernunft des Schöpfers in der Wirklichkeit vernehmen. Wie soeben erläutert, bedeutet diese dem Menschen einsehbare Wahrheit aber einen unglaublichen Anspruch an ihn und sein Handeln. Denn sie zwingt ihn über sich selbst hinaus, über seinen Egoismus und seine Konformität in den Raum des ‚objektiv‘ moralisch Vernünftigen, in den Raum der objektiven Wahrheit. Das Gewissen ist deshalb eben nicht die Bestätigung der menschlichen Subjektivität, sondern der Richter über den Menschen. Dies aber führt Ratzinger zufolge dazu, dass es den Menschen im Falle seines Verstoßes gegen die moralische Vernunft schuldig spricht: Der Mensch muss fortan mit einem schlechten Gewissen leben. Dies ist ihm jedoch auf die Dauer unerträglich, und so wird er dieser Situation zu entrinnen versuchen, indem er die Stimme seines Gewissens fortan ignoriert. Die Fähigkeit des Menschen, Schuld wahrzunehmen, verkümmert dann, was nach Ansicht Ratzingers zur Verhärtung und inneren Erkrankung des Menschen führt.117 „Dieses Abstumpfen des Gewissens ist unsere große Gefahr. Es erniedrigt den Menschen.“118
Das Einzige, was den Menschen aus diesem Dilemma befreien kann, ist der erlösende Freispruch von seiner Schuld. Der Mensch sehnt sich laut Ratzinger deshalb danach, „dass der objektiv gerechte Schuldspruch des Gewissens und die daraus folgende zerstörerische innere Not nicht das Letzte seien, sondern dass es eine Vollmacht der Gnade gebe, eine Kraft der Sühne, die die Schuld verschwinden lässt und Wahrheit erst wirklich erlösend macht.“119 In diesem Gedanken Ratzingers wird eine innere logische Verbindung zwischen moralischem Logos Gottes und christlicher Erlösungslehre deutlich: Hier zeigt sich für Ratzinger, „wie die Anamnese des Schöpfers sich in uns ausstreckt auf den Erlöser hin und jeder Mensch ihn als Erlöser zu begreifen vermag, weil er auf unsere innerste Erwartung antwortet.“120
Der Mensch findet Ratzinger zufolge also mittels seines Vernunftvermögens den moralischen Logos des Schöpfers, wird aber aufgrund des Anspruchs dieses Logos über denselben hinaus verwiesen auf den liebenden, vergebenden Zuspruch ebendieses Logos. Dieser liebende Zuspruch liegt jedoch außerhalb der Reichweite der moralischen Vernunft des Menschen, etwa vergleichbar mit der Begrenzung seiner naturwissenschaftlichen Vernunft, die ja auch selbst über ihre Methode hinausweist. Um wirklich moralisch handeln zu können, ist der Mensch in seiner moralischen Vernunft im Letzten auf den Glauben an die liebende und somit erlösende Zuwendung des Schöpfers angewiesen. Denn der Mensch kann das ‚Joch der Wahrheit‘ (vgl. Mt 11,30) nach Ansicht Ratzingers nur tragen, wenn dieses Joch für ihn durch die Gewissheit leicht geworden ist, dass „die Wahrheit kam, uns liebte und unsere Schuld in ihrer Liebe verbrannte. Erst wenn wir dies von innen her wissen und erfahren, werden wir frei, die Botschaft des Gewissens angstlos und freudig zu hören.“121
Anders formuliert kann man sagen: Wahrheit ohne Liebe erlöst den Menschen nicht. Seine moralische Vernunft gibt ihm die Einsicht in die Wahrheit und die damit verbundene Einsicht in seine Schuld; die Erlösung von dieser Schuld aber kann ihm nur durch Liebe zuteil werden. Die Einsicht in die Liebe aber, in die vergebende und erlösende Zuwendung der schöpferischen Vernunft, kann ihm sein moralisches Vernunftvermögen, sein Gewissen, allein nicht geben. Es kann ihm lediglich seine Abhängigkeit von der Wahrheit vor Augen führen und ihn so auf das existentielle Bedürfnis verweisen, von dieser Wahrheit auch geliebt zu sein. Durch die Vernunft der Schöpfungs-Anamnese streckt sich der Mensch also zum Erlösungsglauben hin aus; er sieht ein, dass er der erlösenden Liebe durch die Wahrheit bedarf. „Der Mensch ist abhängig – das ist seine primäre Wahrheit. Weil es so ist, kann nur die Liebe ihn erlösen, weil nur sie Abhängigkeit in Freiheit umwandelt.“122
So kann Ratzinger auch sagen, dass ‚nach dem Gewissen zu leben‘ für den Menschen bedeutet, dem „Ruf auf Glaube und Liebe hin“123 zu folgen. Man kann hier eine Wechselbeziehung zwischen moralischer Vernunfteinsicht und Glaube feststellen: Die moralische Vernunft streckt sich im Gewissen auf den Glauben hin aus, während dieser durch den Erlösungsgedanken die moralische Vernunfteinsicht für den Menschen erst möglich und im konkreten Leben erträglich macht und das Gewissen so vor seiner Abstumpfung schützt. Denn die „Fähigkeit, Schuld wahrzunehmen, ist dann erträglich und entfaltet sich, wenn es auch die Heilung gibt.“124 Nur in der durch Christus vermittelten vergebenden Liebe der Wahrheit ist es dem Menschen möglich, sich trotz aller Verfehlungen immer wieder an dieser Wahrheit auszurichten und die Stimme seines Gewissens immer wieder neu als Maßstab seines Handelns anzunehmen.
Aufgrund dieser Wechselbeziehung von moralischem Vernunftvermögen des Menschen und seinem Glauben an die erlösende Liebe durch die Wahrheit kann Ratzinger die moralische Vernunft eines Menschen als Maßstab für seinen christlichen Glauben ansehen. Die Offenheit des Gewissens ist für ihn letztlich gleichbedeutend mit der inneren „Zugehörigkeit zu Christus“125.
Die moralische Vernunft als ‚Organ‘ des Menschen für den Logos Gottes ist, wie gesehen, laut Ratzinger verwiesen auf geschichtliche Formung. „Auch die Vernunft … ist ein Organ und nicht ein Orakel. Auch sie bedarf der Übung und der Gemeinschaft.“126 Diese Geschichtsbezogenheit menschlicher Vernunft im Denken Ratzingers wird im Folgenden behandelt. Dabei wird deutlich, dass bei allem Gewicht, das er auf den Bezug der Vernunft zu einer übergeschichtlichen Wahrheit legt, die Geschichte und die Tradition bei Ratzinger nach wie vor eine große Rolle spielen.
2.3 Traditionen: Die moralische Vernunft in der Geschichte
2.3.1. Der Mensch als geschichtliches Wesen
Menschsein ist für Ratzinger untrennbar mit Geschichtlichkeit verbunden. Diese gründet seiner Ansicht nach in erster Linie in der leiblichen Verfasstheit des Menschen. Denn „wenn der reine Geist streng für sich seiend gedacht werden kann, so besagt Leibhaftigkeit das Abstammen voneinander: Die Menschen leben in einem sehr wirklichen und zugleich in einem sehr vielschichtigen Sinn einer vom andern.“127
Diese durch seine Leiblichkeit bedingte Bindung des Menschen an Geschichte und Gemeinschaft wirkt sich nun ebenfalls auf seinen Geist aus. Denn sie bedeutet für den Menschen, welcher selbst „Geist nur im Leib und als Leib ist, dass auch der Geist – einfach der eine, ganze Mensch – zutiefst von seinem Zugehören zum Ganzen der Menschheit … gezeichnet ist.“128 So sind in jedem Menschen nach Ratzinger „die Vergangenheit und Zukunft der Menschheit mit anwesend“129, denn er ist in ihre geschichtliche Mitte hineingeboren und sein Denken ist mit dem Denken der gemeinsamen Menschheitsgeschichte untrennbar verwoben.
Ratzinger macht diese Untrennbarkeit am Beispiel der Sprache deutlich: Als Mensch bin ich in meinem geistigen Leben vollkommen auf sie angewiesen, mein „Menschsein realisiert sich im Wort, in der Sprache, die meine Gedanken prägt und mich einstiftet in die mitmenschliche Gemeinschaft, die mein eigenes Menschsein prägt.“130 Dabei ist die Sprache aber alles andere als eine private und neue Erfindung des jeweiligen Menschen: „Sie kommt von weit her, die ganze Geschichte hat an ihr gewoben und tritt durch sie in uns ein als die unumgängliche Voraussetzung unserer Gegenwart, ja, als ein beständiger Teil davon.“131 Die Sprache schaffe ich als Mensch nicht selbst; sie wird mir geschichtlich vermittelt und verbindet mich deshalb mit der gemeinsamen Geschichte der Menschheit. Deshalb ist sie für Ratzinger „Ausdruck der Kontinuität des menschlichen Geistes in der geschichtlichen Entfaltung seines Wesens.“132
Der einzelne Mensch kann nun nicht einfach unabhängig von dieser geschichtlichen Geistesentwicklung der Menschheit betrachtet werden. Die geschichtliche Verfasstheit gehört für Ratzinger vielmehr untrennbar zum Wesen des Menschen hinzu.133 Deshalb kann man seiner Ansicht nach nicht einfach „ein zeitlos währendes Wesen dem Wechsel und der Zufälligkeit der Geschichte gegenüberstellen, ohne den Menschen von Grund auf misszuverstehen, da doch Geschichte und Wesen bei ihm ineinanderfallen und das eine nur im anderen wirklich ist.“134
Die geschichtliche Prägung des menschlichen Wesens impliziert, dass der Mensch nie in ungeschichtlich gedachter Freiheit beliebig über sein Wesen verfügen kann. „Er ist selbst nur in der Spannung von Vergangenheit über Gegenwart in Zukunft hinein.“135 Zwar kann der Mensch die Geschichte im Rahmen seiner Möglichkeiten beeinflussen und ihr sozusagen seinen persönlichen Stempel aufdrücken, aber er kann sich doch nicht unabhängig von ihr denken, er kann sie „nicht aufsprengen und verlassen in ein vermeintlich reines Wesen hinein, das eine Utopie ist, in der er sich selbst verkennt.“136
In einer scharfen Abgrenzung vom Deutschen Idealismus charakterisiert Ratzinger die dort seiner Auffassung nach versuchte Loslösung des Menschen von seiner Geschichtlichkeit dementsprechend als „die bei Fichte zu ihrer höchsten Übersteigerung gekommene idealistische Verkennung des menschlichen Wesens, so als wäre jeder Mensch ein autonomer Geist, der sich ganz aus eigener Entscheidung auferbaut und ganz das Produkt seiner eigenen Entschlüsse ist – nichts als Wille und Freiheit, die nichts Ungeistiges duldet, sondern sich ganz in sich selbst gestaltet.“137 Diese Auffassung des Menschen als einem von jeglichen geschichtlichen Bindungen losgelösten, also ‚absoluten‘, schöpferischen ICH, läuft für Ratzinger auf die Gleichsetzung des Menschen mit Gott hinaus.138 Durch diese Folgerung, die Ratzinger bei Fichte konsequent vollzogen sieht, widerspricht sich die idealistische Auffassung aber seiner Ansicht nach selbst, denn „der Mensch ist nicht Gott: Um das zu wissen, braucht man im Grunde nur selber ein Mensch zu sein.“139
Ganz im Gegenteil zum idealistischen Denken erfährt man sich laut Ratzinger als Mensch vielmehr jeden Tag aufs Neue als ein „Wesen der Abhängigkeiten … das gar nicht isoliert gedacht werden kann, weil die Abhängigkeit, das Mitsein mit anderen sozusagen in seine Definition hineingehört.“140 Ratzinger weiß in diesem Zusammenhang auch um die häufig zu idealistisch ausgerichtete christliche Metaphysik, die seines Erachtens „längst vor Fichte eine allzu starke Dosis von griechischem Idealismus in sich aufgenommen“141 hatte, sodass sie geschichtliche Aussagen des Glaubens wie Erbsünde und Erlösung aufgrund ihres ungeschichtlichen Denkens nicht mehr erklären konnte.142
Es ist also für Ratzinger gerade nicht so, „dass jeder Mensch vom Nullpunkt seiner Freiheit aus sich ganz neu entwirft, wie es im deutschen Idealismus erschien.“143 Vielmehr ist jeder Mensch „geprägt von einer Gemeinschaft, die ihm Formen des Denkens, des Fühlens, des Handelns vorgibt. Dieses Gefüge von Denk- und Vorstellungsformen, das den Menschen vorprägt, nennen wir Kultur.“144 Zur Kultur gehören neben der Sprache für Ratzinger z.B. auch die jeweilige staatliche Verfassung einer Gesellschaft, das Recht und die moralischen Auffassungen, die Kunst sowie der religiöse Kult.145 All dies bildet seines Erachtens den unhintergehbaren Ausgangspunkt menschlichen Denkens. Die Gegenwart des Menschen ist nicht von seiner Geschichte, den Erfahrungen seiner Vergangenheit, trennbar.
Dies wird auch in Ratzingers Verständnis von ‚Gedächtnis‘ deutlich: „Zeit wird für uns als eine in allem Vergehen zusammenhängende Wirklichkeit nur durch das Gedächtnis wahrnehmbar. Im Gedächtnis ist Vergangenheit als Gegenwart verwahrt. Was überhaupt Gegenwart für uns bedeutet, hängt von unserem Gedächtnis ab“146. So manifestiert sich der Geist des Menschen gerade „in der Überschreitung der Zeit, des Augenblicks: Geist ist grundlegend Gedächtnis – Einheit stiftender Zusammenhang über die Grenze der Augenblicke hinweg.“147