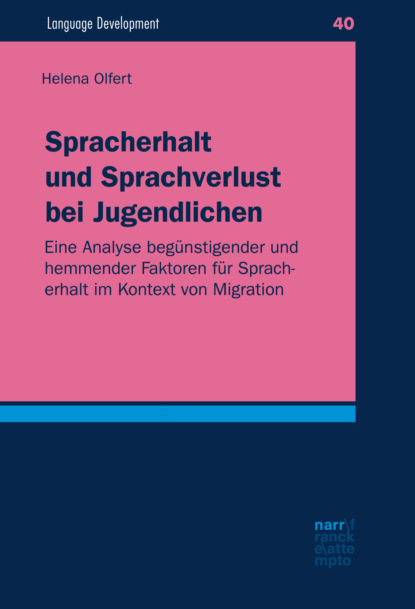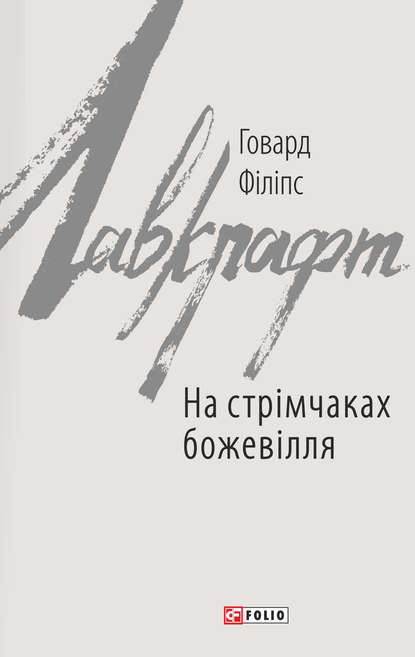- -
- 100%
- +
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem dritten Punkt dieser Liste an Forschungsdesiderata und untersucht, zu welchem Ausmaß unterschiedliche außersprachliche Faktoren den Erhalt bzw. den Verlust der HL beeinflussen können und welche von ihnen dabei den größten Effekt aufweisen.
2.6 Zusammenfassung
Die Frage danach, ob eine Sprache auch nach der Migration in der Familie erhalten bleibt und an folgende Generationen weitergegeben wird, hängt stark mit dem Wert und Prestige zusammen, der ihr gesellschaftlich beigemessen wird. Dieses Sprachprestige ist dabei kein objektiv gesetztes Maß, sondern reflektiert gesellschaftliche Machtverhältnisse und wird durch alle Bildungseinrichtungen hindurch reproduziert. Sprachen in der Peripherie des nationalen Sprachgefüges unterliegen besonders großen Restriktionen bei ihrer Weitergabe an Folgegenerationen, sodass ihre Sprecher einem umso stärkeren Rechtfertigungsdruck im Falle eines Wunsches nach Spracherhalt ausgesetzt sind. Zahlreiche Forschungsbefunde stellen zudem migrationsbedingte Mehrsprachigkeit als einen Sonderfall sprachlicher Sozialisation und als einen Risikofaktor im deutschen Bildungssystem dar. Ursachenforschung zu den festgestellten Disparitäten zeigt jedoch, dass es nicht zwingend die Mehrsprachigkeit an sich ist, die zu Bildungsbenachteiligung führt, sondern daran gekoppelte sozio-strukturelle Merkmale sowie Eigenschaften der Institution Schule selbst. Für den Erhalt der Minderheitensprache existiert wiederum eine Fülle an Argumenten aus unterschiedlichsten Disziplinen. Sie attestieren Mehrsprachigen u.a. kognitive Flexibilität, Vorteile beim Lernen von Fremdsprachen oder emotionale Stabilität. Zugleich deuten viele Studien darauf hin, dass diese Ressource nur von balanciert Mehrsprachigen ausgeschöpft werden kann, was ein weiteres Argument für die Förderung der Minderheitensprache ist. Dass migrationsbedingte Mehrsprachigkeit kein Randphänomen darstellt, verdeutlichen wiederum unterschiedliche Migrationsstatistiken und Spracherhebungen an Grundschulen. Sie zeigen, dass es sich unter den fünf am häufigsten in Deutschland gesprochenen Sprachen um zentrale bis superzentrale Sprachen handelt, die ihre Randomisierung erst in der Migrationssituation erfahren. Ihre Förderung ließe sich nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten rechtfertigen, sondern würde auch Anerkennung für die zahlreichen HL-Sprecher bedeuten. Nicht zuletzt verspricht die Beschäftigung mit HLs zum einen in Bezug auf die Theoriebildung, zum anderen hinsichtlich der unterrichtlichen Praxis zahlreiche Erkenntnisse für die Mehrsprachigkeitsforschung.
3 Forschungsstand zu Heritage-Language-Sprechern
3.1 Der Begriff „Heritage Language“ und seine Abgrenzung von anderen Termini
Der Begriff „Heritage Language“ (HL) ist in der deutschsprachigen Forschungslandschaft nicht weit verbreitet und findet nur begrenzt Anwendung in Studien mit Bezug zum Thema Mehrsprachigkeit. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird im folgenden Kapitel zunächst ausführlich auf seine Herleitung und definitorische Eingrenzung eingegangen. Gleichzeitig erfolgt eine Bestimmung anderer damit konkurrierender Ausdrücke, um die Notwendigkeit eines Rückgriffs ausschließlich auf diesen Terminus in der vorliegenden Studie zu begründen und hierdurch die Zielgruppe der Studie festzulegen und näher zu beschreiben.
3.1.1 Entstehung des Begriffs „Heritage Language“
„Heritage Language“ wurde als feststehender Fachausdruck laut Cummins (vgl. 2005: 585) zum ersten Mal in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit dem Ontario Heritage Languages Program in Kanada verwendet. Das Programm diente der Initiierung und finanziellen Förderung von wöchentlichem HL-Unterricht und wirkte als Vermittler zwischen den einzelnen Communities und der Schule. Der Begriff selbst wurde im Rahmen dieser bildungspolitischen Maßnahme als „languages other than English or French“1 definiert. Diese nicht näher spezifizierte Definition lieferte keine weitere Beschreibung der Sprechermerkmale und fand folglich nur verzögert Eingang in die wissenschaftliche Diskussion. Erst im Laufe des sog. „Heritage Language Movement“ (Peyton et al. 2001: 4) in den 1990er Jahren wurde er in den USA von Pädagogen und Sprachlehrforschern weiter präzisiert.
Diese Bewegung verstand sich als eine bottom-up forcierte Abkehr von der monolingual orientierten Bildungspolitik der USA zu der damaligen Zeit und mündete in zahlreichen, von den Minderheiten selbst organisierten Schulen und Kursen vom Kindergarten bis zur universitären Ausbildung, die stufenweise in dem Bildungssystem verstetigt wurden (vgl. Fishman 2001: 89). Durch diese Entwicklungen fand der Begriff „Heritage Language“ und mit ihm der HL-Sprecher zunächst in den USA, Kanada und Australien immer mehr Beachtung durch die Forschung (vgl. Cho et al. 1997; Kondo 1997; Krashen et al. 1998). Inzwischen erlangten HLs – teilweise unter anderen Bezeichnungen – auch in Europa und in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit seitens der Forschungscommunity (vgl. Anstatt & Dieser 2007; Cantone et al. 2008; Cantone & Olfert 2015; Di Venanzio et al. 2012; Gagarina 2008; Kupisch et al. 2014).
Die in den ersten Publikationen verwendeten Definitionen beschreiben HLs als Minderheitensprachen (LOTEs – languages other than English), die ausschließlich innerhalb der Familie gesprochen sowie nicht schulisch vermittelt werden und zu denen der Sprecher eine persönliche, historisch bedingte Verbindung2 aufweist (vgl. Cho et al. 1997: 106; Krashen 1998: 3; Valdés 2001: 38), sie schließen also autochthone Minderheitensprachen ein. Fishman (2001) unterscheidet in a) indigene HLs von autochthonen Minderheiten in den USA, b) koloniale HLs wie Niederländisch, Schwedisch, Französisch und Deutsch, die bereits vor der Staatsgründung der USA durch erste Siedler eingeführt wurden, sowie c) migrationsbedingte HLs aktueller Einwanderer.
Diese Differenzierung begründet er zum einen mit der für ihren Erhalt verwendeten Rechtfertigungsstrategie, zum anderen mit den geschichtlich gewachsenen Gruppenmerkmalen, die sich auf die Weitergabe der HLs auswirken. So sei die Bewahrung indigener, autochthoner HLs nicht zuletzt von der Mehrheitsbevölkerung selbst erwünscht. Zurückzuführen sei dieser Wunsch auf den Ursprung indigener Bevölkerungsgruppen auf dem Territorium der USA, ihr Vorrecht darauf und auf eine ihnen gegenüber empfundene Kollektivschuld wegen der Zerstörung ihres kulturellen Erbes (vgl. ebd.: 83). Ähnliches lässt sich für den deutschen Kontext beschreiben, wo die autochthonen Minderheitensprachen Dänisch, Sorbisch und Friesisch als zu Deutschland zugehörig empfunden und durch die ECRM (vgl. Europarat 1992) offiziell geschützt werden. Ihr Erhalt wird in Deutschland auch durch die Mehrheitsgesellschaft stark begrüßt und gefordert (vgl. Gärtig et al. 2010: 227).3
Bei den im 17. Jahrhundert in den USA noch lebendigen kolonialen HLs fand laut Fishman kaum intergenerationale Sprachweitergabe statt, sodass die Nachkommen dieser ersten Einwanderer zum größten Teil inzwischen monolingual Englischsprachige sind (vgl. Fishman 2001: 84). Eine Ausnahme stelle das Deutsche dar, das in Form von Pennsylvania und Texas German aufgrund der Gruppengröße, des internationalen Kommunikationswerts der Sprache sowie der kulturellen und religiösen Abschottung seiner Sprecher bis in die heutige Zeit Bestand habe (ebd.). Neuere Studien zeigen indes, dass mit der voranschreitenden Öffnung beider Communities diese Sprachvarietäten ebenfalls nur noch von der älteren Generation gesprochen werden (vgl. Boas 2005: 82), sodass selbst in diesem Kontext Sprachverlust immer wahrscheinlicher wird. Eine vergleichbare sprachliche Konstellation ist im deutschen Kontext nicht gegeben.
Migrationsbedingte HLs hingegen verfügen über kein gesellschaftlich legitimes Argument, das ihren Erhalt rechtfertigen würde, und weisen gleichzeitig hinsichtlich der Gruppenmerkmale schlechtere Ausgangsbedingungen als die beiden erstgenannten Typen von HLs auf, weshalb ihre Förderung einer speziellen Beachtung bedarf. Obwohl Studien zu Spracherhalt aller drei genannten Gruppen vorliegen, befasst sich die heutige Forschung zu HLs primär mit dieser von Fishman hervorgehobenen dritten Gruppe, also mit allochthonen Minderheiten, deren Einwanderung zwei bis drei Generationen zurückreicht.4 Der Begriff „Heritage Language“ konnotiert heutzutage dementsprechend eine migrationsbedingte Mehrsprachigkeit. Diese Unterscheidung in allochthon und autochthon wird in Deutschland bei der Beschäftigung mit Minderheitensprachen ebenso grundsätzlich aufrechterhalten (vgl. De Bot & Gorter 2005: 612).
Der Terminus „Heritage Language“ wird jedoch von einigen Forschern auch kritisch betrachtet. Das Missliche an ihm sei die damit einhergehende Betonung der Vergangenheit, des sprachlichen „Erbes“ der Sprecher (vgl. Fishman 1991: 362). Dieser Fokus auf die geschichtliche, intergenerationale Herleitung einer HL versperre den Blick in die Zukunft und impliziere, dass sie keine vielversprechende Perspektive aufweise und eher auf Traditionen gründe denn auf der zeitgenössischen Beschäftigung mit Sprachen (vgl. Baker & Jones 1998: 509). Dieser Kritik ist grundsätzlich zuzustimmen, denn ein Erbe ist in der Tat ein Vermächtnis, das nicht selbst erarbeitet oder angeeignet, sondern von vorherigen Generationen in der Vergangenheit verfestigt und an eine Person übergeben wurde.
Dennoch stellt der Begriff „Heritage“ eine treffende Bezeichnung für Sprachen in dem geschilderten Zusammenhang dar, denn ein Erbe kann durchaus eine einträgliche Investition in die Zukunft bilden und einen Besitz, den man erhalten, ausbauen und an nachfolgende Generationen weitergeben möchte. Gleichzeitig lässt sich ein Erbe ausschlagen, sodass der Sprecher nicht gezwungen ist, die sprachliche Hinterlassenschaft seiner Vorfahren weiterhin mitzutragen. Als Gegenvorschlag lässt sich von denselben Autoren der Begriff „internationale Sprache“ finden, „[…] to give the impression of a modern, international language that is of value in a technological society“ (Baker & Jones 1998: 509). Jedoch ist diese Definition wiederum zu eng gefasst und lässt sich beispielsweise nicht auf diatopische Varietäten, Sprachen ohne schriftsprachlichen Ausbau oder regionale Minderheitensprachen anwenden. Hier bietet hingegen der Terminus „Heritage Language“ durchaus das nötige Fassungsvermögen, um all die erwähnten Kontexte abzudecken.
3.1.2 „Heritage Language“ im Vergleich zu anderen Bezeichnungen
Parallel zu dem Ausdruck „Heritage Language“ werden in der angloamerikanischen Forschungsliteratur mehrere andere Fachbegriffe verwendet, die sich zwar (meist) auf dieselbe Sprechergruppe beziehen, aber stets einen anderen Fokus aufweisen. Beispielsweise entwickelte sich ebenfalls in den 1970er Jahren in Australien der Fachausdruck „Community Language“. Dieser ist bis heute im australischen Kontext vorherrschend1 und bezeichnet gleichermaßen „languages other than English and Aboriginal languages“ (Clyne 1991: 3). Er unterstreicht die enorme Bedeutung der Community für die Vitalität und den Erhalt dieser Sprachen. Wie es sich zur gleichen Zeit in Kanada und in den USA zeigte, wurde die HL-Bewegung von den Sprechern, die den Erhalt ihrer Sprachen durch Lernangebote sicherstellen wollten, selbst initiiert (vgl. Fishman 2001: 87f.). Diese Verankerung der Sprache im Privaten bzw. in der Gemeinde wird durch den Ausdruck „Community Language“ aufgegriffen. Im Gegensatz hierzu bezieht sich der Begriff „Heritage Language“ ausdrücklich auf das Individuum und seine persönliche, geschichtlich hergeleitete Verbindung zu einer bestimmten Sprache.
Im Verlauf der letzten 50 Jahre war zudem ein steter Gebrauch des Terminus „Home Language“ zu verzeichnen. Dieser wurde zunächst in psychologischen, pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Studien wegen seiner Alltagsnähe und Zugänglichkeit meist ohne weitere Spezifizierung ebenfalls für allochthone wie autochthone Minderheitensprachen verwendet (vgl. bspw. Clyne & Kipp 1997; Scheele et al. 2010; Quiroz et al. 2010). In den letzten 15 Jahren findet er auch vermehrt Eingang in linguistische Studien, insbesondere wenn der Fokus dieser auf früher Mehrsprachigkeit oder familiärer Sprachpolitik liegt.2 Er soll dabei den Blick auf solche Sprachen lenken, die ausschließlich innerhalb der Familie erworben und gesprochen werden, und legt den Schwerpunkt auf die Erwerbsperiode vor dem Eintritt in eine Bildungsinstitution: „[…] we use the term home language as the language acquired by the child through immersion at home, usually the language the child knows best before going through child care or school“ (vgl. Eisenchlas et al. 2013: 2, Hervorhebung i.O.).
Zusätzlich zur Einschränkung bezüglich des betrachteten Zeitpunkts unterscheidet sich „Home Language“ von dem Begriff „Heritage Language“ durch eine ausformulierte Erwartung an die Kompetenz des Sprechers. Während der Terminus „Heritage Language“ keinerlei Aussagen über die Kenntnisse einer Sprache macht und sich sowohl auf balanciert Mehrsprachige als auch auf passive Sprecher beziehen kann, beschreibt der Ausdruck „Home Language“ eine Dominanz in der jeweiligen Minderheitensprache. Gleichzeitig betont er die entscheidende Rolle der Bildungsinstitutionen, in denen die Mehrheitssprache vermittelt wird, denn diese haben in vielerlei Fällen eine Umkehr der Sprachdominanz eines Kindes zur Folge.
Andere Begriffe, die im gleichen geographischen Raum bisher für diese Sprechergruppe verwendet wurden, sind beispielsweise „semi-speakers“ (Dorian 1981), „quasi-native speakers“ (He 2010) oder „incomplete acquirers“ (Montrul 2002). Diese Beispiele könnten mit weiteren, ähnlichen Ausdrücken fortgesetzt werden. Sie fokussieren jedoch eine Nicht-Kompetenz und formulieren eine Abgrenzung zu den Sprachkenntnissen Monolingualer, die erkennbar die Zielfolie darstellen. Hierdurch spiegeln sie die offenbar nach wie vor bestehende und bereits von Grosjean (1989) kritisierte Vorstellung von Bilingualen als der Entsprechung von zwei Monolingualen wider und sind deshalb abzulehnen.
In Deutschland wird „Heritage Language“ oftmals mit „Herkunftssprache“ übersetzt und gleichgesetzt (vgl. Brehmer & Mehlhorn 2015a: 3). Dies ist gleichwohl zu hinterfragen, da der Begriff „Herkunftssprache“ die im Herkunftsland gesprochene Varietät bezeichnet (vgl. Lüttenberg 2010: 306), und gerade diese ist es nicht, die die Sprecher im Einwanderungsland sprechen oder ungesteuert erwerben (vgl. Schroeder 2003: 32f.). So beschreibt Schroeder beispielsweise das in Deutschland gesprochene Türkisch als eine in der Diaspora neu entstandene Varietät. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass Merkmale des gesprochenen Türkisch und der Kontaktsprache Deutsch grammatikalisiert werden, ein Abbau von Dialektunterschieden stattfindet, dass also Besonderheiten anatolischer Dialekte erster Einwanderer von anderen Sprechern übernommen werden, und dass sprachliche Anpassungen erfolgen, die die Integration von deutschen Lexemen in das Türkische erleichtern (vgl. ebd.). Diese Neuerungen entstehen hingegen nicht im Türkei-Türkischen, das als Standardvarietät – als Herkunftssprache – weiterhin primär im herkunftssprachlichen Unterricht vermittelt wird. Hier ist folglich ebenfalls ein deutlicher Unterschied zum Terminus „Heritage Language“ zu verzeichnen, der sich auf keine bestimmte Varietät bezieht, sondern diejenige Sprache bezeichnet, zu der der Sprecher eine persönliche, familiär bedingte Beziehung aufweist (vgl. Lo Bianco & Peyton 2013: i), sei es ein Dialekt, eine regionale Minderheitensprache oder die offizielle Amtssprache eines Landes.3
Im europäischen – und speziell im deutschen – Kontext existiert zwar bislang keine Forschung explizit unter dem Schlagwort „Heritage Languages“ (vgl. Kupisch 2013: 206), jedoch ist das Thema Erhalt von allochthonen Minderheitensprachen seit den 80er Jahren intensiv unter den Begriffen „simultane“ und „sukzessive Mehrsprachigkeit“ erforscht worden (vgl. Cantone et al. 2008; De Houwer 1990; Eichler et al. 2013; Meisel 1989; 2001; Müller et al. 2002). Die meisten dieser Studien betrachten das Aufwachsen mehrsprachiger Kinder unter der OPOL-Strategie (One Person – One Language; vgl. Romaine 1995) im Alter von ca. zwei bis fünf Jahren und beschäftigen sich mit den Aspekten Alter bei Erwerbsbeginn und Sprachdominanz. Selbstverständlich schließt der Begriff „Heritage Languages“ auch die in diesen Studien betrachteten Minderheitensprachen ein. Die Erforschung von HLs findet in Deutschland also zu einem großen Teil unter einer anderen Bezeichnung statt und ist stark auf einen bestimmten Altersausschnitt der kindlichen Mehrsprachigkeit fokussiert.
Vor allem in soziologischen und sozio-linguistischen Studien wird zur Beschreibung des HL-Kontextes der Ausdruck „Minderheitensprache“ bzw. seine englische Entsprechung „minority language“ verwendet. Dieser ist entgegen der vorgebrachten Kritik (vgl. Wiley 2001: 34) ein neutraler Begriff, der nicht die betrachteten Sprachen in Bezug auf ihren Wert einordnet (im Sinne von minderem oder höherem Wert). Er legt vielmehr den Fokus auf den Aspekt der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und auf die Grenzziehung zwischen Minderheit und Mehrheit (vgl. Montrul 2013: 169). Mehrheit wird hierbei nicht durch zahlenmäßige Überlegenheit bestimmt, sondern durch politische und gesellschaftliche Dominanz einer Gruppe, durch Zugangsmöglichkeiten dieser zu Bildung und anderen sozio-kulturellen Ressourcen sowie durch die Vormachtstellung ihrer Mitglieder in höheren gesellschaftlichen Schichten (vgl. Brizić 2007: 66). In Bezug auf Sprache hieße dies, dass diejenige Sprache, die in einem Staat das größte Prestige aufweist und deren Beherrschung in ökonomisches und kulturelles Kapital übersetzt werden kann, als Mehrheitssprache definiert werden kann. Alle in Deutschland gesprochenen HLs sind demzufolge auch als Minderheitensprachen zu betrachten, da sie nicht über denselben Stellenwert wie die Mehrheitssprache Deutsch verfügen (s. Abschnitt 2.1).
3.1.3 Arbeitsdefinition des Begriffs „Heritage Language“
In der hier vorliegenden Studie wird in Ermangelung eines entsprechend etablierten deutschsprachigen Ausdrucks1 der Begriff „Heritage Language“ verwendet. Dabei werden die anfangs zitierten Definitionen jedoch nicht uneingeschränkt übernommen, sondern ausschließlich mit Blick auf allochthone Minderheitensprachen. Diese Spezifizierung erfolgt aufgrund der bereits erwähnten Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen in Bezug auf ihren rechtlichen Status, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung und das damit verbundene Sprachprestige, ihren Zugang zu Institutionen schulischer Bildung und Unterricht sowie die identitätsbezogene Selbstzuordnung ihrer Sprecher. Zur Abgrenzung des Arbeitsgegenstandes dieser Studie sei eine HL dementsprechend eine allochthone Minderheitensprache, die im Vergleich zur Mehrheitssprache im Einwanderungsland über kein bis wenig Prestige verfügt, keine bis wenig gesellschaftlich-institutionelle Unterstützung erfährt und die aufgrund einer familiären Migrationshistorie intergenerational im Sinne eines sprachlichen Erbes weitergegeben wird (vgl. Benmamoun et al. 2010: 8; Polinsky & Kagan 2007: 369). Obwohl die Begriffe „Community Language“, „Home Language“ und „Herkunftssprache“ ebenfalls auf dieselbe sprachliche Konstellation verweisen wie „Heritage Language“, erweisen sie sich als weniger geeignet, da mit ihnen das Augenmerk auf andere Aspekte gelegt wird als in der vorliegenden Studie, d.h. auf die Rolle der Gemeinde für den Erhalt der Minderheitensprache, auf die innerfamiliäre Sprachpolitik und die frühe Phase des mehrsprachigen Spracherwerbs bzw. auf die im Herkunftsland gesprochene Varietät ohne Sprachkontakteinflüsse.
3.2 Charakteristika des Heritage-Language-Sprechers
Gemäß den oben skizzierten Kriterien einer HL bezeichnet der Begriff „HL-Sprecher“ folglich Mehrsprachige, die von früher Kindheit an im Elternhaus simultan zur Mehrheitssprache oder sukzessiv vor der Mehrheitssprache eine HL erwarben. Diese mehrsprachige Konstellation ist von einigen spezifischen Merkmalen gekennzeichnet, die sich als typische Charakteristika des HL-Erwerbs aus den bisherigen Forschungsergebnissen extrahieren lassen und ihn sowohl von monolingualem Erwerb als auch von anderen Typen der Mehrsprachigkeit unterscheiden. Sie werden zur Bestimmung der Stichprobe in dieser Arbeit herangezogen (vgl. Polinsky 2015a: 9).
3.2.1 Spezifische Bedingungen des Heritage-Language-Erwerbs
(1) Der Erwerb findet unter anderen Bedingungen statt als bei einem monolingualen Kind. Im Elternhaus ist der HL-Sprecher mit einer allochthonen Minderheitensprache in Kontakt gekommen, die im Einwanderungsland nicht von der Mehrheitsgesellschaft gesprochen, für gewöhnlich nicht in Bildungsinstitutionen gelehrt wird und nur über wenig gesellschaftliches Prestige verfügt. Der Spracherwerb geschieht also von Anfang an in einer Sprachkontaktsituation als Aushandlung zwischen Mehrheits- und Minderheitensprache (vgl. Pauwels 2004: 719f.). Der Input in der HL erfolgt dabei durch bilinguale Personen, die zwar in der Minderheitensprache stark dominant sein können, aber auch zumindest über geringe Kenntnisse in der Mehrheitssprache verfügen, sodass sich bei HL-Sprechern vom Erwerb einer Kontaktvarietät sprechen lässt (vgl. ebd.; Montrul 2016: 24; Schroeder 2003: 33). Dieser Aspekt wird bei frühem Einreisealter und mit zunehmender Aufenthaltsdauer der Eltern von HL-Sprechern im Einwanderungsland prominenter.
(2) Der Spracherwerb wie der Sprachgebrauch des HL-Sprechers sind affektiven Einflüssen unterworfen. Da die Familie die vorrangige Domäne der HL bildet, ist sie nicht nur der Ort des Spracherwerbs, sondern hier werden für den HL-Sprecher gleichsam emotionale Bezüge zu der Sprache als familiär „ererbte“ Sprache hergestellt. Polinsky (2015a: 7) spricht gar davon, dass der HL-Sprecher sich in erster Linie über eine affektive oder kulturelle Verbindung zu der Minderheitensprache auszeichnet, seine Sprachkompetenz indes stärker in der Mehrheitssprache ausgeprägt ist. Spätestens ab dem Schuleintritt findet eine erste emotionale Auseinandersetzung mit der HL statt, da hier dem HL-Sprecher bewusst wird, dass er sich von der Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf seine HL-Kenntnisse unterscheidet und zu einer sprachlichen Minderheit gehört (vgl. Polinsky 2015a: 9). Eine vertiefte Verarbeitung dieses „sprachlichen Erbes“ erfolgt häufig in der Pubertät, da zu diesem Zeitpunkt ohnehin identitätsbezogene Aspekte hinterfragt werden (vgl. Tse 2000: 188f.). Sie kann sowohl in eine verstärkte Beschäftigung mit der HL-Kultur und -Sprache als Erwachsener münden, als auch in einer kompletten Ablehnung dieser resultieren (vgl. Montrul 2016: 121). Negative Gefühle in Verbindung mit der HL erfahren HL-Sprecher ferner, wenn sie von anderen, kompetenteren Sprechern für ihre Kenntnisse verurteilt werden, falls sie nicht der im Herkunftsland gesprochenen Norm entsprechen und als defizitär angesehen werden. Dieses Phänomen wird in der HL-Forschung unter der Bezeichnung „Sprachscham“ (vgl. ebd.) untersucht.
(3) Die Sprachdominanz eines HL-Sprechers kann sich im Laufe seines Lebens ändern. Während der Kindheit ist die HL häufig seine dominante, also die weiter entwickelte Sprache (vgl. Müller et al. 2011: 65), was sich hingegen mit dem Eintritt in die Schule ändert. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird die Umgebungssprache stark dominant, da in ihr die gesamte institutionelle Kommunikation verläuft (vgl. Montrul 2016: 42). Die Alphabetisierung eines HL-Sprechers erfolgt ebenfalls ausschließlich oder vorwiegend in der Mehrheitssprache, was diese zusätzlich relativ zur Minderheitensprache stärkt (vgl. Polinsky 2015a: 12). Als Jugendliche oder Erwachsene wenden sich HL-Sprecher nicht selten wieder der HL zu und verspüren den Wunsch, ihre Kenntnisse weiter auszubauen und zu verfestigen.
(4) Der Gebrauch einer HL ist nicht in allen Domänen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zulässig, sodass die Familie nicht nur die primäre sprachliche Sozialisationsinstanz, sondern auch den vorwiegenden Kontext des HL-Gebrauchs darstellt. Dies hat zur Folge, dass der HL-Sprecher in erster Linie orate Strukturen, die für dieses intime Register1 bezeichnend sind, erwirbt (vgl. Maas 2008: 111; 2009: 146). Für das formelle Register sind sie nicht lizensiert. Soll ein Ausbau literater Strukturen stattfinden, so kann dieser nur durch Kontakt mit Sprechern außerhalb des intimen Registers oder in Bildungsinstitutionen geschehen (vgl. Schroeder & Şimşek 2010: 57). Wie bereits erwähnt, finden HLs jedoch nur ansatzweise Eingang in schulische Curricula. Das Ausmaß des Kontaktes zur HL außerhalb der Familie kann zudem von Sprecher zu Sprecher variieren und bedingt durch äußere Kontextmerkmale einer bestimmten Einwanderergruppe stark eingeschränkt sein, sodass die Familie oftmals die einzige Inputquelle und die alleinige Möglichkeit zum Sprachgebrauch bietet. Diese Tatsache fällt umso mehr ins Gewicht, je kleiner die betreffende Sprachcommunity ist, sowie bei Sprachen ohne schriftsprachlichen Ausbau. Für die Letztgenannten existiert meist keine angemessene Möglichkeit, andere Register zu erwerben, da sie an streng ritualisierte Handlungen und Sprachmuster geknüpft sind (vgl. Palmer 1997), die in der Migration nicht ohne Weiteres hergestellt werden können.