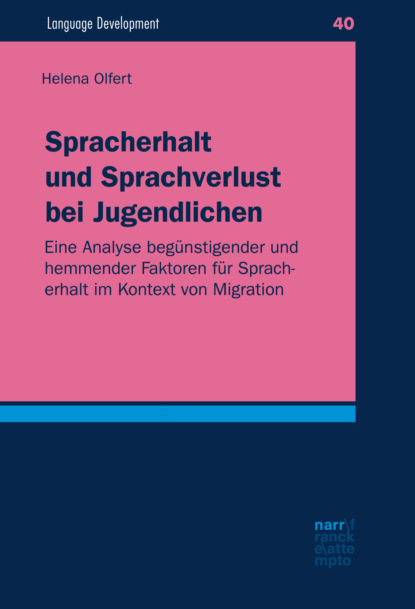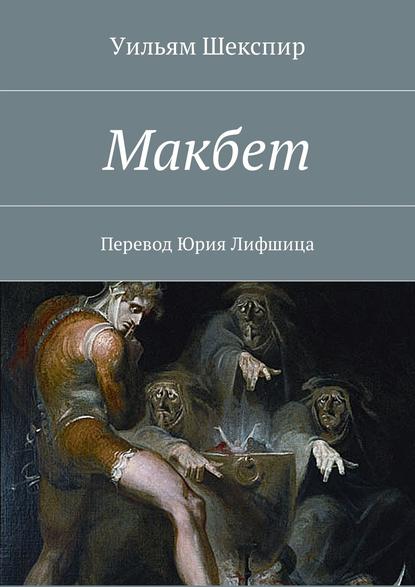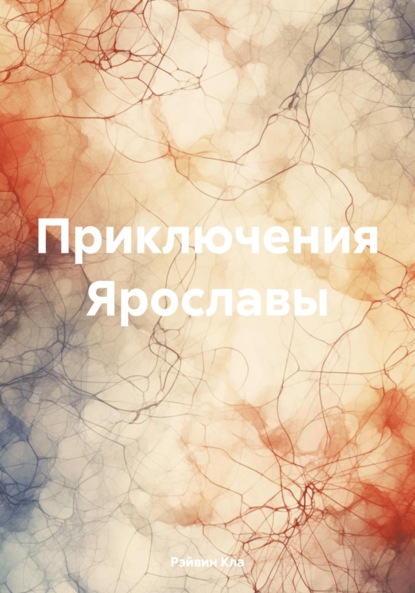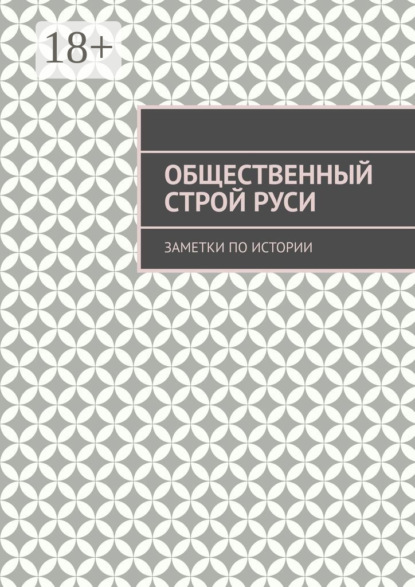- -
- 100%
- +
(5) Zusätzlich zu den oben angeführten Merkmalen des Spracherwerbs und Sprachgebrauchs von HL-Sprechern wird in der HL-Literatur als weiteres für diese Studie zentrales Unterscheidungsmerkmal das Kriterium der Generation zu seiner Abgrenzung von anderen Typen des mehrsprachigen Erwerbs hinzugezogen. So bezieht sich der Begriff „HL-Sprecher“ vorwiegend auf Personen der zweiten Einwanderergeneration. Ein Grund hierfür ist in den typischen Sprachdominanzverläufen in der Minderheiten- und Mehrheitssprache entlang den Generationenlinien zu finden und wurde bereits vor 50 Jahren in der Soziolinguistik als Drei-Generationen-Modell der Sprachaufgabe beschrieben (vgl. Fishman 1991: 88ff.). Für die HL-Forschung erlangt es jedoch mit der Betrachtung der zweiten Generation eine neue Bedeutung und unterstreicht abermals ihre Relevanz für den Prozess des Spracherhalts im Migrationskontext, da hier entscheidende Weichen gestellt werden, die die Weitergabe einer HL an die nachfolgende Generation entweder ermöglichen oder aber versperren (vgl. ebd.):
Generation Kenntnisse in der Mehrheitssprache Kenntnisse in der Minderheitensprache erste eingeschränkt dominant zweite dominant eingeschränkt dritte monolingual nicht vorhandenTab. 3:
Formen der Sprachdominanz in der Mehrheits- und Minderheitensprache nach Generationenzugehörigkeit (Darstellung nach Montrul 2016: 24)
Die einzelnen Generationen können wie folgt beschrieben werden: Die erste Generation ist selbst zugewandert. Häufig wurden diese Sprecher in der Minderheitensprache vollständig sozialisiert und beschult, insbesondere wenn die Einwanderung im Erwachsenenalter erfolgte. Die Kenntnisse in der Mehrheitssprache des Einwanderungslandes sind bei dieser Generation nur eingeschränkt vorhanden und richten sich stark nach den alltäglichen und beruflichen Bedürfnissen der Sprecher. Dieses Dominanzverhältnis kehrt sich in der zweiten Generation, also bei den HL-Sprechern in der vorliegenden Studie, um. Ihre dominante Sprache ist die Mehrheitssprache. Die Minderheitensprache bzw. eine gewisse Kompetenz in dieser bleibt als HL erhalten, obwohl meist nicht derselbe Grad an Flüssigkeit wie bei den Eltern erreicht wird (vgl. Polinsky 2015a: 7).
Der Kompetenzaspekt ist an dieser Stelle insofern von kritischer Bedeutung, als er über die (Nicht-) Weitergabe der HL an die dritte Generation entscheidet, die infolgedessen monolingual in der Mehrheitssprache sozialisiert wird: „[…] heritage languages often do not survive intergenerational transmission“ (Montrul 2011a: 158). Hierbei spielt nicht primär der erreichte und messbare Kompetenzgrad im Vergleich zur monolingualen Norm eine Rolle, sondern vielmehr die subjektive Einschätzung des Sprechers selbst. Sie bestimmt darüber, ob ein Sprecher sich in seiner HL kompetent genug fühlt, um sie an seine Kinder weiterzugeben.
Der auch in der vorliegenden Studie vorgenommene Rückgriff auf die zweite Einwanderergeneration eines Sprechers umschreibt demzufolge nicht ausschließlich familiär bedingte sprachbiographische Gegebenheiten, sondern reflektiert ebenso relative Spracherwerbs- und -dominanzverhältnisse und ist für die definitorische Abgrenzung eines HL-Sprechers unerlässlich: „[…] second generation bilinguals, who were born to families speaking a language different from that of the environment, are heritage speakers“ (Schmid 2011: 73f.; Hervorhebung i.O.). Der Terminus „HL-Sprecher“ lässt sich bei entsprechender Spracherwerbsbiographie und bei ähnlich gelagerten Sprachdominanzrelationen auch auf die dritte oder weitere Generation ausweiten, was insbesondere für die größeren Einwanderersprachgruppen nicht unwahrscheinlich ist. Er kann sich wiederum nur dann auf die erste Generation beziehen, wenn die Einwanderung in einem frühen Alter erfolgte. In diesem Fall zählen Benmamoun und Kollegen zusätzlich diejenigen Personen zur Gruppe der HL-Sprecher, die vor dem Alter von 8 Jahren eingewandert sind (vgl. Benmamoun et al. 2012: 9).
Diese willkürlich gesetzte Grenze wird in der hier durchgeführten Studie jedoch nicht übernommen (s. Abschnitt 6.3). Stattdessen soll in dieser Arbeit die Zuwanderung vor Schuleintritt über die Eingruppierung als HL-Sprecher entscheiden, denn durch den Eintritt in eine Bildungsinstitution erfolgt ein entscheidender Wendepunkt im HL-Erwerb, der sich stark auf die Sprachkompetenz der Sprecher auswirkt. Der typische HL-Sprecher ist demzufolge entweder selbst vor dem Schuleintritt mit seiner Familie eingewandert oder er ist im Einwanderungsland geboren und das Kind von Migranten. Entsprechend werden in der vorliegenden Arbeit die Teilnehmer primär durch ihre generationale Zuordnung nach diesem Kriterium eingegrenzt, aus dem sich anschließend die in (1) bis (4) diskutierten Merkmale des HL-Erwerbs ergeben.
3.2.2 Die Bedeutung der Sprachkompetenz für die Heritage-Language-Definition
Aktuell verwendete Definitionen von HL-Sprechern arbeiten meist ebenfalls mit den in (1) bis (5) beschriebenen Kontextfaktoren und formulieren bewusst keine Ansprüche an die Sprachkompetenz in der HL: „It is the historical and personal connection to the language that is salient and not the actual proficiency of individual speakers“ (Valdés 2001: 38). Weiteren Versuchen, eine Abgrenzung des HL-Sprechers von anderen Formen der Mehrsprachigkeit vorzunehmen, ist grundsätzlich diese Abkehr von einer Kompetenzmessung gemeinsam (vgl. Benmamoun et al. 2010; Polinsky & Kagan 2007; Valdés 2000). Dabei lässt sich eine enorme Spannweite in der Sprachkompetenz dieser Sprecher feststellen, obwohl sich für alle HL-Sprecher die oben unter (1) bis (5) diskutierten Kontextfaktoren des Spracherwerbs, Sprachgebrauchs und der Sprachdominanz ähnlich ausgestalten. Es werden sowohl Sprecher, die über rein passive Sprachkenntnisse in der HL verfügen und alltägliche Gespräche im intimen Register verstehen können, als auch jene, die eine ausgebaute Kompetenz in der HL aufweisen und in der Lage sind, sprachliche Handlungen im formellen Register gleichermaßen adäquat durchzuführen, als HL-Sprecher bezeichnet. Auch dieser Aspekt soll in die Eingrenzung des Samplings Eingang finden, indem die soziolinguistischen Merkmale zu einer Bestimmung als HL-Sprecher herangezogen werden und Kompetenzmessungen in der HL als nicht relevant betrachtet werden.
Solch eine soziolinguistisch orientierte Definition (vgl. Meisel 2013: 226), die nicht allein die Sprachkompetenz eines Individuums ins Zentrum rückt, sondern auch andere, sprachbiographische wie sozio-emotionale Faktoren berücksichtigt, steht im Einklang mit Forderungen der Erziehungswissenschaften nach einem erweiterten Konzept von „Muttersprache“ und vermag es, sich eines Linguizismusvorwurfs zu erwehren (vgl. Skutnabb-Kangas 1988: 16f.). So argumentiert beispielsweise Skutnabb-Kangas (ebd.), dass zusätzlich zur Kompetenz in der HL die Faktoren „Herkunft“, „Funktion“ und „Identität“ in die Definition einbezogen werden müssen. Während eine Eingruppierung mittels Sprachkompetenz oftmals ausschließlich die Qualität von Kenntnissen in Relation zu einer monolingualen Norm reflektiert, bezieht sich der Faktor „Herkunft“ auf die zuerst erworbene Sprache, „Funktion“ auf die am häufigsten verwendete Sprache und „Identität“ auf a) die Sprache, mit der sich der Sprecher selbst am stärksten identifiziert, sowie b) die Sprache, mit der der Sprecher von anderen assoziiert wird.
Im Gegensatz zu anderen Termini für Sprechertypen, die Sprachkompetenzbeschreibungen implizieren wie „Muttersprachler“ oder „Fremdsprachenlerner“, kann bei HL-Sprechern die Sprachkompetenz also keine zuverlässige Definitionsbasis darstellen, da durch die institutionellen Vorgaben die Mehrheitssprache gesellschaftlich stark dominiert und hierdurch gleichzeitig die Kompetenz in dieser intensiviert wird. Minderheitensprachen hingegen erhalten weitaus weniger Raum in der Gesellschaft und werden oft nicht gelehrt. „Use of this definition [i. e. competence, H. O.] fails to consider that a poor proficiency in the original mother tongue is a result of not having been offered the opportunity to use and learn the original mother tongue well enough in those institutional settings where the children spent most of their day“ (Skutnabb-Kangas 1988: 17). Dementsprechend werden in der vorliegenden Untersuchung alle Sprecher, auf die die Kriterien (1) bis (5) zutreffen und die über ein gewisses Maß an Kompetenz in ihrer HL verfügen, als HL-Sprecher betrachtet. Das Spektrum der Sprachkompetenz soll dabei sowohl Sprecher mit rein passiven Kenntnissen als auch balanciert Mehrsprachige einschließen.
3.3 Varianz in der Sprachkompetenz von Heritage-Language-Sprechern
Trotz mehrerer Gemeinsamkeiten in Bezug auf Merkmale der Sprachbiographie, des Sprachgebrauchs sowie der sozio-emotionalen Ebene, die für alle HL-Sprecher gleichermaßen gelten, resultiert der Spracherwerb von HL-Sprechern in einer enormen Varianz an HL-Kompetenz: „Those who exhibit most variability in bilingual ability are the second generation“ (Montrul 2011a: 157). Gründe hierfür liegen sowohl in dem Spracherwerbsverlauf des HL-Sprechers per se, der sich durch diesem Mehrsprachigkeitstypus inhärente Prozesse kennzeichnet, als auch in den außersprachlichen Kontextfaktoren, die für den HL-Erwerb hoch relevant sind und diesen begünstigen oder behindern können. Die Linguistik bringt jedoch die Varianz in der Sprachkompetenz des HL-Sprechers primär mit drei Phänomenen in Zusammenhang: Attrition und unvollständiger bzw. divergenter Erwerb. Im Gegensatz zu den letztgenannten Erwerbsausprägungen befassen sich zwar Studien zu Attrition mit Migranten der ersten Einwanderergeneration, die sich durch einen anderen Spracherwerbsverlauf als der HL-Sprecher auszeichnen. Dennoch lassen sich sowohl die Ursachen von Attrition als auch ihre Erscheinungsformen sehr gut auf HL-Sprecher übertragen, sodass hier eine theoriegeleitete Anlehnung an Attritionsforschung, wie auch Schmid und Köpke sie fordern, begründet erscheint: „Treating heritage language development and L1 attrition as different developmental contexts carves up a continuous spectrum of L1 development into artificially distinct categories“ (Schmid & Köpke 2017: 658). Dieser Punkt soll im Folgenden näher erläutert werden.
3.3.1 Perspektiven der Attritionsforschung auf Sprachverlust
Im Gegensatz zu Prozessen wie Sprachtod und -wechsel, die sich auf ganze Sprachgemeinschaften beziehen, werden unter dem Begriff „Attrition“ individuelle Verläufe verstanden, die nur Einzelpersonen betreffen (vgl. Montrul 2008: 21). „Attrition“ beschreibt hierbei einen graduellen Verlust bestimmter sprachlicher Strukturen durch ein Individuum: „loss of (or inability to produce) some L1 elements due to L2 influence“ (Pavlenko 2003: 34; vgl. auch Montrul 2008: 64). Es wird unterschieden in natürliche Attritionsprozesse wie L1-Verlust in einer L2-Umgebung (vgl. Köpke et al. 2007; Schmid et al. 2004; Seliger & Vago 1991) sowie L2-Verlust in einer L1-Umgebung (vgl. De Bot & Weltens 1995; Olshtain 1989) im Gegensatz zu krankheitsbedingtem pathologischem Verlust sprachlicher Strukturen bei Aphasie o.ä. (vgl. Gitterman et al. 2012; Paradis 2000; 2004), wobei der erstgenannte Fall durch die Forschung die meiste Aufmerksamkeit erfuhr. Dieser Typ der Attrition wird im Zusammenhang mit der ersten Migrantengeneration untersucht, bei der von einem sukzessiven Verlustprozess von L1-Strukturen in einer L2-Umgebung ausgegangen wird, nachdem diese zuvor in einem L1-Kontext vollständig erworben wurden.
Attrition der L1 wird allem voran durch die neurolinguistisch angelegte Aktivierungsschwellen-Hypothese (Activation Threshold Hypothesis, vgl. Paradis 1993; 2004) erklärt. Sie besagt, dass ein Element nur dann aktiviert wird, die entsprechende Schwelle für seine Verwendung also nur dann überschritten wird, wenn dafür genügend positive Evidenz im Input vorhanden ist (vgl. Paradis 2004: 28). Der Begriff „Element“ kann sich dabei sowohl auf eine konkrete sprachliche Form als auch auf eine Regel beziehen. Diese Aktivierungsschwelle für ein Element wird weiter herabgesenkt, je häufiger es aktiviert wird. Sie liegt entsprechend höher, falls das Element keine Stimulation im Input erhält: „In a nutshell, attrition is the result of long-term lack of stimulation“ (Paradis 2007: 125). Auf einen mehrsprachigen Kontext übertragen bedeutet dies, dass bei frequentem Gebrauch der L2 die Aktivierungsschwelle für die L1 weiter ansteigt und diese dadurch schwieriger zugänglich ist. Bei erschwertem Zugang zu bestimmten L1-Strukturen wächst die Wahrscheinlichkeit für den Einfluss entsprechender Strukturen aus der L2, die für den Sprecher inzwischen schneller und leichter verfügbar sind (vgl. Gürel 2007: 104). Hierdurch werden Strukturen produziert, die in der L1-Umgebung nicht auftreten.
Laut der Aktivierungsschwellen-Hypothese sind es die nicht frequenten, komplexen und somit markierten Strukturen, zu denen ein Sprecher in einer Sprachkontaktsituation am schnellsten den Zugang verliert (vgl. Gürel 2007: 101). Für diese Elemente ist die Aktivierungsschwelle sogar in einer L1-Umgebung ohnehin hoch gesetzt. Verfügt die L2 jedoch über konkurrierende Formen, für die die Aktivierungsschwelle aufgrund des häufigeren Gebrauchs niedriger liegt, werden die schwer zugänglichen L1-Strukturen durch diese substituiert (vgl. ebd.: 104; Köpke 2007: 11f.). Damit einhergehend lässt sich schlussfolgern, dass funktionale, regelhafte Elemente wie Flexionsmorpheme oder die Kernsyntax aufgrund ihrer Auftretensfrequenz weitaus seltener von Attrition betroffen sind als einzelne Lexeme, die wesentlich häufiger nicht mehr zugänglich sind und deren Abhandenkommen als erstes Anzeichen von Attrition gilt (vgl. Keijzer 2007: 14f.; Schmid 2011: 48). Eine ähnliche Vorhersage über die für Attrition anfälligen sprachlichen Bereiche macht die Regressionshypothese. Sie besagt, dass diejenigen Einheiten als erstes verlorengehen, die als letztes erworben wurden, und umgekehrt (vgl. Jakobson 1941; zitiert nach Keijzer 2010: 9f.). Da markierte Strukturen später erworben werden als unmarkierte, kommen diese eher in einer Sprachkontaktsituation abhanden.
Was bereits in der oben zitierten Definition von Pavlenko sichtbar wird, ist die Uneinigkeit darüber, ob der Begriff „Attrition“ sich nur auf Erscheinungen im Kompetenzbereich oder bereits auf solche im Performanzbereich beziehen könne bzw. ob Attrition beide Bereiche betreffen kann. Werden Abweichungen auf Performanzebene erfasst, ist strittig, ob bestimmte L1-Strukturen tatsächlich nicht mehr vorliegen oder ob vielmehr der Zugang zu diesen aufgrund einer äußerst hoch gesetzten Aktivierungsschwelle versperrt ist (vgl. Keijzer 2007: 13; Köpke 2007: 25; Sharwood Smith & van Buren 1991: 18). Da die Produktion sprachlicher Einheiten im Allgemeinen schwieriger ist als deren Verständnis (vgl. Paradis 2004: 29), greifen entsprechend auch Attritionsprozesse auf der Performanzebene schneller als auf der Ebene der Kompetenz.
Sind Erwachsene von strukturellen Veränderungen ihrer L1 betroffen, kann laut Montrul (2008: 65) Attrition nur auf der Performanz-, nicht aber auf der Kompetenzebene auftreten. Diese Ansicht wird gleichermaßen von Seliger gestützt: Er betrachtet Attrition ausschließlich als Erosion der Performanz, da bereits erworbenes Wissen nicht vollständig verlorengehen kann (vgl. Seliger 1985: 4; auch Ecke 2004: 334). Paradis hingegen bestätigt zwar die Feststellung, dass bei erwachsenen Migranten Abweichungen in der L1 primär im Performanzbereich zu beobachten sind, betrachtet diese jedoch nicht als Attritionserscheinungen, sondern vielmehr als Hinweise auf Unzugänglichkeit zu noch immer gespeicherter Information (vgl. Paradis 2007: 130).
Die Aktivierungsschwellen-Hypothese hebt nicht nur die Bedeutung von Input für Spracherhalt hervor, sie formuliert zudem Annahmen bezüglich des Sprecheralters als einen relevanten Faktor für Attrition. So lässt sich nur dann von Attrition sprechen, wenn ein vollständiger Erwerb einer entsprechenden Struktur vorausgegangen ist. Dieser Behauptung ist der Altersaspekt auf mehreren Ebenen immanent: Zum einen werden markierte sprachliche Formen später erworben als unmarkierte, was einer kognitiven Maturation bedarf, die erst nach einem bestimmten Alter erreicht ist (vgl. Bylund 2009: 696). Beispielsweise wird das Erwerbsalter für komplexe syntaktische Strukturen wie Passivsätze auf 9 bis 11 Jahre gesetzt, während der Aufbau einfacher Sätze bereits in einem Alter von 2;0 bis 2;6 möglich ist (vgl. Klann-Delius 2008: 43).
Zusätzlich hängt diese Altersgrenze stark von den Strukturen der zu erwerbenden Sprache ab. Klann-Delius berichtet beispielsweise, dass der Erwerb des deutschen Kasussystems im Durchschnitt mit 3;6 Jahren abgeschlossen ist, während das russische aufgrund seiner Irregularitäten erst im Alter von 6 bis 7 Jahren sicher beherrscht wird (vgl. ebd.: 50). Nach Schmid lässt sich aber grundsätzlich davon ausgehen, dass die Erstsprache eines Sprechers ungefähr ab der Pubertät stabil ist und als erworben gilt: „[…] only speakers who emigrated when they were older than 12 years can be called ‘L1 attriters’“ (Schmid 2011: 73f.).
Zum anderen zeigt sich der Faktor „Alter“ darin, dass der Verlust von L1-Strukturen bei Auswanderung erst nach dieser kritischen Phase keine gravierenden Erosionserscheinungen zur Folge hat, sondern sich höchstens in den bereits oben diskutierten Performanzabweichungen äußert. Dies bestätigen Studien mit Sprechern, deren Auswanderung bereits Jahrzehnte zurücklag und deren Input in der L1 seitdem teilweise stark eingeschränkt war (vgl. Di Venanzio et al. 2012; Gürel 2007; Schmid 2002). Hier konnten bei den Probanden weder Alterseffekte noch Effekte der Aufenthaltsdauer auf die L1 nachgewiesen werden, was die Schlussfolgerung zulässt, dass die Erstsprache – wurde ihr Erwerb einst erfolgreich abgeschlossen – auch unter den ungünstigsten Bedingungen nicht abhandenkommt. Im Gegensatz dazu können bei Bilingualen, die schon vor einem vollständigen L1-Erwerb Kontakt zur L2 hatten, Attritionserscheinungen selbst im Bereich der Kompetenz auftreten und somit massivere Abweichungen und Sprachkontakteffekte auslösen (vgl. Schmid 2011: 73). Laut Paradis lässt sich erst bei dieser Sprechergruppe überhaupt von Attrition sprechen: „Is L1 ever lost? In very young immigrants, possibly, if the language is not yet well-established at the time of immigration and is never used thereafter“ (Paradis 2007: 130).
3.3.2 Transfermöglichkeiten der Erkenntnisse aus der Attritionsforschung
Wie die vorangegangenen Ausführungen zeigen, verdeutlicht die Aktivierungsschwellen-Hypothese die neurolinguistische Bedeutung des Inputs als eine der wichtigsten Komponenten für den Erhalt der Erstsprache. Gleichzeitig wird durch sie die These aufgestellt, dass bei Sprechern, die erst nach einem vollständigen Erwerb ihrer L1 Kontakt zur L2 hatten, die Erstsprache lediglich schwerer zugänglich ist und nie wirklich vergessen wird. Setzt der Kontakt zur L2 jedoch vor dieser entscheidenden Phase ein, können gravierende Erosionserscheinungen in der Erstsprache auftreten. Die durch diese Hypothese postulierten Zusammenhänge zwischen Input und Output sowie zwischen Rezeption und Produktion von sprachlichen Strukturen in Abhängigkeit von dem Alter des Sprechers bei L2-Kontakt lassen vor dem Hintergrund der Spracherwerbssituation von HL-Sprechern eine Übertragbarkeit dieser Annahmen auf ihren Kontext prognostizieren und erhalten in diesem Zusammenhang bezüglich zweier Kriterien eine umso höhere Relevanz:
Der erste Aspekt, der für den HL-Erhalt wesentlich entscheidender sein kann als für den Erhalt der L1 bei Migranten der ersten Generation, ist das Alter des Sprechers bei Kontaktbeginn zur Mehrheitssprache. So argumentiert Paradis, dass es ausschließlich bei sehr jungen Migranten, die vor der Festigung ihrer L1 ausgewandert sind, zu einem unumstößlichen Verlust ihrer Erstsprache, also zu Attrition kommen kann (vgl. Paradis 2007: 130). Diese Tatsache wird damit begründet, dass bei Kindern bis zu einem bestimmten Alter ein voll und ganz ausgebautes, verfestigtes sprachliches System nicht anzunehmen ist.
Für HL-Sprecher gilt im Vergleich dazu, dass sie das Wissen über ihre HL von Anfang an unter stetem Sprachkontakt zur Mehrheitssprache erwerben, der häufig nicht erst ab einem bestimmten Alter einsetzt, sondern konstant ab Geburt gegeben ist. Spätestens ab dem Schuleintritt lässt sich davon ausgehen, dass ein erhöhter Anteil der Kommunikation außerhalb des Elternhauses in der Mehrheitssprache stattfindet. Betrachtet man diese Spracherwerbssituation unter den Prämissen der Aktivierungsschwellen-Hypothese, lässt sich die Annahme formulieren, dass die Konsolidierung sprachlicher Strukturen bei HL-Sprechern eine längere Zeit in Anspruch nimmt, sodass sie von Attritionsprozessen nicht nur der seltenen und komplexen, markierten Strukturen, sondern von bereits in früher Kindheit erworbenen sprachlichen Strukturen betroffen sein können.
Der zweite Aspekt, der ebenfalls auf die Gruppe der HL-Sprecher übertragen werden kann, ist die Relevanz des sprachlichen Inputs. Diesbezüglich kann für HL-Sprecher ebenso von einem leichteren Zugang zu sprachlichen Elementen bei häufigerer Aktivierung ausgegangen werden, während sie bei seltenerem Gebrauch verlorengehen bzw. durch funktionsäquivalente Strukturen der Mehrheitssprache ersetzt werden, falls für diese die Aktivierungsschwelle niedriger gesetzt ist. Für HL-Sprecher ist die Bedeutung des sprachlichen Inputs für Spracherhalt gleichzeitig aus zwei Gründen ungleich größer als für erwachsene Migranten der ersten Generation:
(1) Der HL-Sprecher wächst im Gegensatz zu diesen von Anfang an in einer Sprachkontaktumgebung auf. Die Verwendung der HL ist für ihn folglich auf bestimmte Domänen des Sprachgebrauchs limitiert, die meist das intime Register darstellen und durch orate Strukturen artikuliert werden. Das formelle Register ist in den meisten Fällen durch die Mehrheitssprache besetzt. Auf diese Weise erhält der HL-Sprecher nicht die volle Bandbreite an sprachlichem Input in der HL, sodass die Aktivierungsschwelle für markierte Strukturen, insbesondere solche des formellen Registers, stets äußerst hoch gesetzt bleibt. Diese Strukturen sind nicht frequent und treten in der Inputart, die der HL-Sprecher erhält, eventuell nicht häufig genug auf, sodass sie erst gar nicht aktiviert werden können (vgl. Montrul 2011b: 593; Pires & Rothman 2009: 215).
(2) Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass der HL-Sprecher seinen Input von Sprechern der ersten Einwanderergeneration erhält, die selbst seit mehreren Jahren in einer Sprachkontaktsituation mit der Mehrheitssprache leben (vgl. Kupisch 2013: 207). Für sie kann der Aktivierungsgrad bestimmter Strukturen ebenfalls hoch liegen, weshalb es bei diesen Sprechern nach den Erkenntnissen der Attritionsforschung zu Sprachkontakterscheinungen aus der L2 kommt. Diese Abweichungen liegen zwar eher rein auf der Performanzebene, aber genau diese bildet den sprachlichen Input der HL-Sprecher: „Differently from monolinguals, HSs [heritage speakers; H. O.] are exposed to input that has inevitably been affected to some degree by previous cross-generational attrition and/or other language contact consequences“ (Pascual y Cabo & Rothman 2012: 451).
3.3.3 Unvollständiger bzw. divergenter Erwerb der Heritage Language
Die Rolle des Inputs beim HL-Erwerb wird jedoch nicht nur im Zusammenhang mit Attritionsprozessen dieser Sprechergruppe diskutiert, sondern auch im Hinblick auf unvollständige Erwerbsverläufe, deren Eigenschaften sich im sprachlichen Output von HL-Sprechern niederschlagen. Der unvollständige Erwerb bezeichnet im Gegensatz zur Attrition einen Zustand, bei dem bestimmte Teile eines sprachlichen Systems nicht vollständig erworben wurden und somit keine „muttersprachliche“ Kompetenz als Resultat des Spracherwerbsprozesses gegeben ist (vgl. Montrul 2008: 19f.). Er nimmt seinen Anfang in der Kindheit des Sprechers, wenn unter bestimmten Voraussetzungen einige Strukturen der HL nicht erworben werden können, weil ein intensiver Kontakt zur Mehrheitssprache einsetzt.