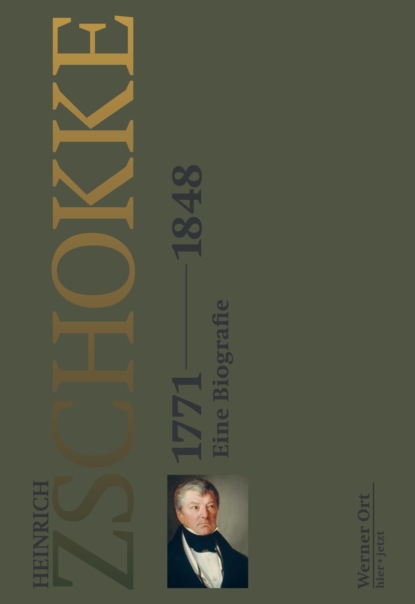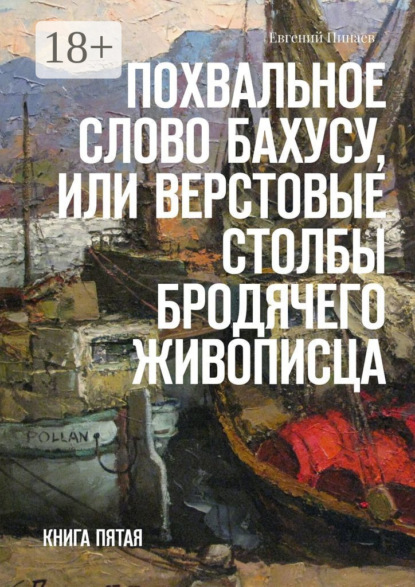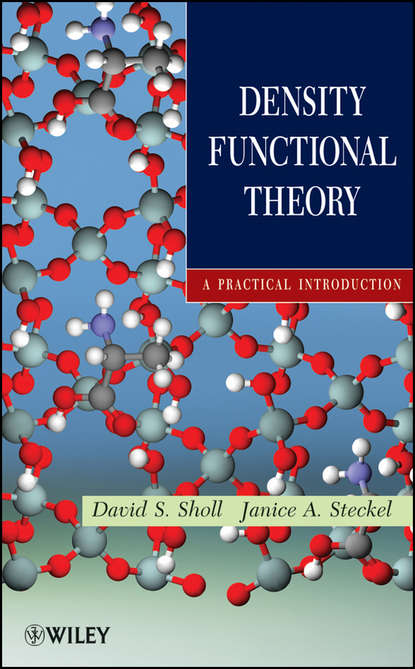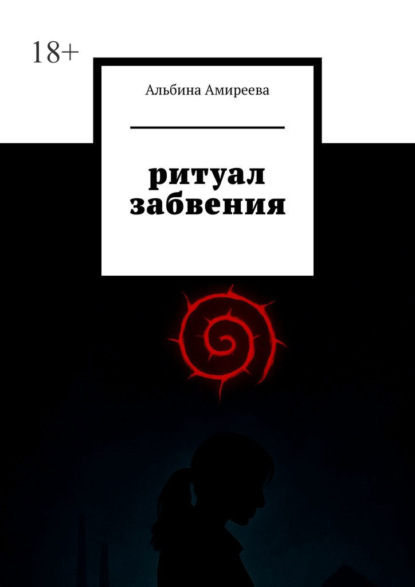- -
- 100%
- +
Kennzeichen einer Theatergesellschaft war es damals, neben den neusten und erfolgreichsten Lustspielen auch Schiller und Shakespeare im Programm zu führen. Die Hubersche oder Burgheimsche Gesellschaft machte hier keine Ausnahme. Ihre Aufführung des «Hamlet» aber wurde in Prenzlau zum Tiefpunkt ihrer Spielzeit. Ein Zuschauer machte in der «Theater-Zeitung für Deutschland» seinem Ärger Luft. Es sei unklug vom Direktor gewesen, mit einer so kleinen Truppe dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Den König von Dänemark habe ein Schauspieler gegeben, der von seiner Figur einem Sancho Pansa geglichen habe und von seiner Kleidung «ein wahrer zusammengeflickter Lumpenkönig» gewesen sei. Der Hamlet von Herrn Burgheim (Hr. B—g—m), der als bester Schauspieler der Truppe gelte, sei schlecht gespielt worden, «die übrigen Personen, Laertes und die Ophelia ausgenommen», noch viel schlechter.118 Einen Monat später schrieb ein anderer Theatergänger aus Prenzlau, man sehe einer besseren Truppe mit Sehnsucht entgegen.119 Die geballte Unzufriedenheit des Prenzlauer Publikums muss für die Schauspieler Franz Huber und Wilhelm Burgheim und für Zschokke sehr unerfreulich gewesen sein.
Aus der «Selbstschau» bekommt man den Eindruck, als habe Zschokke die Blamage gar nicht mitbekommen oder sich von der Truppe innerlich so weit distanziert, dass er die Kritik nicht auf sich beziehen musste. Er habe sich, schrieb er, «nach und nach von diesem Gemengsel arbeitscheuer Gesellen, entlaufener Weiber, ungerathner Söhne, gefallsüchtiger Mädchen, verdorbner Studenten u. s. w.» abgesetzt und nur noch mit Burgheim zusammengelebt. Die Anzüglichkeiten, Frivolitäten, Eifersüchteleien und Streitereien des Theatervolks gingen ihm gegen den Strich. In seinen freien Stunden habe er seiner «angeborenen Lesesucht» gefrönt und verschiedene Bibliotheken durchstöbert, darunter eine, die sich im morschen, verwitterten Chor einer Kirche befand, von hundertjährigem Staub bedeckt.120 Mit dieser abschätzigen Bewertung der Schauspieler, die der Beschreibung des deutschen Theaters von Reck entnommen zu sein scheint, brauchte er sich den Misserfolgen, an denen er mitbeteiligt war, nicht mehr zu stellen.
Unmittelbar nach Abschluss seines Engagements als Theaterdichter schrieb er den Aufsatz «Schuzrede für wandernde Truppen», worin er die Bedeutung des Theaters für Aufklärung, Sittenverfeinerung und Volksbildung noch einmal hervorhob und den Wunsch äusserte, auch kleinere Städte und Provinzen möchten Zugang zu gutem Theater erhalten. «Auserlesenen kleinern Truppen» solle ein fester Bezirk zugewiesen werden, den sie, ohne finanzielle Einbussen zu erleiden, privilegiert bereisen dürften, um den Bürgern Amüsement und «die geläuterten Freuden des Geschmacks zu verschaffen».121 Diese idealistische Vorstellung stand in einem gespannten Verhältnis zu dem, was Zschokke im Wandertheater an Einblicken gewonnen hatte, aber es änderte nichts daran, dass er dem Theater eine kathartische Wirkung auf die Besucher zubilligte, wie sie bei einer weitgehend illiteraten Bevölkerung sonst kein Medium haben konnte. Voraussetzung sei allerdings – und hier schloss sich Zschokke wieder Reck an –, dass die Schauspieler finanziell besser gestellt seien und sich auch ihr Ruf verbessere: «An vielen Orten Deutschlands fällt es dem gemeinen Mann noch immer schwer, den Komödianten vom Marktschreier zu unterscheiden. O, gute Thalia, wie demüthigt dich dieses bei all deinen Triumphen!»122
Zschokke befreundete sich in Prenzlau mit einem preussischen Offizier, einem «bescheidnen, wissenschaftlich gebildeten» Mann. Der aus Schlesien stammende Karl Andreas von Boguslawski (1759–1817) war einer der nicht ganz seltenen Adligen, die im Militär Karriere und sich auch als Schriftsteller einen Namen machten. In seiner Freizeit übersetzte er Homer, Vergil und Metastasio. Er «arbeitete damals an einer metrischen Übersetzung der horazischen Oden» und lud Zschokke zu einem Wettstreit ein.123
Natürlich konnte Zschokke mit Boguslawski bei Übersetzungen aus dem Latein nicht mithalten, aber er bekam durch ihn einen neuen Zugang zur lateinischen Sprache und Literatur, ein Gefühl für ihre Schönheit und Würde. Die Bekanntschaft mit Boguslawski bildete einen Gegenpol zur lärmigen, oberflächlichen Welt des Theaters. Sie liess ihn erkennen, dass man sich mit Enthusiasmus einer Sache widmen konnte, ohne gleich an den Nutzen zu denken, und dazu noch in einem Fach, das er bisher mit Schule und Zwang verband. Er realisierte, dass es dabei auf die innere Einstellung ankam, der Gegenstand dagegen unerheblich war. Vielleicht fasste Zschokke damals den Vorsatz, mehr aus seinem Leben zu machen, statt mit Gelegenheitsdichtungen auf den grossen Erfolg zu warten und dabei zu riskieren, als brotloser Künstler unterzugehen.
Neben Horaz und Vergil arbeitete Boguslawski an einer Übersetzung der «Ilias», deren ersten Gesang er 1787 «travestiert» herausgegeben hatte.124 Das bedeutete, dass er sich weniger um eine wörtliche Übersetzung bemühte, sondern darum, den Kerngehalt in die eigene Sprache zu bringen. Begeistert nahm Zschokke diesen Gedanken auf. Eine Übersetzung sollte nicht eine originalgetreue Übertragung, sondern eine Eindeutschung sein, die den Text dem heutigen Leser verständlich mache. Man müsse sich zwar bei einem klassischen Text die Toga anziehen und das veredelte Altertum wieder auferstehen lassen, aber eines, das glaubhaft sei, indem man die Verfeinerungen der Kultur und die Eigenarten des deutschen Publikums mitberücksichtige. So ungefähr äusserte sich Zschokke im Januar 1795 in Berlin vor einer gelehrten Gesellschaft in einem Vortrag über poetische Verdeutschungen aus dem Latein.125
Besonders lobenswert fand Zschokke die Übersetzungen des Martial durch Karl Wilhelm Ramler (1725–1798), und er griff die Kontroverse auf, ob die Übertragung aus anderen Sprachen und Zeiten, wie in der Schule oder von Philologen praktiziert, Wort für Wort und Satz für Satz erfolgen oder sich der eigenen Sprache anpassen müsse. Zschokke entschied sich für den zweiten Weg, auch als er 1805 die Komödien von Molière und 1837 die Erzählungen des Genfers Rodolphe Töpffer übertrug, was dieser einmal «eine Travestie ohne Treue» nannte. Eine Travestie schien Zschokke aber der einzig gangbare Weg, den Empfindungen und der Mentalität der Deutschen gerecht zu werden und Literatur lebendig werden zu lassen. Der Übersetzer wurde so zum Nachdichter, deshalb war das Einfühlungsvermögen und die stilsichere Beherrschung des Deutschen wichtiger als eine gute Kenntnis des Französischen oder Lateinischen.
Statt sich mit Boguslawski auf einen Übersetzerwettstreit einzulassen, hatte Zschokke die Idee, selber ein Epos in Hexametern zu verfassen. Er nahm sein früheres Motiv von der Eroberung Magdeburgs wieder auf und erweiterte es zum Plan einer grossen Dichtung über den Dreissigjährigen Krieg. Soweit es sich aus den Fragmenten und wenigen Angaben beurteilen lässt, sollte es ein Panorama von Krieg und Zerstörung, Heldentum und Verrat, Leid und Leidenschaften werden. Eine grosse Liebe kam auch darin vor: zwischen dem evangelischen Administrator Magdeburgs Christian Wilhelm (dem offiziellen Landesfürsten) und der Katholikin Sidonia. Zschokke nannte sein episches Gedicht «Der heilige Krieg», und es besteht kein Zweifel, dass er damit nicht nur den Krieg des schwedischen Königs gegen den Habsburger Kaiser meinte, sondern den Krieg der Protestanten für die Religionsfreiheit und gegen das usurpatorische Papsttum. Den ersten Gesang mit 450 Hexametern, der während der Belagerung Magdeburgs spielt, veröffentlichte er 1794 im zweiten Teil seiner Sammlung «Schwärmerey und Traum in Fragmenten, Romanen und Dialogen von Johann von Magdeburg». In einer kurzen Vorrede notierte er, er habe das Projekt im 18. Lebensjahr (also in Prenzlau) angefangen, dabei aber die Schwierigkeiten der Ausführung unterschätzt.126 Der Anfang ist stark an die «Ilias» angelehnt und das ganze Werk weniger eine ernstzunehmende Dichtung als der Versuch, ein für ihn neues Stilmittel zu erproben.
SCHRIFTSTELLERTEUFEL
Beim «ersten Frühlingshauch» des Jahrs 1789 packten Burgheim und Zschokke ihre Sachen und zogen mit ihrer Künstlerschar nach Landsberg an der Warthe, um dort ihre Bühne zu eröffnen. Im Frühsommer löste sich die Truppe auf: Christian Friedrich Runge ging mit einem Teil der Truppe weg,127 Burgheim entliess nach und nach die übrigen Schauspieler und blieb in der Stadt, um seine geschwächte Gesundheit zu pflegen.128

Ansicht von Landsberg (dem heute polnischen Gorzów Wielkopolski) von Süden, mit der Warthe im Vordergrund, wo sich auch ein Bootshafen befand. Dieser Anblick dürfte sich Zschokke geboten haben, als er im Frühling 1789 mit der Theatertruppe Wilhelm Burgheims über die Brücke in die Stadt einzog. Hier verbrachte er ein Jahr, dichtete und bereitete sich auf die Universität vor.
Die Krönung von Zschokkes theatralischer Sendung war es, als in Landsberg sein «Monaldeschi» aufgeführt wurde. Dieser Erfolg war Grund genug, gegenüber seinen Verwandten sein anderthalbjähriges Schweigen zu brechen. Er sei in der Stadt allseits bekannt und geliebt, schrieb er an Andreas Gottfried Behrendsen. «Was kann ich mir mehr also noch wünschen?»129 Trotz dieses Triumphs rührte er einige Jahre lang kein Theaterstück mehr an, sondern verarbeitete seine Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Theater in Aufsätzen und im satirischen Roman «Der Schriftstellerteufel», der Anfang 1791 in Berlin erschien.130 Es ist ein aberwitziges Buch, sicher etwas vom Humorvollsten, was Zschokke je verfasste, eine Art Studentenulk, der noch heute vergnüglich zu lesen ist.
Zschokke hatte ein Gebiet gefunden, das er in Cranzscher Manier satirisch bearbeiten konnte. Er bereicherte die «Gallerie der Teufel» um ein weiteres, nicht unsympathisches Mitglied, den Satan Merimatha, «König, Apoll und Gesezgeber aller elenden Autoren und Autorinnen, Wochenblätter und Pamfletenschmierer etc. etc.»131 Merimatha ist Herr über die Hölle für Schriftsteller, die mit der Makulatur der deutschen Belletristik geheizt wird, und von da steigt er zur Erde hinauf, da ihm das Heizmaterial ausgeht und die Höllenfeuer zu erlöschen drohen.
Merimatha will den schlechten Büchern zu ihrem Recht verhelfen und die Lage seiner Schutzbefohlenen, der deutschen Poeten, verbessern. Zu diesem Zweck reist er selber als Poet durch Deutschland, angetan mit den Requisiten, die ihn als verkanntes Kraftgenie ausweisen: verwahrloste Kleidung, ungepflegte Haare, tintenbekleckste Finger, eine Lorgnette, die er alle Augenblicke an die Nase hält, und eine verworrene Sprache. «Das ist der feinste sinnlichste Autorkniff, um das Volk zu täuschen, es glauben zu machen, du habest durch nächtliches Studieren deinen schönsten Sinn verloren», rät ihm Machiavelli, den er um Rat gebeten hat.132
In Purlenburg, das man sich als irgendeine deutsche Provinzstadt denken kann, wird Merimatha von der «bekannten Kümmelschen Schauspielergesellschaft» für eine mickrige Gage als Theaterdichter engagiert: «Über anderthalb Thaler wöchentlich kann ich Ihnen nicht geben; mein erster Liebhaber bekömmt nur drei!», sagt Kümmel.133 Als Einstieg verfasst Merimatha einen Prolog, der von der Direktrice rezitiert werden soll:
«Der Vorhang ging auf; mir schlug das Herz gewaltig; ich zitterte ungeduldig, meinen schönen Prolog aus dem Munde der Madame Kümmel zu vernehmen. Sie kam – knixte – stotterte – schwankte und sank beinahe in Ohnmacht. Mir vergingen alle fünf Sinne; ich sah nicht; ich hörte nicht. Mühsam radebrechte sie dies Meisterstük eines Prologs zu Ende, und empfahl sich. Hierauf folgte der Graf von Essex, in welchem der kleine Herr Kümmel in seinem weißen Sonntagskleide, mit einer papiernen Feder auf dem Hut, den großen Essex martialisch herdeklamirte. –
Das Stück schlief sich glüklich aus.»134
Um den Misserfolg auszubügeln, entwirft Merimatha den Plan «zu einem fürchterlichen Originaltrauerspiele: die Eroberung und Zerstörung von Purlenburg, in fünf Akten». Der Inhalt erinnert nicht zufällig an «Monaldeschi», da sich Zschokke hier und an anderen Stellen im Roman selber persifliert:
«Ich will nicht erwähnen, daß mein Stük gräslicher flucht, als ein Schillerscher Libertin; unsinniger rast, als Klingers Guelfo; daß im vierten Akt schon Weib und Kind, wie Rüben, auf dem Theater herumgemäht liegen, und alles erstochen, erschossen, ersäuft, erhängt, erschlagen, vergiftet ist, was in den vorigen Aufzügen Odem saugt; nicht erwähnen, daß der fünfte aus lauter Geisterszenen, schauerlich und grauerlich, zusammengesponnen ist, – denn man hat seine Noth von den übrigen vagabundirenden Truppen, welche nur nach derlei Grausspielen lechzen [...].»135

Zschokkes satirischer Roman «Der Schriftstellerteufel» mit den Abenteuern von Satan Merimatha, der nach Deutschland kommt, um die armen Poeten vor dem Hungertod zu retten. Im Anhang ein Ausfall gegen Johann Georg Zimmermann, den Leibarzt von Friedrich dem Grossen.
Die Kümmelsche Gesellschaft reist von einer Stadt zur andern. Das Trauerspiel «Die Eroberung und Zerstörung von Purlenburg» findet «gellenden Beifall», wobei Merimatha die geniale Idee hat, den Namen Purlenburg auf dem Theaterzettel auszuwechseln, um das Stück für jeden Aufführungsort passend zu machen, auch wenn man dort seit der Stadtgründung noch nie einen Feind gesehen hat.136
«Meine blühendste Theaterepoche war ietzt. Von allen Seiten erhielt ich Trauer- Graus- Schau- Familien- Lust- Possen- und Singspiele eingeschickt, um mein Urtheil und Gutachten darüber zu geben, und sie auf dem Kümmelschen Theater aufführen, oder den Verfassern zurükkommen zu lassen.»137
In der Stadt Teterow geht Herrn Kümmel das Geld aus; die Schauspieler laufen ihm davon, er gibt sein Unternehmen auf und ruft Merimatha zu sich, um ihm zu kündigen.
«Ich. Ist das Ihr Ernst, Herr Kümmel? – und Sie wollen auch meine wichtige Person verlieren?
Kümmel. Wichtig! Ha, ha, ha! Sie waren iust das unnüzzeste Möbel in meiner Direkzion.
Ich (aufspringend). Undankbarer – also hat mein großes Trauerspiel, die Eroberung und Zerstöru – –
Kümmel. Mir Nachtheil mehr, als Nuzzen geschaft – Sollte der Himmel so gnädig sein, und mich noch einmal zum Führer einer Schauspielergesellschaft erhöhen: so sollen alle Prunkspiele aus derselben verbannt sein; sie sind der Ruin meiner Börse und – –
Ich. Herr, davon verstehen Sie – –
Kümmel. Mein Herr, da ist die Thür – –»138
Darauf lässt Merimatha sich als Turmwächter anstellen und mietet sich in einem Poeten-Dachstübchen ein, wie er es sich erträumt hat, «wo du die Harmonie der Sphären belauschen und alle Herrlichkeiten der Welt unter deinen Füßen sehen kannst».139
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Roman voller Ein- und Ausfälle, Anspielungen, Rundumschläge und Finten, da der Autor ja, wie Cranz es vormachte, jede Wahrheit äussern, jede Narrheit blossstellen darf, wenn sie im Gewand der Satire daherkommt. Kaum ein Berufszweig wird nicht irgendwo karikiert, vom keifenden Magdeburger Butterweib über Handwerker, Kleiderjuden, Quacksalber, Turmwächter, Sänfteträger, Studenten und Schönlingen bis zum Lehrer, Kanzlisten, Gelehrten, Rezensenten und Verleger. Bedauerlicherweise ist diese kleine Kostbarkeit der humoristischen deutschen Literatur vollständig in Vergessenheit geraten. Um eine grössere Leserschaft an Zschokkes Dichtungen heranzuführen, ist sie ein guter Einstieg, auch weil er sich für einmal kurz fasste und keine rührselige Liebesbrühe darüber goss. Im Zusammenhang mit der Affäre um Kotzebue und Carl Friedrich Barth werden wir noch einmal auf diesen Roman zurückkommen.
Es ist übertrieben, Landsberg an der Warthe, ein Städtchen in der Neumark an der Grenze zu Polen,140 als kleines Magdeburg zu bezeichnen, auch wenn Zschokke diesen Eindruck hatte. Er fühlte sich rasch heimisch, mehr als in Schwerin und Prenzlau. Vielleicht lag es am Frühling und an den neuen Aufgaben, denen er sich stellte, dass die Schwermut von ihm abfiel. Er fand Freunde und lebte nicht mehr so eng mit Leuten zusammen, die ihn ihrer ungehemmten Eigensucht und ihres Hedonismus wegen abstiessen und seine Moralvorstellungen verletzten. «Nun, und ich bin glüklicher – bin seliger, meine Tage sind eine aneinanderhangende Kette süsser Traüme», schrieb er Behrendsen.141
Wie Magdeburg war Landsberg eine Stadt des Bürgertums, ohne Fürstenhof oder einflussreichen Adel, mit bedeutender Wollzeugmanufaktur und einem Handel, der sich des Flusses Warthe bediente. Es war eine preussische Garnisonsstadt wie Magdeburg und Prenzlau, beherbergte ein Regiment Dragoner und war von einer Wehrmauer umgeben. Nach dem Siebenjährigen Krieg wurden links und rechts der Warthe Kanäle, Schleusen und Deiche angelegt und aus den Sumpfgebieten des Warthebruchs Siedlungsland geschaffen.142 Dennoch kam es 1785 im ganzen Gebiet der Oder, in welche die Warthe bei Küstrin einmündet, zu Überschwemmungen.
Landsberg hatte ungefähr 5500 Einwohner, darunter gegen 300 Juden, die seit dem 14. Jahrhundert hier Zuflucht gefunden und 1752 eine Synagoge errichtet hatten. Ein Zeichen friedlichen Zusammenlebens der Religionen und Konfessionen war die Konkordienkirche, die von der lutherischen und reformierten Gemeinde gemeinsam benutzt wurde und wo Friedrich Schleiermacher 1794–1796 als Hilfsprediger wirkte. Man war hinsichtlich der Religionstoleranz ein bisschen fortgeschrittener als Magdeburg mit seiner stark lutherisch-pietistischen Tradition und einer mehr oder weniger starken Segregation von den Reformierten und Katholiken.
Als die Burgheimsche Theatergesellschaft sich verlief, vielleicht schon vorher, beschloss Zschokke, sein früheres Ziel wieder aufzunehmen und an die Universität zu gehen. Er hatte allerdings noch ein kleines Hindernis zu bewältigen: Es fehlten ihm die finanziellen Mittel dazu. Auch wenn die ihm vom Glockengiesser Ziegener auferlegten zwei Jahre Wartezeit noch nicht ganz verstrichen waren, so war er im März 1789 immerhin 18 Jahre alt geworden und durfte hoffen, sein väterliches Erbe endlich ausgehändigt zu erhalten. Zschokke lebte in Landsberg, wie er sich in der «Selbstschau» erinnerte, von seinen geringen Ersparnissen, und erteilte Privatunterricht.143 Vermutlich hielt ihm auch Burgheim etwas Geld zu, solange er für ihn tätig war.
Durch zwei Landsberger Juden – den Buchhändler und Publizisten Saul Ascher144 und den Kaufmann A. F. Jacobi – wurde Zschokke in die jüdische Religion und Lebensweise eingeführt.145 Viel erfährt man nicht von dieser Begegnung, die den Beginn von Zschokkes lebenslanger Beschäftigung mit verschiedenen Religionen und seines Einstehens für die Rechte und Emanzipation der Juden markiert.146
Eine andere bedeutsame Begegnung Zschokkes fand mit Gotthilf Samuel Steinbart (1738–1809) statt, Ordinarius für Philosophie und ausserordentlicher Professor für Theologie an der Universität Frankfurt (Oder), Leiter des Waisenhauses und verschiedener Anstalten in Züllichau und seit 1787 Mitglied des neugeschaffenen preussischen Oberschulkollegiums. Im gleichen Jahr hatte er ein umfang- und inhaltsreiches Schriftstück ausgearbeitet, «Gedanken und Vorschläge über die Verbesserung der städtischen Bürgerschulen», in dem er sich statt einer theologischen für eine pädagogische Ausbildung der Lehrer aussprach, mit dem Ziel einer «neuen Klasse Menschen, der Schullehrer». Was der Bürger an praktischen Kenntnissen brauche, sei den theologisch geschulten Lehrern fremd; die könnten nichts als Bibellesen, Katechismus, lateinische und griechische Grammatik. In Seminarien müsse ein neuer Lehrerstand herangebildet werden.147 In Züllichau machte Steinbart den Anfang.
Bekannt wurde Steinbart mit seinem «System der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre des Christenthums»,148 in dem er darlegte, dass Gott den Menschen geschaffen habe, damit er glücklich sei, und nicht, um ihn in Angst und Schrecken zu versetzen oder asketisch leben zu lassen. Steinbart verband Epikurs Philosophie der Angst- und Schmerzfreiheit als menschliches Trachten mit einer zeitgenössischen christlichen Lehre. Gott, so lautete seine Überzeugung, wolle von uns geliebt und nicht gefürchtet werden; er kümmere sich um uns und um die kleinsten Veränderungen unseres Lebens und wolle «blos durch Redlichkeit und wohlwollende Gesinnungen gegen andere unter dem frölichsten und vernünftigsten Genuß alles Guten in der Welt von uns dankbar verehret werden».149 Steinbart wandte sich entschieden gegen dogmatische Streitereien und theologische Spitzfindigkeiten.
Sein «System» wurde von der Aufklärung enthusiastisch gefeiert, da es den Menschen als im Prinzip unbegrenzt bildungsfähig und Gott als fürsorglichen Pädagogen darstellte, dessen Wirken von den besten Absichten und von vernünftigen Überlegungen geleitet war. Carl Friedrich Bahrdt (1741–1792), der radikalste theologische Aufklärer seiner Zeit, meinte über Steinbart, nur wenige deutsche Theologen hätten so freimütig wie er die Idole des Kirchensystems umgeworfen und zertrümmert: «Dieser Mann hat nicht bloß das alte Haus eingerissen, sondern einen neuen Palast an seine Stelle gesetzt. Seine Glückseligkeitslehre verdient, das allgemeine Kompendium der Religion zu werden.»150 Zschokke, der unter Steinbart studierte, hatte seine theologischen Überzeugungen hauptsächlich ihm zu verdanken.
Steinbart war neben allen anderen Ämtern neumärkischer Konsistorialrat, und Landsberg fiel deshalb in seinen Einflussbereich; er war also nicht zufällig hier zu Besuch, und Zschokke nutzte die Gelegenheit, mit ihm über seine Pläne und finanziellen Sorgen zu sprechen. Darüber schrieb er an Behrendsen am 12. Juni 1789: «... ich bin durch eine der ansehnlichsten Familien allhier dem berühmten Steinbart, Prof. der Univers[ität] vorgestellt worden, bei welchem ich nicht allein freie Kollegia, sondern auch freie Wohnung erhalten werde.» Damit war es entschieden, dass er nicht wie die meisten Magdeburger nach Halle, sondern wie andere Neumärker an die Viadrina gehen würde. Ob der Wunsch, Steinbarts «System» zu studieren, bereits eine Rolle spielte, wissen wir nicht. Während es jenseits des Rheins wetterleuchtete und schliesslich ein Gewittersturm losbrach, richtete sich Zschokke im hintersten Winkel Deutschlands behaglich ein. Ein Dichterstübchen besass er zwar nicht, wohl aber eine Gelehrtenstube, wo er von seiner Wirtin, einer Frau Bunzel, mütterlich umsorgt wurde.
«Im Sommer 1789 befand ich mich zu Landsberg an der Warta, in der Neumark. Ich war an einem schönen Morgen ausgegangen ins Freie, jenseits des Flusses, wo einzelne Landhäuser an dessen Ufer zerstreut umher gelagert sind. Niemand begleitete mich, als mein Horaz. Aber wie mocht’ ich ihn lesen? Himmel und Erde waren zu schön. Ich schwelgte mit allen Sinnen in den Wundern der Natur, schwärmte über Hügel und Thal, und fühlte nichts, als das süße Glück zu leben.
Ich behielt den römischen Dichter in der Tasche, sang und jauchzte; meine Empfindungen waren lyrisch; sie bedurften des fremden Anglühns nicht. [...]
Erst spät kehrt’ ich zurück. Es war schon Mittag, als ich zu Madame B** ins Zimmer trat. Sie erwartete mich schon längst zum Essen.
Wir speiseten allein in ihrem Zimmer. Fröhliche Gespräche versüßten das Mittagsmahl.
Bald nach Tische gieng Madame B** hinaus. Ich warf mich, nachdem ich einige Gänge gemacht hatte, in einen Lehnsessel, der nahe am Fenster stand, vor welchem die weissen Mousselinvorhänge niedergelassen waren, so wie vor dem andern Fenster des Zimmers, um den einfallenden Sonnenstrahlen zu wehren.»151
So begann Zschokkes Bericht darüber, wie er plötzlich gewahr wurde, dass er seinem imaginären Doppelgänger gegenüber sass. Diese Episode zeigt, wie stark er mit sich selber beschäftigt war. Er hatte sich in kürzester Zeit körperlich derart verändert, dass er sich selber nicht wieder erkannte: «In Pensionen und Schulzimmern zwischen Büchern erzogen, war mein körperliches Wachsthum lang zurückgehalten worden. Ich war bis in mein achtzehntes Jahr klein und unansehnlich geblieben; dann aber entfalteten sich meine physischen Kräfte schnell. Ich wuchs, und sah bald über diejenigen meiner Altersgenossen hinweg, die mich vorher an Größe übertroffen hatten.»152