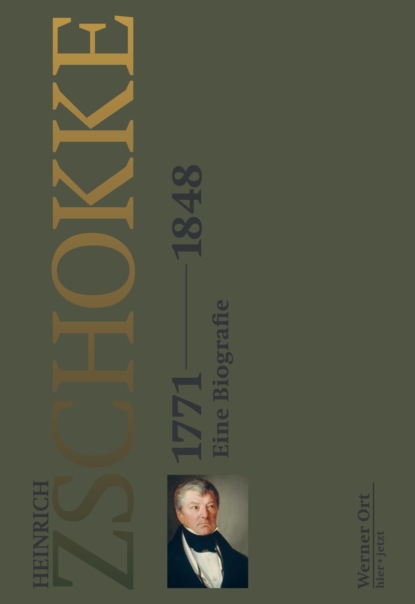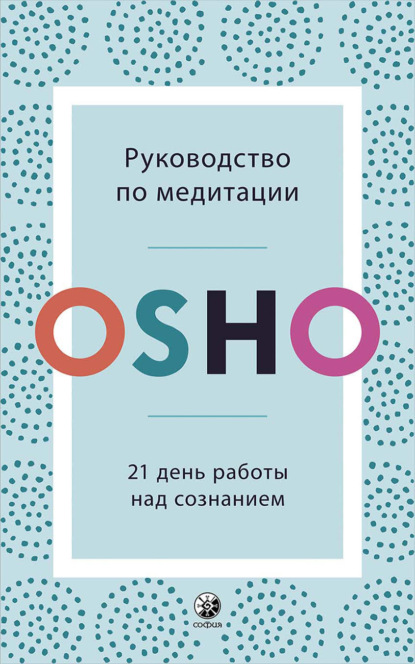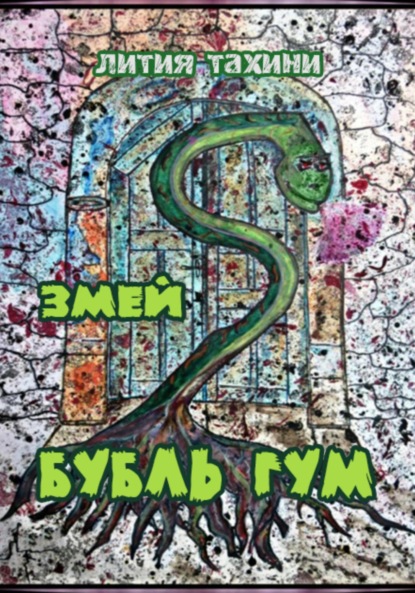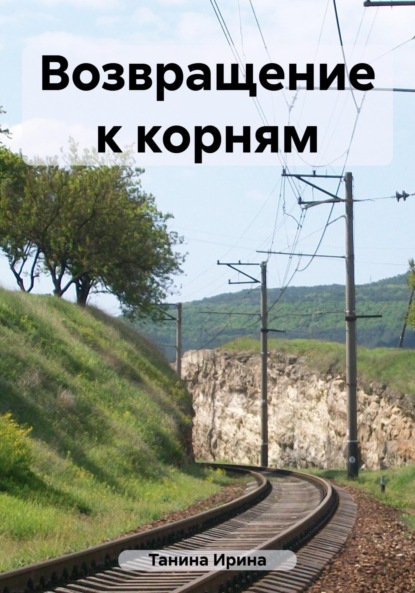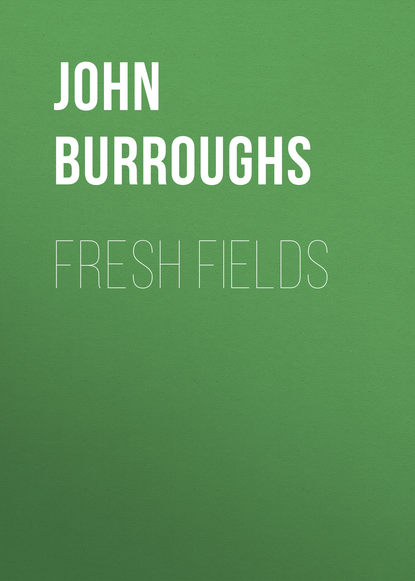- -
- 100%
- +
Auch in seiner Persönlichkeit war seit seinem Abschied aus Magdeburg eine grosse Veränderung eingetreten. Er befand sich in einem Übergang zwischen Jugend und Erwachsenem, wusste nicht, wer er war, was aus ihm werden und wie er sich einschätzen sollte. Er fühlte sich als Schüler, Dichter und Gelehrter zugleich und las, was ihm in die Hände fiel. Dadurch wurde seine Phantasie weiter beflügelt, und er hatte nach ausgedehnten Lektüren und durchwachten Nächten wie früher in Magdeburg vermutlich mehr als einmal Mühe, Einbildung und Wirklichkeit, Wachtraum und Realität voneinander abzugrenzen.
Im Oktober 1789 schrieb Zschokke an Christoph Martin Wieland und bot ihm den ersten Gesang seiner Versdichtung «Orian» für den «teutschen Merkur» zum Abdruck an. In seinem Brief skizzierte er kurz seinen poetischen Lebenslauf, der auch inhaltlich erdichtet war: Er sei Sohn eines Tuchmachers von gutem Herzen, der ihm «zwei gesunde Hände, ein reines Herz und eine dichterische Ader» hinterlassen habe, und wann immer er einen geistreichen Knittelvers verfasste, sei er von seiner andächtigen Familie, «von den Reimen herzlich erbaut, mit einem wolgemeinten Seegen» aufgenommen worden. «Mein Verstand reifte mit den Jahren. Ich las die Dichter der Alten und Neuen; pflegte meinen Geist mit den Meisterstükken der Muse iedes Zeitalters; spürte zuweilen im Taumel der Entzükkung einen unbekannten Trieb ähnliche Flüge zu wagen, ohne daß ich diesem Trieb einen Namen geben konnte. Ich begnügte mich damit unterweilen ein Epigram zu schmieden; eine Romanze war mein kühnstes Wagestük.»153
Vor allem Wielands «Oberon» habe ihn tief beeindruckt, die Abenteuer des Ritters Hüon im Morgenland. Hier, in einer Märchenwelt, halb 1001 Nacht, halb Ritterzeit des Frühmittelalters, siedelte Zschokke auch sein Versepos «Orian» an. Das Versmass der Stanzen (Ottave rime) lieh er sich ebenfalls bei Wieland aus, der seinerseits italienische Vorbilder benutzte. In Zschokkes Fabel verwandelt der mächtige orientalische Fürst und Zauberer Orian seine beiden Töchter in eine Sirene und einen gespenstischen Schatten, weil sie seinem Befehl nicht gehorchten. Nur zwei sie liebende Ritter können sie erlösen. «Soweit der Plan.» Zschokke wartete vergeblich darauf, dass ihm der bewunderte Dichter eine «gütige Antwort, damit ich meiner schwankenden Ungewisheit wegen des Schiksals meines Kindes desto früher entbunden werde», schicke. Und er wartete auch darauf, dass der Anfang des «Orian» im «teutschen Merkur» erscheine, so dass er weiter hätte dichten und Wieland «privatim ein mehreres über meine Person entdekken» können.154
Von diesem «Orian» ist noch ein kleines Fragment vorhanden, das Zschokke in seinen Roman «Geister und Geisterseher» an der Stelle einfügte, wo Wilhelm Walter von einer Dirne verführt wird.155 Auch in der freizügigen Erotik waren Wielands Versgedichte, von «Musarion» über «Agathon» bis «Oberon», Zschokkes Vorbild. Er vermerkte dazu: «Aus einem noch ungedrukten, romantischen Gedichte: die Helmaiden, erstes Buch.»156
Wielands Schweigen hielt ihn nicht davon ab, in dieser Art weiter zu dichten. 1793 gab er ein Buch heraus, «Die Bibliothek nach der Mode», dessen Untertitel, «Erstes Bändchen», eine Fortsetzung versprach.157 Es ist nirgends mehr aufzutreiben, vielleicht, weil es nicht nur den Rezensenten der «Allgemeinen Literatur-Zeitung» empörte. Schon der erste der beiden Beiträge, die Erzählung «Die falschen Münzer» stiess ihn ab, nicht nur, weil die Hauptperson «eine unglückliche Kopie von Schillers Karl Moor, ein edler Mann und zugleich Anführer einer Bande edler Räuber und falscher Münzer ist», nein, schon der Anfang, wo ein junges Fräulein mit einem nackten Burschen zusammengebracht werde, sei frech und schlüpfrig.158 Der Rezensent der «Allgemeinen deutschen Bibliothek» – Freiherr von Knigge159 – schloss sich an: «Die Schreibart ist incorrect, und Scenen der Wollust malt der Verf[asser] in diesem Romänchen und in dem Gedicht, wovon wir sogleich reden werden, mit solchen Farben aus, daß man wohl sieht, wie wenig ihm Beförderung der Sittlichkeit am Herzen liegt.»160 Auch Knigge meinte, Schillers Räuber sei geplündert worden.
Hat man bei Schiller aber schon den Eindruck, es sei nur Zufall, dass der eine Bruder zum Ausgestossenen und Räuber wird und der andere als braver Sohn und Biedermann gilt, so ging Zschokke noch einen Schritt weiter, indem er beide Charaktere in einer Person vereinte. Es tritt also das Motiv der doppelten Persönlichkeit hinzu, ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde mit der Janusmaske des Verbrechers und des braven Bürgers. Auch der Titel «Die falschen Münzer» enthält die zweifache Bedeutung des falschen Falschmünzers. Aus dieser Grundidee entwickelte Zschokke später sein Erfolgsstück «Abällino, der grosse Bandit». Dass sich die beiden Seiten der Person am Schluss sauber voneinander trennen und das Gute obsiegt, ist eine Schwäche von Zschokkes Ansatz.
Der zweite Beitrag hiess «Atlantis oder die Entdeckung von Madera, ein episch romantisches Gedicht in gereimten Stanzen». Er beruht auf einer Sage, die den Besuchern Madeiras heute noch erzählt wird: Ein englischer Edelmann floh im Jahr 1346 mit seiner nicht standesgemässen Geliebten übers Meer, wurde vom Sturm abgetrieben und strandete auf einer Insel, wo das Mädchen an Heimweh und er bald darauf an Trauer starb. So wurden die beiden unwissentlich und aus Zuneigung füreinander Entdecker der Insel Madeira, von der die Kunde ging, dass sie das sagenhafte Atlantis sei.161
Abgedruckt wurden in der «Bibliothek nach der Mode» die ersten beiden Gesänge von diesem Versepos, und darin eine Liebeszene zwischen Arabelle und Lyonnel, die stärker in Details ging, als das Schamgefühl des durchschnittlichen Lesers es gestattete.162 Zwar erfuhr man nicht viel mehr über Sex als in einschlägigen Stellen bei Wieland. Dort hatten sich die Literaturrichter allerdings darauf geeinigt, es als Kunst zu betrachten, was man einem anonymen Dichter nicht verzeihen konnte. Die Schilderung des Liebesspiels von Arabelle und Lyonnel druckte Zschokke bereits 1791 in seinem Roman «Die schwarzen Brüder» ab, im Kapitel «Die Schäferstunde», bis zu jener Stelle, wo die reuevolle Arabelle seufzt: «O Lyonnel, was haben wir gethan!»163 Dazu gab Zschokke den Kommentar: «Eine in der Lage sehr gewöhnliche Frage der Damen; hätte lieber manche manchen gefragt: o Lyonnel, was wollen wir thun? es wäre vielleicht besser gewesen.» Im ursprünglichen Gedicht lautet die Antwort des Liebhabers auf Arabelles Seufzer bejahender:
«Frag nicht mehr: ,Lyönnel, was haben wir gethan?’ –
Gethan, was die Natur, was Gottes Engel sahn.»164
Wie eng Zschokke sich in seiner Versdichtung an Wieland hielt, zeigt eine ähnliche Szene im «Oberon». Dort entwindet sich Amanda dem Arm ihres Geliebten Hüon, nachdem sie sich gegen Oberons Weisung miteinander vereint haben: «Gott!» ruft sie aus, «was haben wir gethan!»165
Man mag sich über diesen Ausflug Zschokkes in die erotische Literatur wundern, die ihm einen Eintrag in Hayn/Gotendorfs «Bibliotheca Germanorum Erotica & Curiosa» einbrachte, in den Biografien aber schamhaft verschwiegen wird.166 Er experimentierte mit verschiedenen Literaturformen und sicherlich auch mit der eigenen Sexualität. Erotisch-schwüle Stellen in Romanen wurden zu jener Zeit, wie zu früheren und späteren Zeiten auch, begierig verschlungen und wirkten verkaufsfördernd. Es war für den Autor eine Gratwanderung abzuschätzen, wie freizügig eine Darstellung sein durfte. Die Liberalität oder Prüderie des Bürgertums und des staatlichen Zensors entschieden, ob ein Buch verboten wurde, in die öffentlichen und Leihbibliotheken aufgenommen wurde oder als galante Literatur unter dem Ladentisch gehandelt in Privatbibliotheken verschwand. Vielleicht trug diese Schwierigkeit dazu bei, dass man Zschokkes «Bibliothek nach der Mode» nirgends mehr findet und keine Fortsetzung erschien.
Die kleinere Schwester der Oper, eine Vorform der Operette, war im 18. Jahrhundert das Singspiel.167 Auch in diesem Genre, dem Theater näher als dem Versepos, versuchte Zschokke in Landsberg sein Glück. Unter dem schönen Titel «Meloda» verfasste er eine «dramatische Schwärmerei, aus den Zeiten der Kreuzzüge» in Jamben.168 Von seinem Freund, dem Landsberger Kantor und Lehrer Friedrich Gottlieb Teichert (* 1731), wurde es in Musik gesetzt und in Privatgesellschaften aufgeführt,169 vermutlich unter Beihilfe Burgheims und seiner geschrumpften Theatergesellschaft. Das war ohne übermässigen Aufwand möglich, da nur vier Personen vorkommen: der Eremit Michael und sein geistig zurückgebliebener Sohn Antonio, die in ihrer Klause Besuch von einer schönen Büsserin erhalten, Meloda, und von Fernando, einem Ritter, der seine Rüstung stets anbehält, als befinde er sich noch immer auf dem Kreuzzug. Das hat seinen dramaturgischen Grund: Fernando darf sich nicht zu früh zu erkennen geben; er ist der verschollene ältere Sohn des Eremiten und Melodas Geliebter, den sie in den Kriegswirren verloren hatte.
Die Handlung ist so nebensächlich wie in anderen Singspielen und Operetten auch; es wird in Versen gesprochen und einzeln und im Duett gesungen. Die Wiedererkennungsszene setzte Zschokke ganz an den Schluss, da Meloda, wenn Fernando auftaucht, entweder gerade den Schauplatz verlässt oder ohnmächtig herumliege. Sie findet dann aber herzergreifend statt und mündet in ein finales Gedicht, in das mit der letzten Strophe alle einfallen:
«Thränen sind der Freuden Würze,
Dämmerung verschönt des Glanzes Pracht;
Ja, wir glauben, dulden, hoffen,
Leiden still und unbetroffen:
Denn der Morgen dämmert hinter Nacht.»170
Es war Zschokke darum zu tun, in gefühlsbetonter Sprache, die oft aus einem kummervollen Herzen strömt, eine poetisch-wehmütige Stimmung zu erzeugen. Alles andere, das Dekor, die Choreografie, die Logik der Handlung oder die Glaubhaftigkeit der Charaktere sind Nebensache. Nach «Monaldeschi», dem lärmenden Eintritt, war «Meloda» der sanfte Abschied Zschokkes aus dem kulturellen Leben des neumärkischen Provinzstädtchens.
AUF DEM WEG ZUR UNIVERSITÄT
Ende 1788 war in Preussen die Reifeprüfung von der Universität an die Schulen verlegt worden. Die Prüfung fand in alten und neuen Sprachen, besonders aber in Deutsch statt, und sollte auch wissenschaftliche Kenntnisse umfassen, vornehmlich historische. Sie war unter dem Vorsitz eines staatlichen Kommissars schriftlich und mündlich abzulegen. Der Geprüfte erhielt ein Zeugnis seiner Reife oder Unreife; das Prüfungsprotokoll wurde dem Provinzialschulkollegium eingereicht.171
Um das Abitur abnehmen zu können, musste sich eine Schule als «Gelehrte Schule» qualifizieren. Der Rektor der Grossen Stadtschule in Landsberg, an der das Gymnasium eine kleine Abteilung war, bemühte sich nicht um diesen Status, da kaum Schüler direkt an die Universität gingen. Belegt sind über Jahrzehnte hinweg nur vereinzelte Fälle.172 Studienwillige Schüler verbrachten nach Beendigung der Schulzeit meist noch ein bis zwei Semester an einer auswärtigen Anstalt. Das Küstriner Konsistorium, das dem preussischen Oberschulkollegium über die Neumärker Schulen berichtete, empfahl, es dabei zu belassen, dagegen den Unterricht in allen Klassen «mehr auf nützliche Bürgerkenntnisse zu richten».173
Zschokke umging die Landsberger Stadtschule und begann, sich auf eigene Faust für das Abitur vorzubereiten. Dazu quartierte er sich zunächst beim Deichinspektor Runge ein, später bei einem Kaufmann Bunzel, und liess sich die Post, wie schon in Schwerin, an «Herrn Zschokke, Homme des lettres» adressieren. So war er zugleich Schüler und Gelehrter, eine Kombination, die ihm behagte, konnte er doch so seine Studien und Lektüre in alle Richtungen führen und zugleich selber schreiben. Unproduktiv war er nämlich auch jetzt nicht.
Während der Sommerferien lernte er zusammen mit einem jungen Landsberger, der ebenfalls an die Viadrina wollte, dem etwas jüngeren Johann Karl Weil (1771 oder 1772 bis 1821), Sohn des Regimentsquartiermeisters, der das Joachimstaler Gymnasium in Berlin besuchte. Vermutlich war auch der zwei Jahre jüngere August Ludwig Hahn (1773 bis nach 1846) in ihrer Lerngemeinschaft,174 Sohn eines Baudirektors, der ebenfalls das Joachimstaler Gymnasium absolvierte und sich erst im Oktober 1790, ein halbes Jahr nach Zschokke und Weil, an der Universität einschrieb. Karl Weil mochte Zschokke bewogen haben, nicht schon wie ursprünglich beabsichtigt im Herbst 1789 die Universität zu beziehen,175 sondern bis zum nächsten Frühling zu warten.
Dieser Aufschub liess sich gut nutzen, auch wenn Zschokke seine Ungeduld, endlich das Studium aufzunehmen und mit seinen ehemaligen Mitschülern gleichzuziehen, noch einmal zügeln musste. Der Besuch einer Universität kostete Geld, das er vorderhand nicht besass, weil der Vormund nicht gewillt war, Zschokkes Wartefrist abzukürzen. Erst im Februar 1790 erkundigte sich die Vormundschaftsbehörde bei der Landsberger Behörde über Zschokkes «Aufführung und Geschicklichkeit, um auf die Universität gehen zu können», worauf man ihn am 8. März vor den Stadtrat lud. Zschokke bat darum, «daß man ihn in Ansehung seiner Reife zur Universität examiniren und hierüber ein pflichtmäßiges Zeugniß ertheilen möchte».
Der Magistrat stellte daraufhin ein Prüfungskollegium mit Michael Dietmar Stenigke, Pastor an der Marienkirche und Schulinspektor von Landsberg, Benjamin Christoph Heinrich Opitz, Rektor der Stadtschule, und Konrektor Christian Friedrich Wentzel zusammen. Opitz legte die Termine fest: für die schriftliche Prüfung den 13., für die mündliche den 17. März, und verfasste darüber ein Protokoll, das mit allen Einzelheiten von Zschokkes Abitur von einem späteren Direktor des Landsberger Gymnasiums in den Schulakten gefunden und der Öffentlichkeit präsentiert wurde.176 Darin enthalten sind nur die offiziellen Dokumente, nicht die Vorgeschichte.
Für welche Fächer er sich vorbereitet hatte, geht aus seinem Brief an Stenigke vom 6. März hervor, worin er seine Situation schilderte und ihn bat, ihn «in der Lateinischen, Französischen Sprache, in der Weltgeschichte, Geographie, ältern und neuern Litteratur, Antiquitätenkunde, Mythologie usw» zu prüfen.177 Bis auf Latein und Französisch machte ihm der Stoff wohl nur wenig zu schaffen, und Latein konnte er sich notfalls selber beibringen. Aber in Französisch, der Hypothek am Beginn seiner schulischen Karriere, hatte er noch einiges zu verbessern und brauchte mindestens in der Aussprache und Konversation Unterstützung. Vielleicht holte er sich die bei Karl Weil, von dem ein anderer Schüler, der sich zur gleichen Zeit und mit dem gleichen Ziel in Landsberg befand, sagte, er sei «ein vortrefflicher Knabe, der viel wußte, bei dem Hofmeister des Obristen von Pape Unterricht erhielt und besonders in der französischen Sprache und in der Musik es sehr weit gebracht hatte».178
Die fünf schriftlichen Arbeiten sind im Programm des Landsburger Gymnasiums 1862 im Wortlaut abgedruckt, ebenso Informationen zu Zschokkes mündlichem Examen.179 Aus Ovids «Metamorphosen» übersetzte er jenen Teil, der von der goldenen Zeit handelt, als die Menschen die Erde zu bewohnen begannen (Aurea prima sata est ...),180 sicher und elegant, obwohl rurale, botanische und andere Begriffe vorkommen, die nicht zum gängigen Wortschatz gehörten. Der Übersetzung eines Abschnittes über die Kreuzzüge aus den in Schulen verbreiteten «Amusemens philologiques»181 – Schummels spannende Erzählungen aus 1001 Nacht waren nicht bis nach Landsberg gedrungen – spürt man hingegen seine Unsicherheit im Französischen an, während der Aufsatz über den Dreissigjährigen Krieg, «Abrégé de l’histoire de la Guerre de trente ans», stilistisch und inhaltlich erfreulich ausfiel und erstaunlich wenig grammatische und orthografische Fehler enthält.
In Latein hatte sich Zschokke mit dem Vergleich von Griechenland in der Antike und in seiner Zeit zu befassen. Man merkt sein Bestreben, eine grundsätzliche Frage herauszuarbeiten. Der erste Satz lautet (auf Latein): Die Schwäche menschlicher Bemühungen, der immerwährende Wechsel, der vom Anfang der Zeiten im Himmel und auf der Erde herrschte, zerstörte auch einst die blühenden Gegenden Griechenlands.182 Und der Schluss: Das heutige Griechenland ist daher nicht im geringsten das ehemalige, denn anhaltende Dummheit umgibt heutzutage den Geist der Bewohner.183 Dreissig Jahre später, im Zuge der philhellenischen Bewegung, die Zschokke in Wort und Tat (mit Zeitungsartikeln und Waffen) unterstützte, hätte er dies nicht mehr unterschrieben.
Der Titel des Deutschaufsatzes lautet «Landsbergs Gegenden». Erwartet wurde eine geografische Beschreibung der Umgebung der Stadt, die Zschokke von seinen zahlreichen Spaziergängen sehr gut kannte. Er unterlief diese Erwartung, setzte in Klammer «Eine Fantasie» und zeichnete ein Stimmungsbild des erwachenden Frühlings, den er in der Fremde (in Frankfurt [Oder]) nun nicht mehr erleben werde. Es war ein Wagnis, einen dichterischen Text abzuliefern, aber Zschokke schien sich sicher, dass es dem Prüfungsergebnis keinen Abbruch tun würde. Erstaunlicherweise hat es dieses Werk, an dessen Ende ein solider Deutschlehrer den Satz: «Thema verfehlt!» hätte schreiben können, in den Sammlungen deutscher Abituraufsätze zum Musteraufsatz geschafft,184 was wohl daran lag, dass der Verfasser im 19. Jahrhundert als ein bedeutender deutschsprachiger Schriftsteller galt.
Rektor Opitz erklärte, durch die Auswahl der literarischen Themen den Examinanden zugleich in Geschichte und Geografie geprüft zu haben, und fand in allen schriftlich gelösten Aufgaben «eine sehr rühmliche Fertigkeit und besondere Leichtigkeit Herrn Zschokke’s».185 Auch die mündliche Prüfung fiel zur allseitigen Zufriedenheit aus, wobei man sich die Mühe sparte, noch einmal neue Themen zu stellen.186 Zschokkes Maturitätszeugnis wurde vom Prüfungskollegium für das Magdeburger Vormundschaftsgericht auf Deutsch und für die Universität auf Latein ausgefertigt.187
Nach den Prüfungen ritt Zschokke nach Magdeburg, um seine Erbschaftsangelegenheit in Ordnung zu bringen. Es war sein erster Besuch in der Heimat seit über zwei Jahren, und er kam für die Verwandten völlig überraschend. Falls er befürchtete, man habe ihn vergessen oder überschütte ihn mit Vorwürfen, so wurde er angenehm enttäuscht: Man empfing ihn wie einen verlorenen Sohn, sah in ihm einen jungen, respektablen Mann. Bei dieser Gelegenheit sah er Friederike Ziegener wieder, die Tochter seines Vormunds, und sie gefiel ihm, zu einer jungen Frau erblüht.
Andreas Gottfried Behrendsen schilderte in seinen «Notizen aus meinem Leben» das Wiedersehen mit Zschokke, den ersten Kontakt seit dem Brief vom Juni 1789 aus Schwerin:
«Folgende Ostern kam er wieder zum ersten Male nach Magdeburg. Er klopft an, bringt eine Empfehlung von Herrn Zschokke, derselbe würde nächstens selbst nach Magdeburg kommen und mir persönlich aufwarten. Er hatte ein grau Jäckchen an, um den Kopf hundert Locken, einen Kopf höher war er gewachsen, seine Stimme männlich geworden. Nun konnt er sich nicht länger halten – er fiel mir um den Hals. Wir freuten uns beyde herzlich. So lange er in Magdeburg blieb, war er täglich bey mir.»188
Lange konnte Zschokke in Magdeburg aber nicht verweilen; es reichte nicht einmal zu einem Höflichkeitsbesuch bei seiner Schwester Lemme189 – oder hatte er nur keine Lust dazu? Zschokke war mit Karl Weil verabredet, um sich gemeinsam an der Universität zu immatrikulieren. Von diesem Weil, der auch «der Kleine» genannt wurde, ist bei Zschokke kaum mehr die Rede. Er studierte Jurisprudenz, wurde Polizei- und Stadtrat in Potsdam und starb 1821.

DIE VIADRINA UND IHRE PROFESSOREN
Am 22. April 1790 schrieb Zschokke sich an der Viadrina ein, zusammen mit Karl Weil und fünf weiteren Studenten aus Liegnitz in Schlesien und Stargard in Pommern. Rektor während des zu Ende gehenden Universitätsjahrs war Geschichtsprofessor Carl Renatus Hausen (1740–1805), der auch die Einschreibungen vornahm. In einer Festschrift zum 300-jährigen Bestehen der Viadrina schrieb Hausen über Zschokke, er sei unschlüssig gewesen, ob er Kameralistik oder Theologie studieren solle; Kameralistik habe seiner Neigung entsprochen, aber seine Familie habe sich für Theologie ausgesprochen. «Da er von dieser allein Unterstützung erwarten konnte, so gab ich ihm den Rath: er solle sich provisorisch als Theologe einschreiben lassen. Er folgte diesem Rath.»1 Hausen berief sich in der kurzen Biografie seines Lieblingsstudenten auf «authentische Nachrichten»,2 was bedeutet, dass er die Angaben direkt von Zschokke bezog, mit dem er korrespondierte, als diese Schrift entstand.3
In der «Selbstschau» bot Zschokke eine zweite Version an. Alle Fächer hätten ihn gleichermassen angesprochen, und so habe er bei seiner Immatrikulation zu Hausen gesagt: «Erlauben Sie, daß ich einsweilen unter den neun Musen freie Wahl behalte».4 Nur der Ekel vor dem Sezieren von Leichnamen habe ihn daran gehindert, auch noch die Medizin ins Auge zu fassen. Bezeichnenderweise gab er im Juni 1789 in Landsberg noch an, dass er Jurisprudenz ins Auge gefasst habe, und im März 1790 bestätigte er: «Ich werde entweder die Rechtswissenschaft oder schöne Wissenschaften studieren.»5
Zschokke beschloss, bei Hausen und nicht bei Steinbart zu wohnen, vielleicht weil Steinbarts Zimmer schon belegt waren oder weil er weniger bezahlen musste. Die Hoffnung, Steinbart würde ihn gratis beherbergen, hatte sich als trügerisch herausgestellt. Hausen besass ein zweistöckiges Haus an der Forststrasse 1, im Oberstock mit einer Anzahl kleiner nebeneinander liegender Zimmer, die von der Hofseite über eine Holzgalerie erreichbar waren. Daneben und darunter befanden sich grössere Räume, die auch für Vorlesungen genutzt werden konnten. Zschokke verewigte sich, vermutlich als er im März 1792 Abschied nahm,6 indem er Nägel in die Brüstung der Galerie trieb, welche die Initialen J. H. Z. ergaben. Im Jahr 1886 waren die Nägel noch sichtbar.7 Solche Markierungen mit der Bedeutung «Auch ich war hier!» waren ein weit über das Studentenmilieu hinaus gängiger Brauch, wenn auch gewöhnlich nur mit Tinte geschrieben oder mit einem Messer ins Holz geritzt.
Hausen las jedes Semester über deutsche Reichsgeschichte, alle zwei Semester über europäische Geschichte der Neuzeit und, falls genügend Anmeldungen eintrafen, über allgemeine Weltgeschichte, basierend auf seinem Lehrbuch.8 Ausserdem lehrte er europäische Staatskunde, für die Juristen deutsches, preussisch-brandenburgisches und europäisches Staatsrecht, im Sommer theoretische und im Winter praktische Kameralistik und las über Staatspolizei.9 Wahrscheinlich belegte Zschokke die kameralistischen Vorlesungen Hausens nicht schon in den ersten Semestern, da sie ein starkes Interesse an Staatswissenschaften und Verwaltungsfragen voraussetzten. Als junger Student erlebte und interpretierte er die Welt noch aus der Ich-Perspektive, aus einem individualistischen Erfahrungshorizont, und war zu sehr mit persönlichen, religiösen und ideellen Fragen beschäftigt, um sich auf die Staatsverwaltung im Detail einzulassen. Auch die historischen Vorlesungen Hausens, in denen der Professor gerne und ausgiebig aus Urkunden zitierte, waren wenig geeignet, daran etwas zu ändern.
Mit einem 22-köpfigen Lehrerkollegium und etwa 120 Studenten war die Universität überschaubar, das Verhältnis zu den Professoren war unkompliziert und leutselig.10 Dies wog einige Nachteile und Mängel auf, welche die Viadrina hinsichtlich Forschung und Lehre hatte. Es scheint, dass die Professoren bis auf Ausnahmen gut miteinander auskamen. Bei den kleinen Fachschaften galt es, sich gegenseitig auszuhelfen und vor allem nach aussen mit einer Stimme aufzutreten. An der theologischen Abteilung lutherischer Ausrichtung ging es an der Viadrina recht beschaulich zu und her.

Von 1790 bis 1792 wohnte Zschokke mit anderen Studenten bei Professor Hausen an der Forststrasse 1, hier von der Hofseite fotografiert. Über eine Aussentreppe und die hölzerne Galerie gelangte man zu den Stuben im ersten Stock.
Die meisten Theologiestudenten zog es an die Universität Halle, es sei denn, sie waren reformiert. Der brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund, der zur reformierten Konfession übergetreten war, hatte 1617 verordnet, die theologische Fakultät der Viadrina solle ausschliesslich dieser Glaubensrichtung dienen. Alle ordentlichen Professuren waren fortan für die Ausbildung reformierter Theologen reserviert.11 Lutheraner wie Zschokke mussten sich an der Viadrina mit ausserordentlichen Professoren begnügen, von denen eine einzige besoldet wurde. Hausen stellte in seiner 1800 erstmals erschienenen «Geschichte der Universität und Stadt Frankfurt an der Oder» aber klar, dass die theologischen Diplome der Viadrina jenen der Universitäten Halle und Königsberg gleich seien, da sie die Absolventen befähigten, in Preussen «alle geistlichen Ämter und die Predigerstellen bei den Regimentern auszuüben».12 Diese Qualifikation sagte freilich wenig über die Qualität der Ausbildung aus. Gotthilf Samuel Steinbart hatte seit 1774 eine unbezahlte theologische Professur, war aber zugleich ordentlicher Professor für Philosophie mit einem Jahresgehalt von 400 Talern.