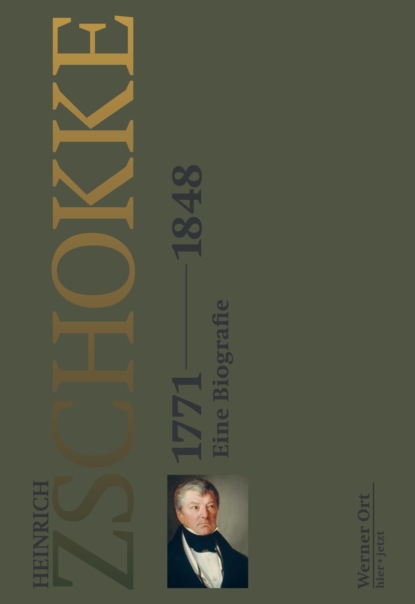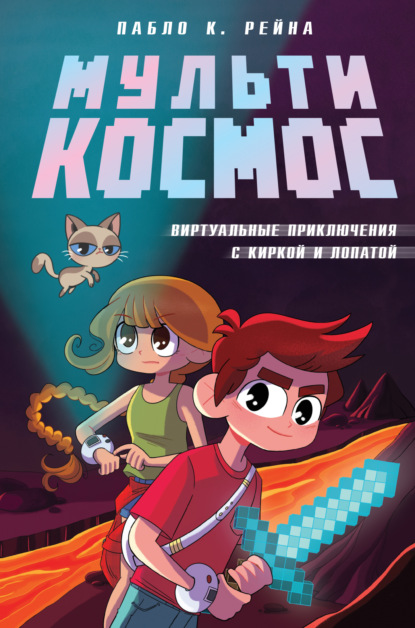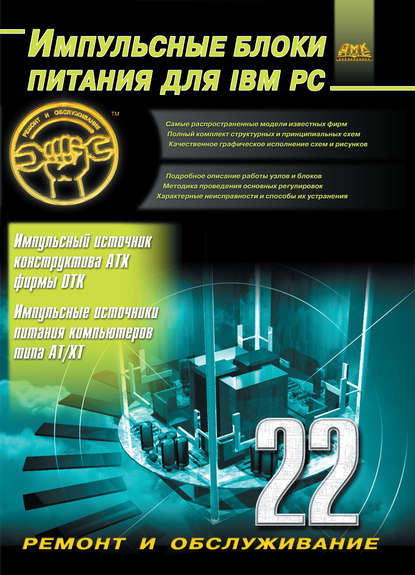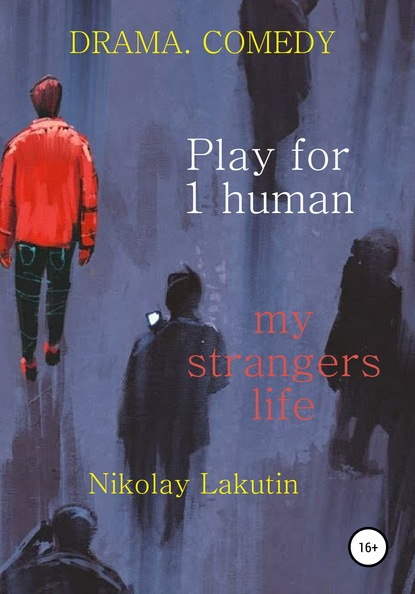- -
- 100%
- +
Man kann die «Schwarzen Brüder» als phantastischen Roman lesen und kommt auch dabei auf seine Rechnung. Diese Sichtweise schlägt Zschokke selber vor. Er habe stets die wundervollen Märchen des Orients geliebt und statt eines orientalischen Märchens ein deutsches geschrieben, statt Zauberer und Elfen «den geheimen Bund einer ausgebreiteten Gesellschaft» gezeigt und «wo mir der Wunder noch nicht genug waren, schuf ich neue».97
Den Roman voreilig auf den Trivialaspekt zu beschränken, wird vorab dem utopischen dritten Teil nicht gerecht, der voller philosophischer Überlegungen steckt und der Frage nachgeht, wie es Menschen erginge, die eine agnostische Weltanschauung lebten.98 Florentin schaudert es: «Religion und Moral, bürgerliche Glückseligkeit, Ruhe der Seelen – alles wird von diesem Ungeheuer verschlungen. [...] Es ist eine Philosophie, die zur Verzweiflung führt.»99 – Zschokke musste es wissen, kämpfte er doch selber damit. Der Glaube von einst sei zwar nur Ammenmilch gewesen, aber eine Milch, auf die man schwer verzichten könne.100 Auch in die ersten beiden Bände streute Zschokke Überlegungen und Argumente ein: zu sozialen Problemen, politischen Machenschaften, längst fälligen Reformen; sie enthielten auch eine veritable Kritik der Woellnerschen Edikte, die er aber stets als subjektive Meinung von Personen in der Romanhandlung darstellte. Die bedenklichsten Aussagen schob er dem Geheimbund der Schwarzen Brüder in den Mund: Gründe, die es rechtfertigten, dass ein Volk seinen Herrscher stürze.
«... soll der zertretne Wurm sich nicht krümmen dürfen unter den eisernen Fersen der Grausamkeit? soll das freigebohrne Volk seine geraubte Freiheit nicht wiederfodern dürfen?
O, es müssen viele Szenen vorangehn, ehe die Nazionen sich auflehnen, ehe die Liebe zu ihren Beherrschern ausgetilgt wird! Nur die Verzweiflung wagt erst einen solchen Schritt, aber dieser ist dann auch desto fürchterlicher!
Nur erst, wenn jede andre Hoffnung dem bedrängten Volke entschwindet, wenn eine ganze Reihe von Tyrannen und Tyranneien die Geduld desselben ermüdete, wenn neue Neronen zum Ruin des Landes ausgebildet, die traurigste Aussicht in die Zukunft darstellen, nur dann erst ist das Volk berechtet, eigenmächtige Veränderungen in seiner Regierung vorzunehmen.»101
Was bei Zschokke als Warnung an die Regierungen gedacht war, die Unterdrückung des Volks nicht auf die Spitze zu treiben, es nicht in Verzweiflung zu stürzen, aus der heraus sich seine Natur gegen den Herrscher auflehnen müsste, wurde im Roman zum Programm der Schwarzen Brüder. Ihre Absicht, insgeheim dem Volk zu helfen, seine Unterdrücker loszuwerden, gipfelt im Ausruf: «Es lebe republikanische Freiheit.»102 Ohne selber Stellung zu beziehen, arbeitete er in seinen Geheimbundroman aktuelle politische Fragen und Auseinandersetzungen mit ein, die sich im Zusammenhang mit der Revolution in Frankreich und der Stimmung in der Ära Woellner in Frankreich ergaben.
Zschokke erklärte in der Vorrede zum zweiten Band, er sei missverstanden worden, wenn man in den «Schwarzen Brüdern» versteckte Anspielungen auf Personen oder gar einen Schlüsselroman suche. «Viele denken sich unter den schwarzen Brüdern nichts geringers, als die Herrn Freimäurer, andre wieder einen Orden aus Kagliostros Fabrik; und beide Theile habens doch nicht getroffen!»
Das Buch wurde Zschokkes erster Bestseller, mit drei Auflagen und verschiedenen Raubdrucken bis 1802.103 «Es wird mit Ungestüm gelesen und verschlungen», schrieb Zschokke an Behrendsen.104 Er hatte sich den Ruf eines viel versprechenden jungen Romanciers erworben, der sich dadurch auszeichnete, dass er jedes Jahr zwei bis drei erfolgreiche Bücher zu produzieren in der Lage war. Seine Verleger versahen das Titelblatt seiner nächsten Romane mit dem empfehlenden Zusatz «vom Verfasser der schwarzen Brüder».105 Er hatte seinen ersten (und für viele Jahre einzigen) Roman in voller Länge geschrieben, durchkomponiert und zum Abschluss gebracht, ohne dass viele Fragen offen blieben, und, vor allem wichtig: Sein Buch konnte die Leser bis zum Schluss bei Laune halten.
Dennoch war Zschokke damit nicht zufrieden, vielleicht gerade weil sein Erfolg so gross war. Zeitlebens hatte er ein ambivalentes Verhältnis zu seinen belletristischen Werken, vor allem wenn er spürte, dass sie nur der Unterhaltung wegen gelesen wurden. Er sah sich als Aufklärer und Beweger, nicht als Entertainer. Dieser mentale Vorbehalt war sicherlich ein Grund dafür, dass er sein grosses Talent als Erzähler nie richtig zu schätzen wusste, es nie so pflegte, dass er auch stilistisch zu den gewichtigeren Schriftstellern seiner Zeit hätte aufschliessen können. Nach seinem Abschied aus Deutschland wurde für Zschokke das Erzählen mehr und mehr ein Mittel zum Zweck, Tendenzliteratur, so dass sein Talent immer seltener aufblitzte und schliesslich verkümmerte. Er sah später keinen Sinn mehr darin, dem Eskapismus Vorschub zu leisten. Aber in dieser frühen Periode seines Dichtens lebte Zschokke seine Lust am Fabulieren, Fantasieren und Philosophieren noch ungehemmt aus.
DOKTOR DER PHILOSOPHIE, MAGISTER DER SCHÖNEN KÜNSTE
Es könnte den Anschein haben, dass Zschokkes Studium über dem Dichten nicht vorangekommen sei. Aber er erwog nie, nur noch zu schreiben. Dazu schien ihm die Lage des Schriftstellers zu prekär. Ein Dichter war von der Laune des Publikums und des Literaturmarkts abhängig und seinen Verlegern ausgeliefert. War ein Buch erfolgreich, so konnte man darauf wetten, dass kurz darauf ein Raubdruck erschien. Ein Urheberrecht gab es nicht, auch keine Literaturpreise, die einen Dichter über Wasser halten konnten. In der Öffentlichkeit begegnete man den Schriftstellern mit Misstrauen und Geringschätzung. Sie galten als wenig kreditwürdig. Wie nüchtern Zschokke die Lage des freiberuflichen Schriftstellers einschätzte, zeigt sein Roman «Der Schriftstellerteufel».
Statt sein Studium zurückzustellen oder an den Nagel zu hängen, machte er sich vielmehr daran, es zu beschleunigen. Er besuchte weiterhin theologische Vorlesungen Steinbarts, konzentrierte sich aber stärker auf Philosophie und die schönen Künste, um statt in Theologie in diesen Fächern abzuschliessen. Das ersparte es ihm, sich vertiefte Kenntnisse in Griechisch und Hebräisch erwerben und mit den Religionswächtern des Ministers Woellner herumschlagen zu müssen, die in der lutherischen Fraktion der Viadrina immer noch durch Professor From vertreten waren.
Am 14. Mai 1791 wurde auf Woellners Betreiben und mit Rückgriff auf das Religionsedikt vom 9. Juli 1788 die geistliche Immediat-Examinationskommission geschaffen. Zu ihren Obliegenheiten gehörte die Prüfung der Geistlichen (einschliesslich der Feldprediger) vor ihrer Ordination beziehungsweise Anstellung. Die Pfarrer wurden verpflichtet, im Sinn der Orthodoxie zu predigen. Unter den gegebenen Umständen war es verständlich, dass Zschokke sich einer solchen Kommission nicht stellen wollte. Am 26. Januar 1792, mitten im vierten Studiensemester, wandte sich Zschokke an Dekan Professor Johann Gottlob Schneider (1750–1822) und die anderen Professoren der philosophischen Fakultät mit dem Gesuch, ihn den schriftlichen und mündlichen Prüfungen zur Erteilung eines Doktors der Philosophie und Magisters der freien Künste zu unterziehen. Die beiden Titel waren verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe,106 wurden an der Viadrina aber selten verliehen, weil nur wenige Studenten ihren Abschluss in Philosophie machten.107 Da zur philosophischen Fakultät die eigentliche Philosophie, aber auch die philologisch-literarischen, historischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen Gebiete und als Besonderheit der Viadrina die gut ausgebaute Nationalökonomie gehörten, musste, wer sich in Philosophie prüfen liess, einen Parcours durch alle diese Fächer (mit Ausnahme der Ökonomie) absolvieren.
Zschokke entschuldigte sich bei Schneider, dass seine Kenntnisse in Mathematik nicht ausreichten, um ein examen rigorosum zu bestehen, und bat «um gütige Nachsicht, besonders da ich von dem Werth derselben für die Philosophie zu sehr überzeugt bin, als daß ich auch künftig versäumen sollte, weitere und glüklichere Fortschritte in denselben zu machen».108 Hier waren die Professoren bereit, ein Auge zuzudrücken. Gravierender war Zschokkes Schwäche in den alten Sprachen, die auch hundert Jahre nach Christian Thomasius’ erster Vorlesung auf Deutsch (an der Universität Leipzig) missbilligt wurde. Zschokke gab Schneider unter vier Augen zu (teilte dieser seinen Kollegen mit), dass er in der Latinität ungeübt sei. Damit stellte Zschokke sein Licht unter den Scheffel, denn er konnte sich sehr wohl in Latein ausdrücken. Er kannte Schneiders strenge Massstäbe und wollte sich wohl einer scharfen Beurteilung entziehen, handelte sich aber erst recht Kritik ein. Schneider beanstandete zudem, dass Zschokkes Gesuch nicht auf Latein abgefasst sei. An Zschokkes Stelle würde er sich schämen, rügte auch Professor Huth, in einer solchen Angelegenheit deutsch zu schreiben. Überhaupt habe Zschokke sich noch zu wenig mit ernsthaften Wissenschaften abgegeben, um bereits als Gelehrter gelten zu können. Steinbart bedauerte ebenfalls, dass Zschokke sich für sein Studium nicht mehr Zeit genommen und sein Latein gefestigt habe. Diese Bemerkungen wurden auf Zschokkes Gesuch geschrieben, das unter den Professoren zirkulierte.
Was die Professoren also vor allem störte, war der frühe Anmeldetermin. Sich im vierten Semester reif für ein Magisterexamen zu halten, war stark; es setzte aussergewöhnliches Talent oder besondere Gründe voraus, und beides hatte Zschokke nicht vorzuweisen. Andererseits mussten sich die Professoren bei aller Eitelkeit im Klaren sein, dass sie einem jungen Mann nicht wesentlich mehr bieten konnten, als in vier Semestern zu lernen war. Daran trug die philosophische Fakultät selbst Schuld. Das Studium war nicht richtig strukturiert, und Steinbart fing seine für Anfänger gedachten Veranstaltungen alle zwei Jahre von vorne an. Was aber die sprachlichen Fähigkeiten betraf, so war ihr Erwerb Sache der Studenten und wurde nicht in besonderen Kursen gefördert. Man konnte einen Examinanden nicht gut abweisen, nur weil man vermutete, er sei fachlich ungenügend vorbereitet. Es sollte ja gerade das Ziel der Prüfungen sein, Zschokkes Sattelfestigkeit zu erfahren, namentlich in Latein. In diesem Sinn äusserte sich Professor Hausen, der sich beredt für Zschokke ins Zeug legte. Er gab es als seinen Fehler aus, dass die Eingabe auf Deutsch verfasst war, da er ihm gesagt habe, es komme nicht darauf an. Zschokke habe natürliche Fähigkeiten, sei in Geschichte nicht ungeschickt und habe dank privatem Fleiss seine Zeit an der Universität gut genutzt. Er musste es wissen, war doch Zschokkes Studierstube in seinem Haus an der Forststrasse stets mit Büchern übersät. Nachdem sie ihrer Verärgerung Luft gemacht hatten, lenkten auch die anderen Professoren ein. Professor Wünsch109 war bereit, sein naturwissenschaftliches Prüfungsthema wieder zu streichen, und auch Professor Huth willigte ein, Zschokke wegen seines «bekannten Fleißes und stillen guten Lebenswandels» zu prüfen, und zwar, wie die Kollegen, angesichts der schlechten Vermögenslage des Prüflings, auf dessen Bitte zu einer Gebühr von 24 statt der üblichen 40 Taler.110
Jeder Professor gab ein Thema vor – Steinbart aus der Logik und Huth ein mathematisch-philosophisches –, das Zschokke bis zum 10. März schriftlich zu bearbeiten hatte. Eine Woche darauf fand im Haus von Professor Schneider die mündliche Prüfung statt. Mehr erfahren wir von Carl Günther nicht, was darauf schliessen lässt, dass er in den Archiven von Breslau und Berlin auch nicht mehr fand als die Beurteilung, die er so zusammenfasst: Die Professoren seien nach der Prüfung «noch nicht sonderlich von den Fähigkeiten des Kandidaten entzückt» gewesen.111 Zschokke selber meinte sich nur noch zu erinnern, zwei seiner Examinatoren seien sich in die Haare geraten, «ich glaube der Gnostiker wegen».112
Ihr Vorbehalt hinderte die Fakultät nicht daran, beim preussischen Oberschulkollegium am 19. März die Erlaubnis einzuholen, Zschokke zum Doktor der Philosophie und Magister der freien Künste zu ernennen. Dank der Empfehlungen der Viadrina und der Tatsache, dass Steinbart in diesem Gremium sass, erhielt sie diese problemlos. Die Genehmigung erfolgte am 27. März,113 Zschokkes Diplom wurde auf den 24. März datiert.114 Das war der Tag, an dem die öffentliche Disputation seiner Dissertation «Hypothesium diiudicatio critica» stattfand.115
Diese Dissertation ist eine erkenntnistheoretische Abhandlung zur Bildung von Hypothesen und ihrer Klassifikation, 19 Seiten Latein, mit Thesen, die Zschokke gegen zwei Opponenten (seine beiden Freunde Gottlob Benjamin Gerlach und Johann Georg Marmalle) während mehr als drei Stunden verteidigte, notabene ebenfalls in Latein und sine praeside (ohne Vorsitz).116 Seine Dissertation erschien in üppiger Aufmachung und auf dickem Papier beim Universitätsbuchdrucker Apitz, mit einer lobenden Würdigung und Freundschaftsbezeugungen Marmalles und Gerlachs versehen, ebenfalls lateinisch.117 Nach Studentenbrauch wurde Zschokkes Abschluss enthusiastisch gefeiert. Marmalle und Hempel trugen ein Glückwunschgedicht vor, das sie ihm auch gedruckt überreichten.118
Bereits am nächsten Tag ritt Zschokke nach Küstrin, um, wie er in der «Selbstschau» schrieb, eine theologische Prüfung zu absolvieren und für die preussischen Staaten ein Diplom zu empfangen.119 Im Familienarchiv Zschokke in Basel befindet sich ein Dokument, geschrieben und unterschrieben von Johann Christian Seyffert am 26. März 1792, königlich preussischem Konsistorialrat, neumärkischem Superintendent und Inspektor und Oberprediger in Küstrin, dass er Zschokke an diesem Tag kraft seines Amtes die Erlaubnis erteilt habe, in Preussen zu predigen. Dies war nicht die ganze «Prüfung in seinen Kenntnissen zur Gottesgelahrtheit», wie Zschokke in den «Lebensgeschichtlichen Umrissen» schrieb,120 sondern nur das ius concionandi, die Öffnung zum Predigtamt.

Zschokkes Universitätsdiplom als Doctor philosophiae et liberalium artium (Doktor der Philosophie und der freien Künste), ausgestellt am 24. März 1792, am Tag seiner öffentlichen Disputation.
Nach seinem theologischen Examen kehrte Zschokke noch einmal kurz nach Frankfurt (Oder) zurück, räumte sein Zimmer bei Hausen, verabschiedete sich von den Freunden, trug sich in verschiedene Stammbücher ein und ritt oder fuhr dann nach Magdeburg. Im Abschiedsgedicht von Hempel und Marmalle vom 24. März schwingt Bewunderung für den erkämpften Titel und für das künftige Leben des jungen Doktors mit, das klar und hell erschien. Er werde nun ein halbes Jahr in Magdeburg bleiben, hiess es in poetischer Form, und dann nach Frankfurt zurückkehren, um Vorlesungen zu halten: «Juble mit uns! künftig sind wir Hörer, / Sind des ernsten Freundes Ruhmvermehrer –». Auch das Privatleben stellte sich in den rosigsten Farben dar: In Magdeburg erwartete ihn seine Auserwählte, Rikchen, mit offenen Armen: «Wie im Paradiese wirst Du leben, / Himmelsruhe wird Dich dort umschweben, / leere ganz den Freudenbecher aus!»121
Zschokke besass mit seinen 21 Jahren alles, was ein Student erträumte: einen akademischen Abschluss, eine Braut und eine glänzende berufliche Zukunft. Dazu kam ein wachsender Ruhm als Dichter, treu ergebene Freunde, kurz: eine rundum angenehme Perspektive. Darüber würden auch jene Wunden heilen, die Zschokkes Miene zuweilen noch verdüsterten, «tief geschlagen vom verlornen Glück», wie es im Gedicht heisst. Was wollten die Freunde damit andeuten? Die anhaltende Trauer um des Vaters Tod? Eine unglückliche Liebe? Der Abschied oder Tod eines geliebten Freundes?
IN DER VATERSTADT AUF DER KANZEL
Ermutigt durch seine beiden Gönner Hausen und Steinbart hatte Zschokke beschlossen, als Privatdozent an der philosophischen Fakultät zu wirken. Da die Eingabe für Vorlesungen im Februar erfolgen musste, hätte er es nicht mehr geschafft, sich für das Sommersemester einzutragen, falls dies sein Wunsch gewesen wäre. Stattdessen beschloss er, bis zum Herbst zu pausieren. Die Reise von Ende März 1792 nach Magdeburg war für ihn eine Rückkehr auf Zeit und auf Probe.
Er wohnte das halbe Jahr bei seiner Schwester Lemme an der Dreiengelgasse, womöglich wieder in dem Hintergebäude, wo er schon als Kind zwei Jahre verbracht hatte, diesmal aber mit anderem Vorzeichen: Jetzt war er repräsentabel und respektabel geworden. Er war nicht mehr der lästige kleine Bruder und Schwager, an dem man seine schlechte Laune ausliess. Sein Groll gegen die älteren Geschwister hatte sich längst gelegt; den ersten Band von «Schwärmerey und Traum» widmete er seinen Schwestern, und zu Neujahr 1791 hatte er Dorothea Lemme mit einem kurzen Gedicht überrascht, das er auf ein Nadelkissen schrieb und ihr zuschickte.122
Ein Umstand erhöhte Zschokkes Bekanntheit in Magdeburg beträchtlich: Mit seiner licentia concionandi in der Tasche predigte er an mehreren Stadtkirchen; eine Voraussetzung, falls er eine Pfarrstelle antreten wollte. Nun war dies vielleicht nicht sein eigentliches Berufsziel, aber das Predigen war eine gute Gelegenheit, sich als Redner zu üben und seine Wirkung auf ein grösseres Publikum zu studieren. Kanzel und Theater waren für Zschokke ja ebenbürtige Mittel, um die Menschen zu erziehen. Seine Mitarbeit an einer Wanderbühne war eine Episode gewesen und vielleicht auch nicht der geeignete Ort für eine Belehrung oder Bekehrung des Publikums; jetzt versuchte er es als Prediger, und es gelang ihm, legt man die «Selbstschau» zu Grunde, erstaunlich gut, die Gemeinde in Bann zu schlagen.123 Indem er predigte, geriet er selber in Rührung, und wenn er in den Zuhörern christliche Gefühle und Gottvertrauen weckte, überzeugte er sich selber ein Stück weit.124
Zufälligerweise starb während seiner Anwesenheit in Magdeburg Georg Andreas Weise,125 zweiter Pfarrer an St. Katharinen, der ihn unterwiesen und konfirmiert hatte. Auf Ersuchen seiner Witwe, behauptete Zschokke in der «Selbstschau», habe er einige Monate lang seine Predigten übernommen und sich, durch den Erfolg ermutigt, der Wahl für Weises Nachfolge gestellt. «Wenig, man sagt, nur eine Stimme, fehlte, die St. Katharinengemeinde hätte ihn zu einem ihrer Pastoren erwählt.»126 Eigenartigerweise fanden weder Carl Günther noch Pfarrer Kurt Haupt, der Historiker der Katharinenkirche, Zschokkes Namen im Kirchenarchiv in den Wahlakten.127 Haupt folgert daraus, dass Zschokke seine Bewerbung noch vor dem Wahlakt zurückgezogen haben könnte. Nachfolger von Weise wurde Christian Conrad Duhm, der zuvor Lehrer am Lyzeum in Brandenburg war, 1801 zum ersten Prediger an St. Katharinen gewählt wurde und sich 1815 nach Bardeleben versetzen liess.
Falls Haupts Annahme stimmt, lässt sich nur spekulieren, was Zschokke daran gehindert haben könnte, schon vor der Wahl aufzugeben. Von Behrendsen erfahren wir, dass er sich während seines Aufenthalts in Magdeburg mit Friederike Ziegener verlobte.128 Da ihr Vater als administrativer Kirchenvater im Vorstand der St. Katharinenkirche sass, hätte Zschokke gute Gründe und einige Chancen gehabt, dort Prediger zu werden. Vielleicht kamen ihm Bedenken, sich so früh schon zu binden, in Magdeburg zu bleiben und eine Familie zu gründen – er war ja erst 21 Jahre alt. Die sichere Zukunft, die Hempel und Marmalle ihm angesungen hatten oder die Vorstellung, ein Leben lang Glauben zu heucheln, war ihm womöglich nicht ganz geheuer. Dies war vielleicht auch einer der Gründe, der bei den Kirchenvorstehern gegen seine Wahl sprach. Zschokke führte ihn selber an: «seine allzugroße Jugend, hieß es, sey einigen der ‹Kirchenvätern› d. i. den Wahlherrn, anstößig gewesen».129 Der Unterschied zu dem frommen Vorgänger liess sich kaum übersehen. Zschokkes Christentum war philosophischer Art und gründete nicht auf dem Glauben, sondern auf dem Zweifel, der Vernunft und den Grundwerten der Ethik. Kants Moralphilosophie war nicht gerade das, was sich die Pietisten in der St. Katharinengemeinde für ihre Sonntagspredigt wünschten. Es mögen noch andere Vorbehalte gegen Zschokke vorgebracht worden sein. Vielleicht wurde ihm dies von Ziegener mitgeteilt, und er zog sich auf seinen Rat zurück, um eine Spaltung im Vorstand und in der Gemeinde von St. Katharinen zu vermeiden.
Noch nach über dreissig Jahren nagte es an Zschokke, dass man ihn damals nicht als Pfarrer haben wollte.130 Es war eine jener schmerzlichen Kränkungen, die er nur schwer verkraftete, was vielleicht auch dazu beitrug, dass er nach 1792 Magdeburg nie mehr aufsuchte und die Verlobung mit Friederike zwar nicht auf-, aber auch nicht einlöste. Mit Glockengiesser Ziegener blieb er noch einige Jahre in freundschaftlicher Verbindung – vielleicht ist dies ein Zeichen dafür, dass er wenigstens die Stimme seines ehemaligen Vormunds bei der Pfarrwahl bekommen hatte.
Seine Predigten brachten Zschokke mit einigen der bedeutendsten Magdeburgern in Kontakt. Er selber erwähnte den reformierten Pastor an der Heiligengeistkirche, Konrad Gottlieb Ribbeck (1759–1826), der 1805 nach Berlin berufen wurde und als Probst und Prediger an der Nicolai- und Marienkirche auch Beichtvater der Königin Luise und anderer Mitglieder der königlichen Familie wurde. Zschokke schätzte ihn als grossen Kanzelredner und schrieb 1795 über ihn: «Die Gewalt, welche er über Blik, Miene, Gebehrdenspiel und Stimmengang erworben hat, gehört zu den Seltenheiten.» Er fügte hinzu: «Die gebildeten Einwohner Magdeburgs wissen aber diesen Mann auch zu schäzzen. Sie haben ihn für immer an ihre Stadt gefesselt, und Ribbek ist dankbar.»131 Der zweite war Georg Samuel Albert Mellin (1755–1825), Prediger der Deutsch-reformierten Gemeinde und Kant-Interpret. Ribbeck und Mellin waren nicht nur erfolgreiche Theologen, sondern auch philosophisch gebildete Aufklärer, und es schmeichelte Zschokke, dass sie seinen Predigten Beifall zollten. Auch ehemalige Lehrer schlossen sich den Gratulationen an.132
In einem Brief an Lemme erwähnte er, dass er in Magdeburg mit viel Glück (Erfolg) moralische Vorträge gehalten habe.133 Ob er damit seine Predigten meinte, Vorlesungen in einer gelehrten Gesellschaft oder im familiären Rahmen, liess er offen; vielleicht stimmte er sich damit auch nur auf das künftige Wintersemester in Frankfurt (Oder) ein. Ein Verein, wo solche Vorträge angemessen gewesen wären, war die Freimaurerloge «Ferdinand zur Glückseligkeit». Hier fanden öffentliche Vorträge zu naturwissenschaftlichen und philosophischen Themen statt.134 Da Zschokke wahrscheinlich erst im Mai 1795 in die Kette trat,135 ist es ungewiss, ob er mit der Magdeburger Loge in Berührung kam, obwohl über Freunde und aus weltanschaulichen Überlegungen schon lange Verbindungen zur Freimaurerei bestanden.
In der Gelehrtenwelt und in der breiten Öffentlichkeit Magdeburgs hinterliess Zschokke keine Spuren, bis, mit einem Paukenschlag, Carl Döbbelin im April 1795 Zschokkes Erfolgsstück «Abällino, der grosse Bandit» zur Aufführung brachte. Döbbelin gastierte mit seiner Wandertruppe fast jedes Jahr in Magdeburg, auch von April bis Juli 1792. Obwohl wir darüber ebenfalls keine Kunde haben, dürfen wir davon ausgehen, dass Zschokke die Aufführungen nach Möglichkeit besuchte, und falls er es nicht tat, so erhielt er während der Messezeiten in Frankfurt (Oder) noch einmal Gelegenheit dazu.136
Zschokke schloss sich seinem Neffen Gottlieb Lemme an, der noch im Elternhaus wohnte und bis 1816 Junggeselle blieb, also über viel Freizeit verfügte. Sie frühstückten gemeinsam, sassen im elterlichen Garten auf einer Rasenbank, spazierten in den Parkanlagen, spielten Schach oder fochten mit dem Rapier.137 Mit Lemme liess sich das ungebundene Leben von Frankfurt (Oder) fortsetzen; hier fand Zschokke Verständnis für seine Dichtungen und seine extravaganten Ideen. Von Lemme brauchte er auch keine Vorwürfe zu befürchten, musste er seine Stimmungsschwankungen nicht verbergen. Wie eng er ihn ins Herz schloss, wie tiefe Einblicke in sein Inneres er ihm gewährte, zeigt ein Gedicht, das er ihm auf einem roten Seidenband im November 1792 zu seinem Geburtstag schenkte. Gemeinsam würden sie ihr Leid teilen, bis die Nacht vorbei sei und ein schönerer Morgen emporsteige. Auch in die Ewigkeit würden sie einst eng umschlungen eingehen.138
An das Gebäude in Lemmes Garten – vielleicht an die Mauer jenes Hinterhauses, wo Zschokke als Kind einquartiert war – schrieb Zschokke den Spruch: «Weinet nicht, denn Gott ist unser, unser ist das Los der Freundschaft, was bedürfen wir mehr, um den Traum des Lebens schön zu träumen!»139 In den «Schwarzen Brüdern» waren dies die Abschiedsworte der sterbenden Augusta von Gülden an ihre Freunde,140 für Zschokke magische Worte, die auch in die Gedichtsammlung «Feldblumen» aufgenommen wurden.141