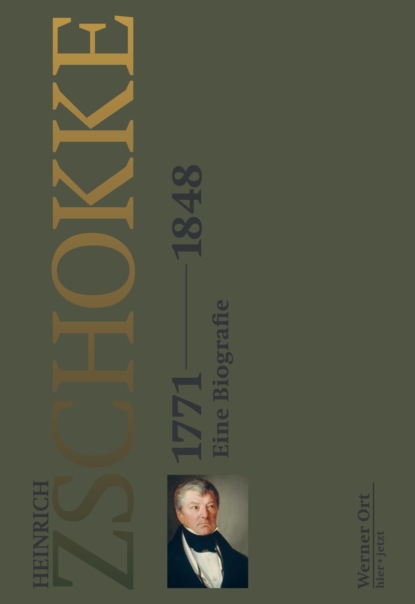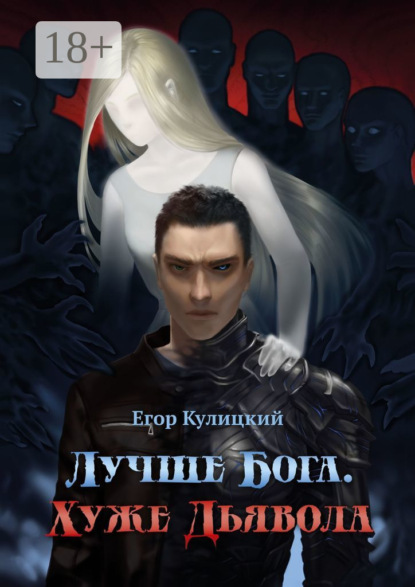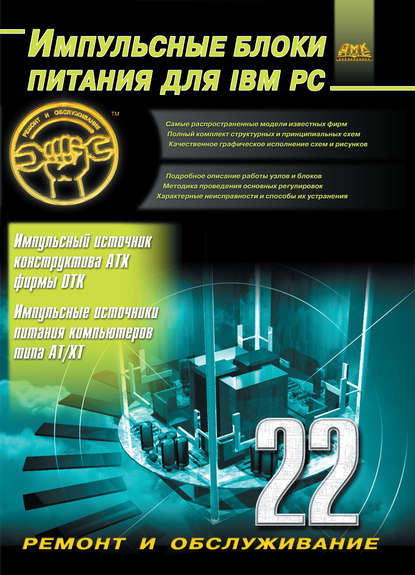- -
- 100%
- +
Andreas Gottfried Behrendsen, der sich zum zweiten Mal verheiratet hatte – Charlotte Eltzner, Zschokkes Cousine mütterlicherseits, war bei der Geburt des ersten Kindes gestorben –, fühlte sich von Zschokke vernachlässigt und beklagte sich bei ihm einmal darüber. Darauf sei Zschokke rasch auf ihn zugelaufen, habe ihm gedroht: «Ich werde Ihnen gleich das Maul stopfen!», und ihm einen Honigkuchen in den Mund gesteckt.142 Zschokke wurde Pate von Behrendsens Tochter, die am 30. September 1792 getauft wurde.143 Mit Fritz Schocke, dem ältesten Sohn seines Bruders, der ein Jahr später von Magdeburg wegzog, einem weiteren Gefährten aus der Kindheit, traf sich Zschokke wahrscheinlich ebenfalls hie und da, während der vierte im Bund, Heinrich Faucher, sich in Küstrin aufhielt, wo ihn Zschokke im Vorjahr aufgesucht hatte.144
Zschokke gewöhnte sich in diesem Sommer an den Müssiggang, was bei ihm nie mit Nichtstun oder Faulheit zu verwechseln ist. Er führte sein schriftstellerisches Werk weiter. Zwar kam 1792 ausser seiner Dissertation nichts an die Öffentlichkeit, aber das lag vor allem daran, dass er sich im vergangenen Jahr hauptsächlich auf die Prüfungen vorbereitet hatte. Jetzt war er von diesem Druck befreit und wandte sich dem zweiten Band der «Schwarzen Brüder» zu. Vermutlich ebenfalls in Magdeburg fasste Zschokke den Entschluss, seine neue Buchreihe «Bibliothek nach der Mode» zu eröffnen. Gemeinsam mit den «Schwarzen Brüdern» erschien der erste und einzige Band zur Ostermesse 1793 bei Johann Andreas Kunze in Frankfurt (Oder).

So adrett gekleidet und frisiert könnte sich Zschokke zu seiner Doktorprüfung und danach in Magdeburg präsentiert haben, um sich als vielversprechender Dichter und Gelehrter einzuführen. Porträt eines unbekannten Künstlers.
Von Magdeburg aus unternahm Zschokke längere Ausflüge, allein oder mit Begleiter, falls er jemanden dazu überreden konnte. Den Norden und Nordosten der Stadt kannte er bereits einigermassen, nicht aber den Westen und Süden, wenn man vom Ausreissen des 10-Jährigen nach Dessau einmal absieht. In den «Lebensgeschichtlichen Umrissen» erwähnte er «Lustreisen in die Waldthäler und Höhlen des Harzgebirges, in die paradiesischen Gärten von Wörlitz, in die Herrnhutergemeinde Barby, oder zum berühmten Bücherschatz von Wolfenbüttel».145
In der «Selbstschau» erläuterte er des Längeren, was er in Barby wollte und erlebte, und dass er gegenüber seinem Führer den Wunsch geäussert habe, selber Herrnhuter zu werden, was dieser ihm ausredete.146 Das passt so wenig zu seinen damaligen Einstellungen und Plänen, dass man seine Ausführungen nicht ganz ernst nehmen kann. Graf von Zinzendorfs Idee einer grossen heiligen Familie, in welche sich die erste Einfalt und Liebe des Urchristentums geflüchtet habe,147 die Vorstellung einer Gemeinschaft ohne Standes- und Rassen-, ja ursprünglich nicht einmal Geschlechtsunterschiede, zog ihn an. Der Gewissensdespotismus und das Treffen wichtiger Entscheidungen durch das Los, mit der «vernunftwidrigen» Behauptung, dass Gott darauf einwirke, stiessen ihn ab. Das brauchte ihm freilich nicht in Barby aufgegangen zu sein; es liess sich auch nachlesen. Auch seine Entscheidung, «die bisherige Geistesfreiheit jedem Klosterzwang, protestantischem wie katholischem vorzuziehn» und ein Weltkind zu bleiben,148 hatte er sicher nicht seinem Führer in Barby zu verdanken, sondern sich selber erarbeitet.149 Ohne Zweifel hatten der Ausflug nach Barby und ein zweiter in den Harz für Zschokke eine grosse Bedeutung.
Von seiner Harzreise erhalten wir einen kleinen Einblick dank einem Aufsatz, den er 1793 publizierte: «Die Baumannshöhle im Harz. (Bruchstük einer Reisebeschreibung.)».150 Die Reise ging über Wernigerode und Elbingerode zum Brocken. In mystischer Überhöhung schildert er seine Empfindungen im Anblick von Wernigerode und der Gebirgskette des Harzes:
«Still wars am Himmel und auf Erden; die Natur feierte das Fest ihrer Schönheit, und meine Seele war Harmonie mit dieser Natur. Verherrlichung Gottes strahlte herab von den Felsen, herab vom Himmel. Der Gesang der Vögel in den Gebüschen, das Murmeln verstekter Quellen verherrlichte Gott! die fallende Blüte, das einsame Veilchen der Wiese, der schwirrende Käfer verherrlichte Gott! Und, hingerissen von diesem begeisternden Anblik, übermeistert von den Gefühlen der Bewunderung und Liebe, betete ich an, in der großen Kirche der blühenden Natur und Gott hörte gewiß mein flüsterndes Gebet, sah gewiß die Thräne, welche meinem Auge entstürzte – denn mir ward so wohl!»151
Hier kommt Zschokkes Sehnsucht nach der Unmittelbarkeit der Gotteserfahrung zum Ausdruck, sein Bedürfnis, in und hinter der Natur einen tieferen Sinn, die Weisheit Gottes, Gott selber zu erkennen. Die Harzreise gab ihm eine neue Dimension der Naturerfahrung, die ihm als Kind in Brockes’ Lehrgedichten nicht zugänglich gewesen war. Das Erleben der Natur wirkte seinem drohenden Nihilismus in den existentiellen Fragen nach dem Woher, Wohin und Wozu entgegen. Die Natur wurde für Zschokke die zweite Offenbarung Gottes; hier erahnte er, was in der mit menschlichen Schwächen behafteten Kirche, im Pietismus oder bei den Herrnhuter nicht zu finden war: die sinnliche Idee der Religion, das Christentum des Lebens.
Infolgedessen musste auch die Beschreibung dieser Natur zum priesterlichen Amt werden, eine Verkündigung Gottes in der Leuchtkraft der Sprachbilder, der Intensität des Gefühls, im Ausgreifen über den persönlichen Horizont und Alltag hinaus in eine inspirierte Welt. Eigentlich wäre bei Zschokke zu erwarten gewesen, dass eine solche Erkenntnis eine Flut von Gedanken und Publikationen ausgelöst hätte – das war vorerst nicht der Fall. Der Mensch blieb in dieser gottbeseelten Natur für Zschokke noch ausgespart; er war ein staunender Beobachter, als Aussenseiter auf sich selber zurückgeworfen.
Um es vorwegzunehmen: Jahre später, auf der Terrasse des Schlosses Reichenau, beim Anblick des Zusammenströmens von Vorder- und Hinterrhein, wurden ihm auch das Wesen und der Sinn des Menschen in Gottes Natur greifbar, in einer kosmologischen Vision, die den religiösen Zschokke prägte und ihn bis zu seinem Tod nicht mehr losliess. Alexander von Humboldts «Kosmos»,152 hiess es, war die Lektüre, die in den letzten Jahren seines Lebens aufgeschlagen auf seinem Schreibpult neben der Bibel lag.153
PRIVATDOZENT UND GELEHRTER
Mitte Oktober 1792 kehrte Zschokke nach Frankfurt (Oder) zurück, nach einem kurzen Aufenthalt in Potsdam, wo er Gottlob Benjamin Gerlach besuchte, und in Berlin, wo er einige Tage bei Johann Georg Marmalle verbrachte. «Nie hat in meinem Leben ein Abschied tiefern, schmerzlichern und bleibendern Eindruk auf mein Herz gemacht – als der lezte von Euch. Gott wolle, daß ich kälteres Blut bekomme, es wird mir nüzlich sein!», schrieb er seinen Verwandten und den befreundeten Familien Mehl154 und Ziegener.155 Am 22. Oktober begann das Semester an der Universität. Zschokke bot an der philosophischen Fakultät vier Vorlesungen an: Ästhetik nach Eberhard,156 Kirchengeschichte, Moralphilosophie nach Schmid157 und eine Auslegung der vier Evangelien. Er gefiel sich darin, nicht mehr Student, sondern Privatdozent zu sein. Sein Anfang war viel versprechend:
«Der 29t October erschien. Es schlug 11 Uhr zu Mittag: ich hörte das Getümmel der die Treppen heraufdonnernden Studenten, hörte ihre sonorischen Stimmen ihre klirrenden Spornen[!]. Holla, dacht ich[,] da kömmt das wüthende Heer! – Ich meditirte in der Eil auf eine schikliche Anrede, zur Eröfnung meiner Vorlesungen, nahm meine Hefte unterm Arm, trat ins Auditorium[,] bestieg mit vieler Eleganz und Autorität das Katheder und hielt eine kurze Rede an die versammleten Zuhörer, deren Liebe und Freundschaft ich mir zum Lohn meiner Bemühungen für sie ausbat.
Ich gefiel den Studenten in der Anrede und machte mit meinem Vortrag der wissenschaftlichen Gegenstände hier fast eben so vieles Glük, als in Magdeburg durch meine moralischen Vorträge. Meine Collegia waren von diesem Tage an, der für mich für iede Zukunft entscheidend sein mußte, gut besezt, und allein in der Kirchengeschichte hab ich über 20 Zuhörer – welches hier auf der Universität viel sagen will[,] da die theologische Fakultät am schlechtesten besezt ist, und zweitens ein älterer Lehrer, als ich[,] nämlich ein Doktorandus Dettmers158 eben diese Wissenschaft zu gleicher Zeit vorträgt, der aber nur etwa ein halbes Duzzend Studenten hat, die dies Collegium bei ihm besuchen.»159
Eine weitere Kollision, wenn man so sagen will, ergab sich mit Steinbart, der zur gleichen Zeit wie Zschokke – nachmittags zwischen zwei und drei Uhr – Ästhetik nach seinem Buch160 vortrug. Aber auch hier stellte Zschokke mit Genugtuung fest, er habe ebenso viele Zuhörer wie sein Professor.
«Allein alles dies erregt gewiß wieder den Neid der mich schon in Magdeburg verfolgte. Zwar entdekke ich noch keine Spuren, aber ich glaube immer, es wird sich über lange oder kurze Zeit ein Ungewitter über mich zusammenziehn! – Doch, das macht mich nicht bange. Ich stehe da vor Gott und Menschen mit einem guten Gewissen, mit einem eisernen Fleis gutes zu stiften – und ist Gott für mich, wer will wieder[!] mich sein?»161
Er sei, schrieb er Lemme, «iezt wieder Gelehrter oder vielmehr iezt will ichs in der That werden». Damit spielte er auf die sieben Monate in Magdeburg an, die anderen Dingen als dem Studium gewidmet waren. Er beschränke sein Leben aber auch jetzt nicht auf die Universität. Kaum einen Abend sei er in seiner Stube – damit meinte er möglicherweise bereits seine Wohnung an der Oderstrasse in der Nähe der Universität, wo er sich als Privatdozent einquartierte162 –, sondern verbringe seine Freizeit in Gesellschaften, die er sich selber ausgewählt habe, und sei dabei vergnügt, so gut es ihm möglich sei.163
Die Gesellschaften, von denen Zschokke hier schrieb, waren private Einladungen der Professoren oder Treffen in familiärem Kreis: beim Ehepaar Hausen an der Forststrasse 1 und schräg gegenüber, an der Forststrasse 3, wo der Universitätsbuchdrucker und Verleger Christian Ludwig Apitz (1763–1828) und dessen Frau Sophie wohnten. Mit Apitz eng befreundet war das Ehepaar Schulz an der Schwertfegergasse (nachmals Kleine Scharrnstrasse); die beiden Frauen waren Schwestern. Schulz war Stadtchirurg und hatte mehrere Töchter; eine hiess Johanna Elisabeth und war ein Jahr älter als Zschokke. Er verliebte sich heftig in sie, und sie scheint seine Gefühle erwidert zu haben; unglücklicherweise war sie schon dem 15 Jahre älteren Juristen Christian Gottlieb Jachmann (1755–1798) versprochen.
Mit der Familie Schulz verbrachte Zschokke viel Zeit, ebenso mit der Familie von Kaufmann Karl Friedrich Harttung (gest. 1827), Inhaber eines Wachswarengeschäfts. Vor allem dem Söhnchen Karl («Karlchen») Harttung (1790–1866) war Zschokke eng verbunden. Hier, aber auch beim Ehepaar Apitz, setzte er seine Praxis fort, Gedichte zum Geburtstag, Neujahrs- oder Hochzeitstag auf ein seidenes Band zu schreiben.164 In seinen Briefen redete Zschokke die Ehepaare Schulz und Apitz mit Cousin und Cousine an; dies erhöhte für ihn den familiären Bezug ihrer Freundschaft.
Diese geselligen Zusammenkünfte in Frankfurt (Oder) könnte man mit den Salons in Berlin vergleichen, obwohl der Teilnehmerkreis kleiner, familiärer und die Zusammensetzung der Gäste konstanter war. Sie ergaben sich aus dem Bedürfnis des bürgerlichen Mittelstands nach Austausch und Unterhaltung einerseits, und aus dem Bestreben von Professoren wie Steinbart, Huth, Hausen, Berends und Wünsch andererseits, Studenten um sich zu scharen und durchreisende Gelehrte und Dichter einzuladen. Alle drei Arten der Geselligkeit, die gelehrte, die schöngeistige und die familiäre, waren für den jungen Akademiker und Dichter eine sinnvolle Ergänzung. In einem Brief ihres Mannes an Zschokke umschrieb Frau Hausen im Postskriptum, welches Zschokkes Platz in ihrer Runde gewesen war: «Glauben Sie, daß in unserem kleinen Zirkel zu welchem wie Ihnen bekannt Mad. Müller, Minchen Badernoc und meine zwey Kinder gehören, die sich Alle Bestens empfehlen, ein leerer Raum ist. Bald erinnert das Fortepiano an das genossene Vergnügen, bald die Sommerstube, ersteres an Ihre angenehmen Vorspielungen, letzeres an Ihre oft muntere und scherzhafte Unterhaltungen, die wir alle so gerne hörten.»165
Der Mittwoch von fünf bis sieben Uhr war bei Zschokke für Sitzungen der Königlichen Sozietät der Wissenschaften reserviert, die bei Hausen an der Forststrasse stattfanden. Hausen hatte seit 1791 den Vorsitz der 1766 von Professor Darjes166 gegründeten «Gelehrten Gesellschaft zum Nutzen der Künste und Wissenschaften»167 übernommen. Diese Runde brachte Akademiker, fortgeschrittene Studenten und Anfänger zu wöchentlichen wissenschaftlichen Gesprächen zusammen. Kurz nach Übernahme des Präsidiums schaffte Hausen die Aufnahmegebühren und jährlichen Beiträge ab, mit der sich die Gesellschaft bisher finanziert hatte, «da unter den armen Studierenden oft die besten Köpfe seyn konnten», die solche Gebühren nicht bezahlen konnten.168 Studenten, deren wissenschaftliche Ausbildung man fördern wollte, wurden als Adjunkte aufgenommen, als erster am 7. Dezember 1791 der Kandidat der Philosophie und Gottesgelehrtheit Johann Heinrich Daniel Zschokke. Hausen schrieb über ihn: «Er besuchte die Versammlung unausgesezt und stiftete vielen Nutzen.»169 Kurz vor seiner Abreise, am 4. Mai 1795, wurde Zschokke «wegen seines in den schönen Wissenschaften sich erworbenen Ruhms und Verdienstes» zum ordentlichen Mitglied erhoben.170 Weitere Adjunkte aus Zschokkes Freundeskreis waren Gerlach, Hempel oder Marmalle.
«Von den drei Jahren, die ich nun in Frankfurt, als akademischer Privatdocent, verlebte, läßt sich wenig berichten», schrieb Zschokke in «Eine Selbstschau». «Sie verflossen arm an Ereignissen, doch nicht ohne Anmuth.»171 Wenn er unter «Ereignissen» seine religiöse Entwicklung verstand, so hatte er Recht; in dieser Hinsicht fand nicht mehr viel statt. Auch in seiner akademischen Karriere kam er nicht voran, jedenfalls nicht so schnell, wie er es sich vorgestellt hatte. Was seine literarische Tätigkeit und seine Vorlesungen betrifft, die in diesen Jahren gewiss seine hauptsächlichen Aktivitäten waren, so schienen sie ihm nachträglich kaum der Rede wert. Dennoch geben sie einige interessante Einblicke in seine Biografie.
Jedes Semester bot Zschokke von elf bis zwölf Uhr morgens eine Vorlesung über Kirchengeschichte an, nicht an der theologischen Fakultät, wo er nicht zu lehren berechtigt war, sondern bei den Philosophien in der Unterabteilung «historische Privatlektionen». Weiter las er im Sommer über christliche Altertümer.172 Als philologische Privatlektionen gab er eine Auslegung von Büchern des Alten und Neuen Testaments: einmal der vier Evangelien, ein andermal der katholischen Briefe, der Apokalypse und der Briefe von Paulus an die Römer. Auch philosophische Privatlektionen kündigte er an: in seinem ersten und in seinem letzten Semester zur Ästhetik – das zweite Mal nach seinem Buch «Ideen zur psychologischen Ästhetik» (1793)173 –, ferner zur Moralphilosophie nach Schmid174 und zur natürlichen Theologie. Im Sommer 1793 gab er eine Vorlesung über Rhetorik und Dichtkunst175 und im Winter 1793/94 eine weitere zur Philosophiegeschichte von der ältesten bis zur neueren Zeit.
Zschokke kündigte jedes Semester als Dozent drei einstündige tägliche Vorlesungen an, im ersten Semester 1792/93 sogar vier. Ob er sie tatsächlich hielt, hing vom Interesse der Studenten ab; offenbar bestand durchaus eine Nachfrage. Zschokkes Vorlesungen waren beliebt, was an seiner Jugendlichkeit und der Frische des Vortrags, am Inhalt, der strikt rationalen Sicht auf die Religion und der Kritik an der Kirche lag. Wenn Zschokke in «Eine Selbstschau» behauptete, er habe alles vermieden, um den Gemütsfrieden der Jünglinge nicht durch Zweifel zu erschüttern,176 so meinte er damit wohl nur Zweifel am Glauben, nicht aber an der Kirche und ihren Dogmen.
Bei Zschokke wussten die Studenten, dass er gegenüber Woellner und dem Religionsedikt kein Blatt vor den Mund nahm. Sie bekamen Wahrheiten über die Kirche bei ihm zu hören, die andere Dozenten nicht oder nur verblümt zu äussern gewagt hätten. Als ihn Behrendsen nach seiner Abreise in die Schweiz fragte, ob ihn diese kritische Einstellung zur Kirche seine Professur gekostet habe, widersprach er: «Daß mich meine Heterodoxie vom Catheder gebracht hat, ist ein Mährchen, sie hat mich vielmehr hinauf gebracht.»177 Später behauptete er allerdings das Gegenteil,178 was seither in alle Darstellungen perpetuiert wurde. Erst Carl Günther begann aufgrund der Aktenlage diese Version wieder in Frage zu stellen,179 leider ohne dass seine Erkenntnis in der Zschokke-Literatur Spuren hinterliess.
Der Studienführer von Rebmann,180 der 1794 unter dem Titel «Katheder-Beleuchtung von Justinus Pfefferkorn» erschien, stellte an der Viadrina neun ordentliche Professoren und als einzigen Privatdozenten Heinrich Zschokke vor.181 Über ihn ist zu lesen:
«Ein junger talentvoller Mann, der sich zu einem guten akademischen Lehrer mit vielem Fleiß und Glück bildet. Er ist weit entfernt, seinen ehemaligen Lehrern nur geradezu nachzubeten, wie bey angehenden Dozenten nur allzuoft der Fall zu seyn pflegt, sondern er denkt selbst sehr scharfsinnig über jeden Gegenstand, den er ergreift, besizt eine für seine Jahre außerordentliche Belesenheit in verschiedenen Fächern der Gelehrsamkeit, womit er einen durch das Studium der schönen Wissenschaften gereinigten Geschmak verbindet. Er ist selbst Dichter, und eines seiner kleinen frühern Werke ist zur Lieblingslektüre der Deutschen geworden. Seinem Vortrag weiß er aus dem üppigen Reichthum seiner Fantasie vieles Interesse zu geben; es fehlt ihm nicht an Würde, Praezision und Deutlichkeit, nur daß er zuweilen durch das ihm eigene Feuer verleitet wird, zu schnell zu sprechen, ein Fehler, für den er seine Zuhörer schadlos zu halten weiß.»182
Rebmann, der als Zeitungsredaktor in Dresden lebte, konnte die Daten über die sieben berücksichtigten Universitäten nicht alle selber erheben; er hatte Zuträger, vermutlich fortgeschrittene Studenten oder Dozenten, und jener, der von der Viadrina berichtete, ergänzte zu Zschokke: «Im gesellschaftlichen Leben ist er freundschaftlich und gefällig, und eine gewisse sanfte Schwermuth, die ihm eigen ist, leiht seinem Umgange manchen Reiz, der dem Herzen wohl tut.»183
Er habe sich, schrieb Zschokke in «Eine Selbstschau», um dem «Schattenreich der Metaphysik» zu entkommen, in seiner Dozentenzeit «mit ganzer Macht auf das Studium der sogeheißenen Realwissenschaften; auf Naturkunde, auf Finanz-, Polizei-, Forstwesen und neueste Zeitgeschichte» gestürzt.184 Es gibt kaum unmittelbar Zeugnisse – Briefe, Aufsätze, Vorlesungsskripten oder Aussagen Dritter –, die belegen, dass Zschokke sich in Frankfurt (Oder) tatsächlich ernsthaft mit ökonomischen und staatspolitischen Themen befasste. Nachweisbar ist einzig seine Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass in der zweiten Periode an der Viadrina sein Interesse an der Kameralistik erwachte und eine teilweise Umorientierung von der Metaphysik und Theologie zu den Realwissenschaften stattfand, die aber erst in der Schweiz manifest wurde.
IDEEN ZUR PSYCHOLOGISCHEN ÄSTHETIK
Über ästhetische Fragen hatte Zschokke schon längst Ideen entwickelt. Unter dem Eindruck von Steinbarts Vorlesung über Ästhetik im Sommersemester 1790 schrieb er für den «Theaterkalender auf das Jahr 1791» einen Aufsatz über relative Schönheit, worin er darlegte, dass es sich bei der Beurteilung des Schönen um eine Geschmacksfrage handle, also eine subjektive Angelegenheit, und es daher von Intoleranz zeuge, wenn Kritiker ihre Meinung anderen als die einzig richtige aufdrängten. Besonders treffe dies bei Theaterstücken zu. «Ich wünschte diesen Zeilen die allgemeine Beherzigung der Kritiker und Kenner und man würde aufhören die Journale zu Tummelplätzen der aus Irrthum sich hassenden Schönheitsbeurtheiler zu machen!»185
Andererseits hatte sich Zschokke selber als Beurteiler und Verfasser von Dramen um Kriterien bemüht, nach denen die Qualität eines Theaterstücks und einer Theateraufführung bemessen werden konnte, und das hiess, ästhetische Massstäbe anzulegen. Man kann das Zeitalter der Aufklärung auch als eines der Ästhetik sehen und die Ästhetik neben der Geschichtswissenschaft und der Anthropologie als dritte grosse neue Disziplin im System der Wissenschaften des 18. Jahrhunderts.186 Ästhetik ist dabei zunächst in einem weiteren Sinn zu verstehen, als eine Wissenschaft der Wahrnehmung oder der sinnlichen Erkenntnis (scientia cognitionis sensitiva), wie Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), der Begründer der Ästhetik als einer philosophischen Disziplin, sie in seiner «Aesthetica» von 1750 definierte.
Im engeren Sinn war Ästhetik mit der Frage verknüpft, wieso etwas als schön oder hässlich empfunden werde, und welcher Mittel es bedurfte, um diese Wirkung zu erzeugen. Darum ging es auch Zschokke, als er 1793 sein Buch «Ideen zur psychologischen Aesthetik» schrieb, das zur Herbstmesse im Buchhandel erschien.187 Er konnte sich dabei weitgehend auf das Lehrbuch von Steinbart abstützen, den er bald als «mein grosser Lehrer»,188 bald als «würdiger Mann» oder «achtungswürdiger Weltweiser»189 bezeichnete, ohne sich inhaltlich aber stark auf ihn zu beziehen.
Zschokke umschrieb das Prinzip der Ästhetik mit der Formel «freie Mittheilung schöner Empfindungen»190 und setzte sich als Ziel seiner Untersuchung die Beantwortung der Frage: «Wie und wodurch werden schöne Empfindungen mitgetheilt?»191 Gerade diese Frage nach der Produktion des Schönen vermochte er aber nicht zu beantworten, da ihn die Hauptfrage der ästhetischen Philosophie, was das Schöne sei und wie die Menschen darauf reagierten, zu lange aufhielt.192
Zschokke führte in seinen «Materialien für eine künftige Ästhetik»,193 wie er sein Buch bescheidenerweise nannte und zu dessen Vollendung er «eine Meisterhand» wünschte,194 eine beachtliche Anzahl von Autoren und Werken an, beinahe hundert, die er teils nur als Literaturangabe heranzog, teils einzelne Punkte herausgriff, um ihnen das für ihn Wichtige zu entnehmen. Er entwickelte seine eigene Theorie des Schönen und der Schönheit, «die, was sie in einer psychologischen Ästhetik sein mus, praktisch ist für den edeln Künstler, fruchtbar ist an Gesezzen für ihn, die ihn nie irren lassen».195 Das war ein Anspruch, den er in keiner Weise einlöste. Immerhin gelang es ihm, die Bedingungen aufzuzeigen, unter denen ein Kunstwerk als solches gesehen werden konnte, und die Wirkkräfte auf die Rezipienten herauszuarbeiten.
Er bediente sich ähnlicher Begriffsdefinitionen und Gedankenabfolgen in Paragrafenform, wie er sie von Steinbarts «Grundbegriffen zur Philosophie über den Geschmack» und Platners «Philosophischen Aphorismen» kannte. Auch sonst profitierte er viel von diesen beiden Autoren, stützte sich wie Steinbart auf die beiden Klassiker der deutschen Ästhetik, Alexander Gottlieb Baumgarten und Johann Georg Sulzer, zusätzlich auf Immanuel Kant, Karl Heinrich Heydenreich, Henry Home, Carl Christian Erhard Schmid und andere, ging aber sonst seinen eigenen, man könnte sagen, eigenwilligen Weg. Sein Ausgangspunkt war eine Anregung Kants in der zweiten Auflage seiner «Kritik der reinen Vernunft», die Ästhetik teils transzendental, teils psychologisch aufzufassen.196
Zschokke wollte die psychologische Ästhetik zu einer eigenständigen Disziplin werden lassen, zu der er «Ideen» oder, wie er an anderer Stelle meinte, «kleine aphoristische Abhandlungen und einzelne Bemerkungen über Gegenstände der Kritik des Geschmaks» beitrug, «welche theils beim Lesen verschiedner Schriftsteller der Ästhetik, theils während meines Aufenthalts in Meklenburg, durch Betrachtung der Natur- und Kunstschönheiten, woran dieses glückliche Land so reich ist, und die dort in mir zu allererst das Gefühl des Schönen entwickelten und bildeten, theils durch meine Vorlesungen über Herrn Prof. Eberhards Theorie der schönen Wissenschaften veranlaßt wurden».197
Er postulierte ein Grundbedürfnis aller Menschen, anderen ihre Empfindungen mitzuteilen. Empfindungen sinnlich mitzuteilen und darzustellen sei auch die Quelle der schönen Künste,198 und die «freie Mittheilung schöner Empfindungen» sei der wesentliche Zweck jedes Kunstwerks aus der Sicht des Künstlers.199 Daraus ergebe sich aber sofort die Frage, was als schön zu bezeichnen sei. Zschokke versuchte sie anthropologisch zu beantworten, dabei griff er damals noch neue Erkenntnisse über die menschliche Natur auf. In der anthropologischen Forschung hatte man begonnen, nach den physiologischen Vorgängen zu fragen, die dem Empfinden und den Aktivitäten der Menschen zugrunde lagen, und war auf Triebe, Nerven und Reize gestossen.