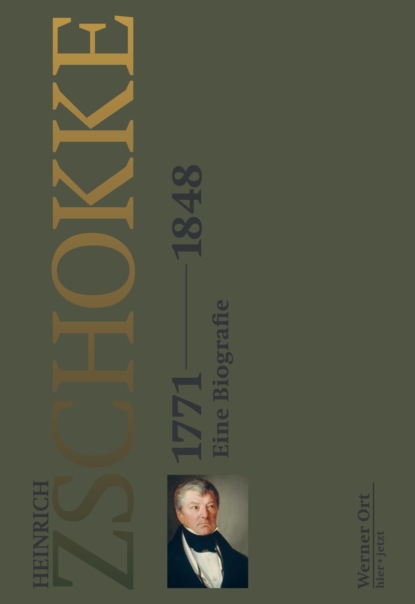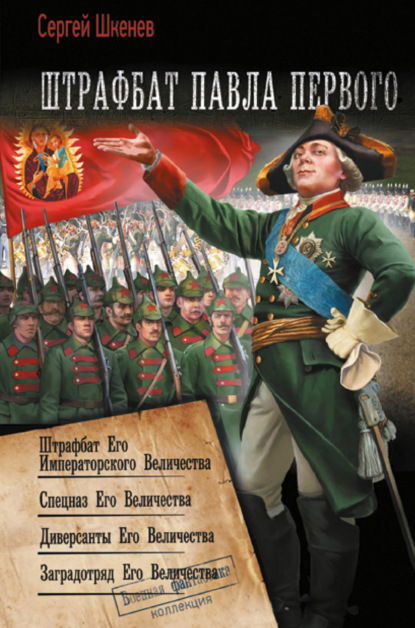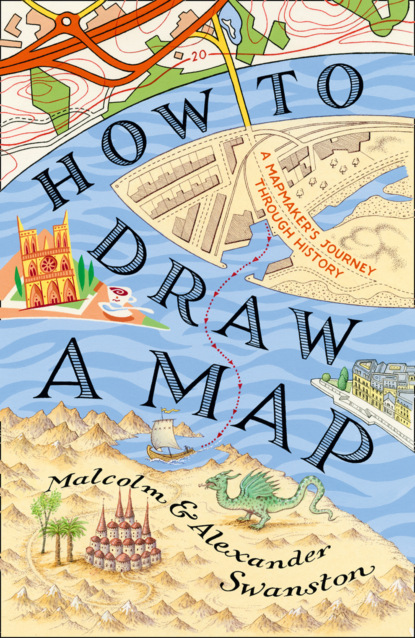- -
- 100%
- +
Begriffe wie Kunst, Schönheit oder Vollkommenheit, wie sie von der philosophischen Ästhetik untersucht wurden, waren gemeinhin objektbezogen, ideell und kunstimmanent definiert worden. Es gab auch andere Ansätze, die das menschliche Empfinden stärker betonten, und Zschokke dachte sie konsequent weiter. Es brauche keine kunsttheoretischen Überlegungen, wenn man sich mit dem Empfindungsvermögen befasse, als die er das griechische «aisthesis» übersetzte. Etwas werde schön empfunden, weil es gefalle.200 Gefallen bedeute aber nichts anderes, als angenehme Empfindungen auslösen. Der Mensch besitze Nerven, die gereizt würden, habe Triebe, die nach Betätigung drängten. Wenn die Nerven harmonisch gereizt, die Triebe befriedigt würden, dann entstehe eine Empfindung von Wohlbehagen und Lust, andernfalls von Abneigung und Unlust.
Jetzt müsste man nur herausfinden, welche Reize diese Empfindungen auslösten und welche Mechanismen daran beteiligt wären. Man müsste die Maschine, als welche der Mensch sich in dieser Hinsicht darbot, verstehen lernen. Zschokke war kein Mediziner; er orientierte sich bei seinen Ausführungen über die Nerven und Triebe an Platner und Karl Franz von Irwing (1741–1801), dessen «Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen»201 er sehr schätzte.
«Die in uns wohnenden Triebe sind das, was die Gewichte der Uhr sind. Beide reizen zur Bewegung in der Thätigkeit; fehlen iene, so hört der Mensch auf zu denken und zu empfinden, fehlen diese, so hemmt das ganze Räderwerk im Lauf. – Handeln mus der Mensch; er ist gezwungen; die Triebe suchen Befriedigung – in der Rüksicht ist er ganz Maschine. Er kann auch nicht darüber disponiren, was ihm mehr oder weniger gefallen soll; durch die Verschiedenheit der Triebe, ihrer Lebhaftigkeit, Stärke oder Schwäche, als auch durch die grössre oder mindere Ausbildung der höhern Vermögen und die Organisation seiner Sinnlichkeit wird das Wolgefallen nothwendig bestimmt. Auch in der Rüksicht ist er Maschine. – Jezt kömmt es endlich noch auf die Verhältnisse an, in welchen der Mensch lebt, und wie diese Verhältnisse dem einen, oder dem andern Trieb mehr Stärke und Lebhaftigkeit geben. Diese Verhältnisse hängen aber schlechterdings, ihrem grössern Theil nach, nicht von unsrer Willkühr ab; wir können sie uns nicht geben; wir müssen jeden Eindruk von aussen aufnehmen – und sind auch in der Hinsicht Maschinen.»202
Dies ist eine Schlüsselstelle zum Verständnis von Zschokkes Psychologie, die aber nur scheinbar materialistisch und deterministisch ist. Der Mensch kann zwar nicht frei entscheiden, wer er ist, was er empfindet und wie er sich verhält, aber er besitzt mit seinen Trieben Kräfte, die zur freien Entfaltung drängen.
Der Mensch sei ein «wunderbares Amphibion», das in zwei Welten lebe: der Sinnlichkeit und Nichtsinnlichkeit, und zwei Naturen besitze: Vernunft und Gefühl.203 Für die Erkenntnis benötige er die theoretische Vernunft, für die Handlung die praktische Vernunft. Um eine Handlung als sittlich richtig oder falsch zu bewerten, brauche er eine moralische Natur. Das Empfinden geschehe mit seiner sinnlichen Natur. Diese Naturen, denen entsprechende Triebe zugeordnet seien,204 widerstritten sich in ihren Zielen. Die vernünftige Natur strebe Harmonie, Wahrheit, Nützlichkeit, Zweckmässigkeit an, die moralische Natur Sittlichkeit und Tugend, die sinnliche Natur aber Wohlsein, Vergnügen und Glückseligkeit.205
Der Künstler, indem er die Empfindungen der Menschen beeinflusse, greife tief in ihr Inneres ein, und daher kämen ihm grosse Macht und Verantwortung zu.206 «Der Künstler ist ein Gewaltiger über die Herzen des Volks.» Er könne «unaussprechlichen Nutzen stiften, den kein Erdengott mit seinen Millionen und Tonnen Goldes allein zu bewirken im Stande ist, den keine Wissenschaft leistet, keine Gewalt hervorbringt, sobald er sich zur Maxime macht, wahre Schönheit, nach unsrer Angabe, darzustellen».207
Was von Zschokke als grundsätzliche Erforschung der Ästhetik angelegt war, wurde ihm unter seinen Händen zu einer pädagogischen und moralphilosophischen Abhandlung, in deren einem Brennpunkt der «edle Künstler» stand mit seinem Bemühen, das Schöne darzustellen und vollkommene Kunstwerke zu schaffen. Nicht dass er dies erreichte, aber er sollte mindestens danach streben. Dies bezeichnete Zschokke als ästhetischen Imperativ,208 in Anspielung auf Kants kategorischen Imperativ, den er aber nicht näher ausführte.
Der zweite Brennpunkt in dieser Ästhetik ist das Volk, auf welches die Kunst einwirkt. Es besitze ein Bedürfnis nach schönen Empfindungen, also Kunst, gleichgültig, wie roh oder verfeinert sein Kunstgeschmack sei. Es könne ein gutes und ein schlechtes Kunstwerk unterscheiden, indem das erste ihm gefalle und angenehme Empfindungen auslöse, das zweite nicht. «Das Schöne ist mit einem nothwendigen Wohlgefallen verknüpft.»209 Gefallen könne dem Menschen nur, was drei Kriterien erfülle: seine Sinne anspreche, seine Vernunft nicht beleidige und seine Sittlichkeit nicht verletze.210
Zwar muss Zschokke einräumen, dass auch das Unvernünftige und Unsittliche gefalle, aber nur bei von ihren Affekten gesteuerten Menschen, welche die Vernunft oder die Moral ausser Kraft gesetzt hätten. Ihr Wohlbehagen gegenüber einem unsittlichen Gemälde oder Buch, das «dem Tugendhaften, dem Vernünftigen» nicht gefallen könne,211 sei von Leidenschaft getrübt.212 Auch Künstler, die so etwas schufen, ohne auf einen höheren Zweck abzuzielen, seien unfrei. «Freiheit bezieht sich auf Vernunftüberlegung, [...] auf Gehorsam gegen die Gesetze der Vernunft, in ihrem theoretischen und praktischen Gebrauche.»213
Man kann aus diesen Ausführungen nicht schliessen, Zschokke habe seine «Ideen zur psychologischen Ästhetik» als Moralapostel und Sittenwächter verfasst. Ebenso verhängnisvoll, wie die sittliche oder erkennende Natur der Menschen zu missachten, sei es, die Sinnlichkeit zu vernachlässigen. «Die Sinnlichkeit leihet der theoretischen und praktischen Vernunft Empfindungen.»214 Und: «Das für den Verstand regelmäßigste, für die sittliche Vernunft beste Werk ist nicht schön, sobald es an sich den Forderungen der Sinnlichkeit widerstrebt.»215
Zschokke stellte Prinzipien dar, ohne den Blick für Realitäten zu verlieren. Die Welt war nicht vollkommen, nicht jeder Künstler edel, kein Mensch frei von Leidenschaft. So war das Leben, und Zschokke hätte lügen müssen, wenn er behauptet hätte, er selber sei als Dichter nur an der sittlichen Bildung der Leser interessiert. An seinem Wunsch nach einem «thebanischen Gesetz», das darauf achte, dass in der Kunst nur «das Schöne und Anständige dargestellt werde»,216 ist abzulesen, wie ernst es ihm um diese Forderung für die Zukunft war. Über die Einhaltung dieses Gesetzes sollte aber nicht die Polizei, sondern «Kunstrichter und Kenner» wachen.
In der neusten Literatur zur Geschichte der Ästhetik wird Zschokkes Buch gewürdigt, und es wird bedauert, dass es so rasch in Vergessenheit geriet, da es durch «die Identifizierung des Ästhetischen mit der Subjektivität des Fühlens» einen «durchaus originellen Ansatz» biete und mit dem ausdrücklichen Anspruch der Gründung einer psychologischen Ästhetik verbinde.217
Entscheidender als die kunsttheoretische Originalität Zschokkes oder seine etwas eigenartige Terminologie218 sind für den Biografen seine Ausführungen über die menschliche Natur. Die Triebkräfte seien bei allen Menschen gleich gestaltet. Niemand, weder Fürst, Priester, Adliger noch Gelehrter oder Künstler könne sich von dem ausnehmen, was auch für den einfachsten Bauern und Taglöhner gelte: dass er in sich einen Drang nach Freiheit im Denken und Handeln, nach Ehre, Freundschaft, Liebe, Reichtum und Menschlichkeit besitze,219 den Wunsch nach Schönem und Vollkommenem, der sich genauso Geltung verschaffen wolle wie der ebenfalls ubiquitäre Geschlechts- oder Lebenserhaltungstrieb.220
Zschokke hatte ein allgemeines Prinzip zur Bildung des Menschen gefunden, das von seiner Natur ausging und insofern die schönen Künste berührte, weil der «edle Künstler» auf das Gemüt, «das Empfindungsvermögen vermittelst der Vorstellungen und Gefühle» einwirke, was für die Erziehung des Menschengeschlechts viel bedeutungsvoller sei, als was der Philosoph leisten könne, der «allein für Verstand und Vernunft, der Moralist für die praktische Vernunft, und der niedrige Künstler für die Sinnlichkeit allein arbeitet».221 Schiller habe beispielhaft gezeigt, wie der Künstler die Menschen durch das Theater rühren und verbessern könne:
«Durch die Gewalt des Kontrastes [...] in seinen Trauerspielen hebt er Vorstellungen und Empfindungen in uns zu einem hohen Grad der Lebhaftigkeit, wodurch der sympathetische Trieb rege wird. Nun zittern und schaudern wir mit seinen Helden vor der anrückenden Gefahr, wir weinen, oder fühlen uns kühn und stolz und athmen Rache, nach seinem Geheis.»222
Zschokke hätte sein Buch auch «Ideen zur ästhetischen Erziehung» nennen können, selbst wenn ihm noch nicht bewusst war, dass die pädagogische Seite ihn einmal stärker beschäftigen würde als die Theorie der Kunst oder die Lehre von den Empfindungen. Er schickte sein Werk Schiller, mit der Bitte um ein Urteil und die Erlaubnis, seine Ideen in der Zeitschrift «Thalia» näher erläutern zu dürfen.223 Den Brief verband er mit der Bezeugung seiner grossen Verehrung für den Dichter; er endete mit dem Satz: «Ihrer gütigen Antwort entgegenharrend, bleib ich bis an mein Grab mit ungeschminkter Hochachtung Ihr Verehrer M. Heinr. Zschokke.»224 Auch dieser Brief, wie der frühere an Wieland, blieb unbeantwortet. Stattdessen veröffentlichte Schiller in den «Horen» seine gleichzeitig mit Zschokkes entstandenen Briefe «Über die ästhetische Erziehung des Menschen».225 Beide beziehen sich auf Kant, und beide versuchen, der Gefahr der politischen Anarchie ein Bollwerk der moralischen und ästhetischen Veredelung des Volks entgegenzusetzen.226 Zschokke hoffte, dass sein Buch für akademische Vorlesungen Verwendung fände227 und wollte es seiner eigenen Vorlesung über Ästhetik im Wintersemester 1794/95 zugrunde legen; es kam aber nicht mehr dazu.
DICHTER UND PUBLIZIST IN DER FRANKFURTER ZEIT
Zschokkes fünf Jahre in Frankfurt waren reich an literarischem und publizistischem Schaffen. Es entstanden fünf teils mehrbändige Romane (und ein Romanfragment), vier Dramen, drei Bände mit Aufsätzen und Erzählungen, zwei eigenständige Zeitschriften und verstreute Aufsätze in verschiedenen Zeitschriften, die hier nur im Überblick dargestellt werden können.
Am 5. Januar 1793 erschien das erste Stück von Zschokkes Wochenzeitschrift «Frankfurter Ephemeriden für deutsche Weltbürger» bei Christian Ludwig Friedrich Apitz.228 Es war sein erstes selbständiges, nach eigenem Konzept entworfenes und realisiertes Periodikum, ein Einmannunternehmen mit dem Anspruch, zu unterhalten und gleichzeitig zu nützen, letzteres durch Aufklärung und Bekämpfung des Aberglaubens.229 Die eigentliche Ankündigung, die im Dezember 1792 in Frankfurt (Oder) und über Buchhändler und Postämter in weiteren Städten von Braunschweig bis Breslau und Schwerin bis Magdeburg verteilt wurde, ist nicht mehr greifbar. Eine Liste der Abonnenten wurde nach Abschluss des ersten Semesters der Zeitschrift beigelegt und gibt uns wertvolle Aufschlüsse über die soziale und geografische Streuung der Leser.230 Sie hatte 450 Subskribenten oder Pränumeranden gewonnen, eine stattliche Zahl für eine neue und noch unbekannte Publikation.
Anstelle einer Vorrede lässt Zschokke eine fiktive Kaffeegesellschaft in einem Provinzstädtchen über die neue Zeitschrift diskutieren:
«‹Wir haben seit vielen Jahren kein Wochenblatt gehabt;› sagte der dikke Herr Amtmann, und sezte seine Tasse hin: ‹ich wills doch mithalten; es pflegt unterweilen schnurriges Zeug darin zu stehen, darüber man sich krank lachen mögte. Zum Beispiel so recht trollige Anekdötchen; Sie wissen ia wohl, Frau Gevatterin, wie wir neulich lasen! he, he, he!›
Die Frau Gevatterin wurde roth, und warf ihm einen halb verschämt, halb drohend sein sollenden Blick zu.
‹Hm!› sagte eine lange hagre Dame und warf den Kopf etwas zurück: ‹Wochenblatt hin, Wochenblatt her! wir haben ia Lesegesellschaften und Lesebibliotheken, wozu noch ein Wochenblatt? – Man giebt ia doch Geld genug fürs leidige Lesen aus, und unter zehn Blättern taugt öfters kaum ein Blatt etwas; da wird entweder moralisirt, oder satyrisirt, oder poesirt, und dann bekömmt man endlich einmahl so eine kleine Liebesintrigue zur Entschädigung für die Langeweile.›
‹Da haben Sie nicht unrecht,› flüsterte ihr der dürre Postmeister zu: ‹für das Geld ein paar Spiel l’Hombrekarten.› ‹Oder einen neuen Floraufsaz!› lispelte des Postmeisters Tochter. ‹Und überdies,› hub der Pastor loci an und strich die buschichten Augenbraun seitwärts: ‹das Avertissement verspricht so viel, als gar nichts. – Für Weltbürger! ia, ia, die Weltbürger kenn’ ich schon; Indifferentisten, Religionsspötter sollts heißen; das muß ich wissen!›»231
Das anwesende Fräulein von M.* schlägt schliesslich vor zuzuwarten, was die Zeitschrift bringen möge, wohl «nichts mehr und nichts weniger, als von iedem Wochenblatt, das für Herz und Kopf geschrieben sein soll». Die Anwesenden «horchten und waren galant genug, die Zähne zusammen zu pressen, und mit einem schmeichlerischen Lächeln ein tiefes Kompliment zu machen».232
Mit dieser Jean-Paulschen Szenerie traf Zschokke das Milieu, von dem seine Ephemeriden wohl gelesen wurden und für das er sie schrieb: der gehobenere Mittelstand kleiner und mittlerer Städte, der sich auf der Jagd nach Gesprächsstoff für seine Zusammenkünfte befand. Zschokke bildete in der Vorrede, wenn auch satirisch verfremdet, die Salons ab, die er selbst frequentierte, und die «Frankfurter Ephemeriden» waren sein Beitrag zu ihrer Unterhaltung, mit ihrem Erscheinen am Samstag gerade rechtzeitig für die sonntäglichen Treffen. Von diesen Kreisen kannte Zschokke die Interessen und stimmte den Inhalt darauf ab.
Friedrich Wilhelm Genthe machte als erster nach Zschokkes Tod auf diese Zeitschrift aufmerksam, von der nur 24 Ausgaben im Umfang von einem Bogen oder 16 Seiten in Oktavo erschienen, schrieb den Titel aber falsch.233 Auf seine Angaben stützten sich nolens volens Alfred Rosenbaum in Goedekes «Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung in Quellen»234 und Carl Günther, der die Zeitschrift nie zu Gesicht bekam, da sie jahrzehntelang verschollen blieb.235 Um 1963 tauchte sie wieder auf, als Geschenk an das Stadtarchiv, und Klaus Barthel, dem langjährigen Leiter der Kleist-Forschungsstätte in Frankfurt (Oder), gebührt der Verdienst, in einer Publikation 1983 wieder darauf hingewiesen zu haben.236 Auch wenn von Mitarbeitern dieser sehr aktiven Kleist-Forschungsstätte seither gelegentlich mit den «Frankfurter Ephemeriden» gearbeitet wird,237 steht eine gründliche Auswertung dieser nicht nur für die Zschokke-Forschung, sondern auch kulturhistorisch interessanten Zeitschrift noch aus.
Der bemerkenswerteste Beitrag in den «Frankfurter Ephemeriden» sind die sich über mehrere Folgen erstreckenden «Wanderungen einer philosophischen Maus»,238 in denen es eine «Kirchenmaus» überdrüssig ist, in einer Kirche von kargen Brosamen zu leben, eine Reise durch die Stadt unternimmt und dabei in ein menschliches Narrenhaus gerät. Die schon im «Schriftstellerteufel» angelegte Satire über das Menschlich-Allzumenschliche wird hier um Eitelkeit, Heuchelei, Neid, Missgunst, üble Nachrede, Egoismen und andere Unzulänglichkeiten erweitert. Reumütig kehrt die Maus in ihr altes Heim zurück, nachdem sie festgestellt hat, «daß unter allen Thieren, die der Herr erschaffen hat unterm Monde ihr Futter zu suchen, kein Thier sich selber und unter einander mehr betrügt als der Mensch».239 Es ist eine moralische Erzählung, wie sie für die moralischen Wochenblätter des 18. Jahrhunderts bezeichnend war,240 geprägt von Zschokkes pessimistischem Menschenbild, das sich im Übrigen auch in seiner politischen Einstellung zeigte.
In einem der ersten Stücke der «Frankfurter Ephemeriden» gab er sein Debüt mit Ansichten zur Zeitgeschichte: «Über gewisse in der Revolutionsgeschichte von Frankreich merkwürdig gewordene Gegenstände».241 Mit einiger Verzögerung hatte Zschokke nun doch beschlossen, den Entwicklungen in Frankreich Rechnung zu tragen, gegen das sich Preussen seit dem Vorjahr im Krieg befand. Das Publikum interessierte sich für nichts stärker als für Neuigkeiten aus Frankreich, und Zschokke wollte diesem Umstand Rechnung tragen. Mit der Hinrichtung von Ludwig XVI. am 21. Januar 1793 hatte die Französische Revolution in den Augen der meisten Deutschen ihre brutale Kehrseite gezeigt und allen Glanz verloren. Die Guillotine, dieses klinisch saubere, unerbittliche und unpersönliche Tötungsinstrument, dem vom kleinen Verbrecher über den windigen Volkstribun bis zur Königin alle zum Opfer fielen, erregte in der Öffentlichkeit Gruseln und Schrecken und wurde in den «Frankfurter Ephemeriden» gleich zweimal vorgestellt.242
Ob er dringend Geld brauchte oder Ausgleich und Erholung von seinen gelehrten Studien: Zschokke schrieb den Roman «Die sieben Teufelsproben», der im Frühling 1794 anonym bei Kaffke in Stettin erschien.243 Er behandelt die Legende des heiligen Martin (316–400), wobei Zschokke sehr freizügig mit der überlieferten Vita umging. Er beschränkte sich auf die erotischen Versuchungen, zunächst durch seine Jugendgespielin, später, als Eremit auf einer Insel, durch die niedliche Arine, die er schlafend neben seiner Hütte findet, wo sie ihm in aller Unschuld die Reize ihres mädchenhaften Körpers preisgibt. Das Titelbild zeigt ihn in frivoler Stellung, wie er unter ihrem Busentuch nach ihrem Herzschlag tastet.244
«Die sieben Teufelsproben» sind eine erotische Erzählung, angereichert durch eine Geistergeschichte, und diesem Umstand ist es wohl geschuldet, dass Zschokkes Urheberschaft so lange geleugnet wurde, von Friedrich Wilhelm Genthe und Carl Günther ebenso wie von Alfred Rosenbaum.245 Hayn/Gotendorf jedoch haben den Roman Zschokke bereits 1914 zugeschrieben und als «wohl die seltenste der pikanten Jugendarbeiten des Verfassers» bezeichnet.246 Es ist ein Studentenulk, ein Ausloten des Büchermarkts, wie ihn sich auch der junge Ludwig Tieck erlaubte, der in Berlin unter Anleitung seines Lehrers Friedrich Eberhard Rambach mithalf, Schundromane zu fabrizieren. Die Stammbücher der Studenten und der Austausch der alten Herren geben hinreichend Proben solcher Scherze aus ihrer wilden Jugendzeit.247 Wenn man Zschokke unter streng moralischem Gesichtspunkt vorwerfen mag, ein Roman mit solchen Schlüpfrigkeiten und Grobheiten entspreche ganz und gar nicht den Forderungen, die er in seinen «Ideen zur psychologischen Ästhetik» an den «edlen Künstler» erhebe, nur das Schöne und Anständige darzustellen, dann hat das einige Berechtigung. Aber womöglich verspottete Zschokke sein ästhetisches Programm auf diese Weise selber.248 Er spielte zu jener Zeit mit Möglichkeiten und Zukunftsentwürfen und wusste selber nicht recht, auf welche Seite sich die Waage neigte: zum Laster oder zur Tugend, zur Askese oder Sinnlichkeit.249
Zschokke bewegte sich zu jener Zeit mit verschiedenen Masken. Im Familienzirkel der Apitz, Schulz und Hausen gab er sich als Schöngeist und witziger Conferencier, zwischendurch suchte er die Einsamkeit und pflegte seine Hypochondrie. An der Viadrina und in der Sozietät der Wissenschaften galt er als ernsthafter Gelehrter, der Vorlesungen hielt und zielstrebig auf eine Professur hinarbeitete, in der Freizeit schrieb er Romane und gründete Unterhaltungszeitschriften. Unter Studenten galt er bald als scharfsinniger Denker, feuriger Redner, bald als Verfasser von Gedichten, elegischer Schwärmer und Träumer; handkehrum nahm er an Studentenstreichen teil und zeigte sich verwegen, zu Pferd oder mit dem Rapier, mit scharfer Klinge.
Im Herbst oder Winter 1793 schrieb Zschokke die Erzählung «Abällino, der grosse Bandit», die im Venedig des beginnenden 16. Jahrhunderts spielt.250 Venezianische Nobili planen den Sturz des Dogen und heuern Meuchelmörder an, um seine Entourage auszuschalten. Zu den Mördern gehört ein Abällino, der sich durch Tollkühnheit, Intelligenz und aussergewöhnliche Kraft auszeichnet und mit Respektlosigkeit, heiserer Stimme und abstossendem Äussern allen Angst, ja sogar Grauen einflösst. Sein Gegenspieler ist der gut aussehende und liebenswürdige Flodoardo aus Florenz mit vollendeten Manieren, der sich an die Spitze der Sbirren setzt, ins Schlupfloch der Mörder eindringt und sie bis auf Abällino alle ausschaltet. Jetzt ist Abällino unangefochtener Chef der Banditen. Einen nach dem anderen führt er die Auftragsmorde der politischen Verschwörer durch und verhöhnt die Polizei auf Zetteln, die er an Hausfassaden klebt. Beide, Abällino und Flodoardo, lieben Rosamunde, die Nichte des Dogen. Der Doge will sie Flodoardo zur Frau geben, falls er Abällino, den grössten Schrecken Venedigs, zur Strecke bringt. Abällino seinerseits erhält von den Verschwörern den Auftrag, Flodoardo zu töten.
Im Saal des Dogenpalasts soll das Finale stattfinden, denn Flodoardo hat versprochen, Abällino zu einem bestimmten Zeitpunkt herbeizuschaffen, tot oder lebendig. Viele Schaulustige finden sich ein, die vereinbarte Zeit verstreicht, und es geht schon das Gerücht um, Flodoardo habe den Kampf mit seinem Erzrivalen verloren. In derangiertem Zustand taucht er plötzlich auf und behauptet, Abällino befinde sich im Palast. Der Doge will ihn sehen. Flodoardo geht zur Tür, wirft den Mantel ab, dreht sich um und ist in Abällino verwandelt, mit Augenbinde, einem entstellenden Pflaster und widerlichem Grinsen. In der Gestalt des Abällino überführt er die überrumpelten Verschwörer und verlangt vom Dogen grob die Hand von Rosamunde, da er sein Versprechen erfüllt habe. Für den Dogen, dessen beste Freunde Abällino umgebracht hat, kommt das nicht in Frage. Abällino geht noch einmal zur Tür, reisst sie auf und draussen stehen die vermeintlich toten Venezianer. Rosamunde wirft sich Abällino schluchzend an die Brust, mit dem Aufschrei: «Dieser – dieser ist kein Mörder.»
«Abällino, der grosse Bandit», der fünf Jahre vor «Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann» von Goethes Schwager Christian August Vulpius erschien,251 wird zuweilen als erster deutscher Räuberroman bezeichnet,252 als ein «Mantel- und Degenstück».253 Das sind zweifelhafte Zuschreibungen, zumal es sich, auch nach Zschokkes Begriffen, um eine Erzählung und nicht um einen Roman handelt, da ihr der Anfang und das Ende fehlt. «Abällino» steht mit der Thematisierung von Verschwörungen und Staatsintrigen eher in der Nachfolge von Schillers «Verschwörung des Fiesko zu Genua» und ist eine psychologische Studie um das Wesen des Menschen und die ihn beeinflussenden Lebensumstände.254 Den beiden Dramenfassungen von 1795 und 1796 setzte Zschokke das Motto «Verhältnisse bestimmen den Menschen» voran. Auf dem Theater gibt sich «Abällino, der grosse Bandit» als ein Spiel mit Masken und Maskeraden, des sich Verhüllens und Entlarvens, passend zur Vorstellung, die man mit Venedigs Karneval verbindet. All diese Aspekte zusammen trugen dazu bei, dem Werk seine Beliebtheit zu verleihen, im deutschen Kulturraum als Drama, im englischen als Erzählung, in einer fast wörtlichen Übersetzung von Matthew Gregory Lewis (1775–1818), dem sie unter dem Titel «The Bravo of Venice» lange Zeit zugeschrieben wurde.255 Es ist das Verdienst von Josef Morlo, die Erzählung in der Reihe «Kleines Archiv des 18. Jahrhunderts» wieder zugänglich gemacht,256 und das von Holger Dainat, sie literaturgeschichtlich eingeordnet zu haben.257
«Abällino» sei «das Produkt einer angenehmen, flüchtigen Laune» gewesen, schrieb Zschokke in der Vorrede zur ersten Dramenfassung. «Das Gemälde war ohne Sorgfalt hingeworfen, nur skizzirt, selten hie und da ausgearbeitet, und eigentlich wohl nur angelegt, als Stoff zu einem Drama.»258 In der «Selbstschau» schrieb er, er habe im Studentenkreis eine alte venezianische Anekdote vorgetragen, die er «mit poetischer Freiheit fantastisch genug ausschmückte».259 In dem Fall war ihm mit leichter Hand ein grosser Wurf geglückt, ein Werk, das seine Faszination aus dem schillernden Charakter einer Doppelpersönlichkeit bezog, in welcher Zschokke Eigenschaften ins Spiel brachte, die er in sich selber spürte: Ungestümheit, Rücksichtslosigkeit, Brutalität und Gier.260
Für die Bühnenfassung straffte Zschokke die Dialoge und akzentuierte die Charaktere. Er vermied es, für Abällino Mitleid zu erwecken, liess ihn nicht erst bittere Erfahrungen als Bettler machen, sondern gleich als Mörder ins Geschäft steigen. Er brauchte jetzt nicht mehr in Hamlets Manier zu zaudern und mit seinem Schicksal zu hadern. Auf der Bühne ist Abällino ein Tatmensch, der das Geschehen vorantreibt und kontrolliert, unzimperlich, direkt, fordernd. Nichts und niemand kann sich ihm entziehen. Das Finale wird sorgsam vorbereitet: Er darf seinen Coup landen, die Verschwörer entlarven, sich von aller Schuld reinwaschen und Rosamunde aus der Hand des Dogen empfangen. Sein Brigantentum ist von Anfang an auf Verstellung angelegt, kühl kalkuliert, um den politischen Bösewichten ihr Handwerk zu legen und des Dogen schöne Nichte zu gewinnen. Rosamunde bezieht im Drama deutlicher Stellung als in der Erzählung: Sie verabscheut Abällino, während sie Flodoardo liebt.