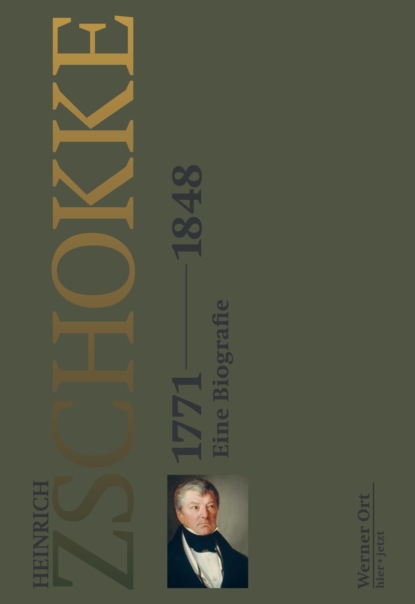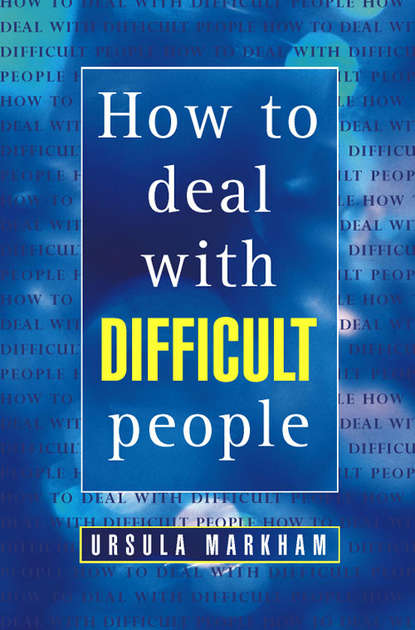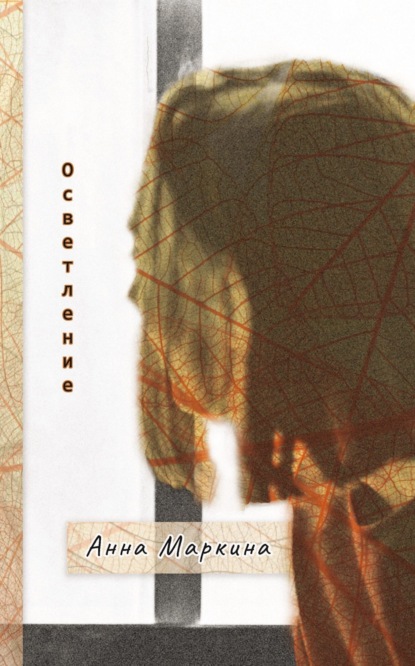- -
- 100%
- +
Dies zerstört zwar die Komplexität der Erzählung, verstärkt aber den Theatereffekt in der Stunde der Enthüllung. Im Publikum hinterliessen die Aufführungen das wohlig-gruselige Gefühl, brutalen Banditen bei der Arbeit zuzusehen und am Schluss die Genugtuung zu haben, dass Venedig durch die mutige Tat des Helden vor der Anarchie gerettet wird. Der Bezug zur politischen Lage Deutschlands war mit den Händen zu greifen: Die allgegenwärtige, auch propagandistisch geschürte Angst vor Revolutionen und vor Versuchen, deutsche Fürsten zu stürzen, wird in Zschokkes Stück geschickt benutzt, dramaturgisch verstärkt und im befreienden Schluss aufgelöst.
Der Januar 1794 begann für Zschokke mit einer neuen Zeitschrift, die wiederum bei Apitz erschien. Sie war ganz auf Zschokkes Bedürfnisse zugeschnitten und trug den Namen «Litterarisches Pantheon», weil er sich inhaltlich nicht festlegen wollte: Wie der griechische Tempel sollte sie allen Göttern oder Musen dienen, mit denen er sich gerade herumschlug: Sie enthielt Essays, Gedichte, Dramen, Märchen, Versepen und anderes. Es war eine Fortsetzung der «Schwärmerey und Traum in Fragmenten, Romanen und Dialogen», in monatlicher Stückelung zu 96 Seiten in Oktav (sechs Bogen), und die einzige Zeitschrift Zschokkes, in der er sich an kein klar definiertes Publikum mit einem fest umrissenen Programm wandte. Er liess es darauf ankommen, ob die Zeitschrift Anklang fand. Der Plan, sei «so gut als gar keiner», rügte die «Allgemeine Literatur-Zeitung».261 Gerade das gibt dem Zschokke-Biografen eine gute Ausgangslage, um Einblick in die schriftstellerische Werkstatt und gedanklichen Schwerpunkte Zschokkes zu erhalten. Leider fehlen in den Beständen im Stadtarchiv Frankfurt (Oder) die beiden mittleren Quartalsbände.262 Carl Günther hatte noch Zugriff auf alle vier Bände, als letzter und vielleicht einziger Benutzer, der sie auswertete.263
Das «Litterarische Pantheon» war die Publikation eines jungen Gelehrten und Dichters mit einem Hang zum Philosophischen, kam in wesentlichen Teilen monologisch daher und dürfte knapp die Aufmerksamkeitsschwelle einer gebildeten Öffentlichkeit überschritten haben. Zschokke verfasste den grössten Teil der Beiträge selbst, aber er schrieb seine Zeitschrift nicht ganz allein.264
Alle Aufsätzen im «Litterarischen Pantheon», wie auch das meiste, was Zschokke später schrieb, haben einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart oder zu einer aktuellen Auseinandersetzung, als Vorgeschichte, Materiallieferant, Spiegel, Vor- oder Gegenbild. Geschichte, auch Philosophiegeschichte, besass für Zschokke die Aufgabe, den Zeitgenossen lehrreich zu sein. Es gab für ihn keinen Elfenbeinturm des Gelehrtenwissens; stets versuchte er, ihn zu verlassen, um anschaulich zu werden, pädagogisch zu wirken, nützlich zu sein.
Wenn man die Aufsätze aneinanderreiht, so lesen sie sich wie ein Plädoyer und eine Kampfansage gegen den Woellnerschen Geist, der auf den Kathedern und in den Amtsstuben Einzug nehmen sollte. «Der Geist des Zeitalters beugt sich weder vor Gesetzen noch Armeen!» heisst einer von ihnen.265 Der Geist des Zeitalters – die Aufklärung – lasse sich nicht rückgängig machen. Es ist dies der Schlüsselaufsatz der Zeitschrift, die Quintessenz von Zschokkes naturrechtlichen und staatsphilosophischen Überlegungen aus der Frankfurter Zeit. In Anspielung auf Kants Definition der Aufklärung meinte Zschokke, der Mensch habe sich in Europa von seiner geistigen, politischen und theologischen Unmündigkeit emanzipiert, glaube sich «dem Gängelbande der Monarchen und Priester entwachsen, und groß genug zu seyn, ohne Vormund agiren zu können»,266 dulde keine Fesseln des Geistes mehr, keinen anderen Kanon als jenen, den seine eigene Vernunft ihm diktiere.267 In einem geschichtlichen Überblick zeigte er auf, wie der Mensch in einem langen Prozess seine Vernunft erlangt habe, wie die Reformation der Theologie der Reformation der Philosophie vorausgegangen sei und vorausgehen musste.268 Auf die Forderung nach Gedankenfreiheit folgte die Forderung nach Freiheit des Handelns,269 und dies habe zu den Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts geführt, aus der noch immer der Geist der Kirchenreformation des 16. Jahrhunderts spreche.270
Die Freiheit, so Zschokke, habe positive und negative Auswirkungen, da die Menschen noch über keine «wirksame, geläuterte, praktische Vernunft» verfügten, «die nur auf ihre erhabnen Gesetze hinzeigt», sondern als sinnliche Wesen ihren Affekten und Leidenschaften nachgäben und verführbar seien.
«Es ist eine heilige Pflicht, die Menschen im Allgemeinen auszubilden und zu veredeln; die Fürsten selber müssen, als Freunde ihres Geschlechts, hierzu die Hand bieten, müssen stolz darauf seyn, Oberherren einer denkenden Nation zu heissen, statt Regierer einer trägen, dummen, gefühllosen Marionettenversammlung genannt zu werden.»271
Dagegen vermöge die «Polizierung», die äusserliche Zivilisierung, nichts, wie das Beispiel Frankreichs zeige; sie schütze nicht vor gewaltsamen Staatsrevolutionen. Es gebe auf die Frage, «welches ist das beste, unfehlbarste Mittel, gewaltsamen Revolutionen vorzubeugen?», eine Antwort: «Leget dem Volke keine Ketten an, so hat es keine zu zerbrechen; presset dem männlichen Geist der Nation nicht den eisernen Kinderschuh des Gesetzes auf! – Seht auf Friedrich den Einzigen und seinen weisen Nachfolger!»272
Dieser groteske Schlusssatz, der Kniefall vor dem neuen preussischen Herrscher, ist ein hässlicher Missklang in der sonst stolzen Rede, eine Geste der Huldigung, aber auch der Hoffnung, Friedrich Wilhelm II., der ja eines Sinns mit Woellner war, im gleichen Ausmass Werkzeug und Herr, werde sich von seinen Beratern lösen, seinen Platz an der Seite des Volks suchen und Adel und Kirche vom Hof verjagen. Diese Überzeugung, die noch ein Vierteljahrhundert später, während der Metternichschen Restauration, Zschokkes Haltung gegenüber Monarchen prägte, gibt seinen politischen Aufsätzen nicht selten einen Anflug des Bizarren.273
Zschokkes letzter Beitrag im «Litterarischen Pantheon» ist ein philosophischer tour d’horizon zur Frage nach der Rolle des Menschen im Universum, seiner Natur und seinem Erkenntnisvermögen.274 Die Quintessenz ist, dass es keine Gewissheit gebe von dem, was wir über die Welt und von uns selber zu wissen meinten: «es ist nicht mehr, als wir aus dem Kerker unsers Leibes durch die fünf Fenstern, welche wir Sinne heißen, zu erblicken im Stand sind».275
«Wir tappen also in jener sonderbaren Dunkelheit, und weiden uns an einer ewigen Täuschung. Dämmernd und unbekannt ist, was da draußen wohnt; aber wir nehmen die Kinder unsrer Sinnenorganisation auf, wie das Wirkliche, welches uns zu umringen scheint, oder umringen mag. – Wir philosophiren alsdann nicht über die Welt, sondern immer über unsre eigne Natur; wir kennen keine Welt, sondern nur die Erzeugnisse unsers Sensoriums. Diese sind unsre Welt.»276
Der Mensch glaube, von Gott ausgezeichnet, zum Herr der Welt bestimmt, kraft seines Geistes, der Künste und Wissenschaften über alle anderen Geschöpfe erhaben zu sein. Und doch sei er nur ein Bündel von Nervenfasern, hilflos und sterblich, Naturkatastrophen, Seuchen und Kriegen und seiner eigenen Sinnlichkeit preisgegeben.
«Das sichtbargewordne Strumpfband unterm Knie eines Mädchens, die unwillkührliche Verrückung eines Busentuches, ein Gläschen Weins über die alte Regel – bläst Aufruhr durch die Adern, treibt das rastlose Spiel der Nerven schneller, sezt die Einbildungskraft in helle Flammen, und das Produkt der ganzen Bagatelle ist – nach wen[i] gen Monden ein Mensch, an welchen Vater und Mutter beim Strumpfband, Busentuch und Weinglase am wenigsten gedacht hatten.»277
Mit diesem trostlosen Ausblick auf die menschlichen Schwächen, die so gar nicht dem Bild von der Krone der Schöpfung entsprachen, ging der Aufsatz und der einzige Jahrgang des «Litterarischen Pantheons» zu Ende.
Um ein Haar wäre es das Letzte gewesen, was wir von Zschokke gehört und gelesen hätten, und er hätte das gleiche Schicksal genommen wie der junge Student Johann Gustav Friedrich Toll, dessen Grabrede Zschokke gehalten hatte. Anfang Dezember 1794 wurde er Opfer einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das Stubenmädchen hatte am Ofen manipuliert, in der Nacht waren Gase in sein Zimmer geströmt, und er verlor im Schlaf das Bewusstsein. Hätte man den Rauch nicht entdeckt und ihn herausgeholt, so wäre er nie mehr erwacht.
Im Frühling 1794 hatte er sein Revolutionsdrama, «Charlotte Corday oder die Rebellion von Calvados», beendet, das er als republikanisches Trauerspiel in vier Akten bezeichnete, mit dem Untertitel «Aus den Zeiten der französischen Revolution». Die ersten drei Akte erschienen von Februar bis April im «Litterarischen Pantheon»,278 das ganze Drama Anfang Mai im 2. Band von «Schwärmerey und Traum»279 und mit gleichem Drucksatz gleichzeitig oder etwas später bei Kaffke in Stettin.280
Am 11. Juli 1793 hatte Marie-Anne Charlotte de Corday d’Armant aus Caen den Revolutionär und Herausgeber der Zeitung «L’Ami du peuple» Jean-Paul Marat ermordet. Sie wurde noch am Tatort verhaftet, am 17. Juli vor das Revolutionstribunal gebracht und noch am gleichen Tag hingerichtet. Vor ihrem Tod wurde sie porträtiert; ihr Bildnis ging um die Welt. Sogleich setzte auch eine Literarisierung ihres Schicksals ein.281
Die Sensation war nicht der Mord, sondern die Täterin: eine 25-jährige Adlige aus der Provinz stieg in eine Postkutsche nach Paris, wurde ohne weiteres zu Marat vorgelassen und erdolchte ihn in der Badewanne, kaltblütig und ohne irgendeine sichtbare Unterstützung. Sie behauptete, sie habe ihren Entschluss gefasst, als sie gemerkt habe, dass sich kampfwillige Bürger rüsteten, um die Jakobiner militärisch zu bekämpfen. «Ich dachte, es sey unnöthig, daß so viele brave Leute nach Paris giengen, den Kopf eines einzigen Menschen zu suchen, den sie vielleicht verfehlen konnten, oder der viele gute Bürger mit sich zum Untergang gerissen hätte. Ich glaubte, die Hand eines Weibes sey dazu hinreichend.»282 Sie habe die Republik gegen die Anarchie verteidigt, sagte sie vor Gericht. Hocherhobenen Hauptes liess sie sich zum Schafott bringen, im Bewusstsein, für eine gerechte Sache zu sterben.283
Viel mehr wusste Zschokke von ihr nicht, als er mit seinem Drama begann. Er rekonstruierte aus Zeitungsmeldungen ihre Tat und bettete sie in die politische Situation ein. Das Stück beginnt im Juni 1793, als die Jakobiner die Girondisten entmachtet und ihre Anhänger im Nationalkonvent verhaftet hatten. In der girondistisch gesinnten Heimat der Familie Corday rüstet man sich zum aktiven Widerstand gegen die Jakobinerherrschaft und in Caen werden Truppen angeworben, um gegen Paris zu ziehen. Zschokke will glaubwürdig erklären, wieso Charlotte Corday zu ihrer Tat schreitet: Alle sind sich einig, dass Marat kaltgestellt werden soll, aber jeder Mann scheut den nächsten Schritt: sowohl der hypochondrische Vater als auch Corbigni, der sie liebt. Ihm wäre sie bereit, die Ausführung ihres Entschlusses zu überlassen und ihn dafür zu heiraten. Aber er zaudert und verliert so ihre Achtung.
In der Vorrede zur Prosafassung des «Abällino» schrieb Zschokke: «Ich nehme gewisse Karaktere und führe sie durch eine Reihe von Situazionen, und beobachte, wie sie sich in all diesen Verhältnissen ausnehmen.»284 Bei Charlotte Corday ist es genau umgekehrt: Die Situationen und Handlungen waren vorgegeben, und er versuchte, daraus die Charaktere zu erfassen. Zschokkes Corday ist eine psychopathologische Studie zur Erfahrungsseelenkunde.
Gerne wird in der Literatur hervorgehoben, Zschokke habe in seiner Charlotte Corday eine emanzipierte Frau dargestellt.285 Dabei wird übersehen, dass er ihr zwar die Freiheit zubilligt, nach eigenem Willen und Ermessen zu handeln, ihr die Fähigkeit zur sachlichen Abwägung ihrer Handlungen und deren Konsequenzen aber abspricht. Es geht nicht um eine «neue Weiblichkeitskonzeption als Erfüllung bürgerlicher Freiheitswünsche»,286 sondern um eine Wiederaufnahme der Kontroverse, die seit mindestens 1775 geführt wurde: die Kontroverse um politische, religiöse und künstlerische Schwärmerei.287
Zschokke bezeichnete Charlotte Corday als schöne philosophische Schwärmerin,288 weil sie utopische, nicht realisierbare Ziele vertrat: die Freiheit der Menschen in einer freien Nation. Der junge Zschokke sah sich selber als Schwärmer und war sich der Ambivalenz seines Tuns bewusst, wenn er sich einer ungezügelten Phantasie und Spekulation überliess, statt sich auf streng wissenschaftlichem oder philosophischem Boden zu bewegen. Schwärmerei, soweit sie sich nicht in einen Gegensatz zur Vernunft stellte, verband Zschokke in seiner Frankfurter Zeit mit Kreativität und Subjektivität, mit der Möglichkeit, sich ganz den Träumen und Gefühlen hinzugeben, Eigenschaften, die er bei seinem literarischen Schaffen und im nichtakademischen Philosophieren gern für sich in Anspruch nahm. Schwärmen und Schwärmerei war eine Domäne, die er auch und gerne Frauen zugestand.
Zschokke hatte nicht die Absicht, einen «embryonalen Feminismus einer republikanischen Schwärmerin» vorzuführen, die «der Männermacht trotzt», wie Arnd Beise meint,289 sondern die gefährlichen Folgen einer aus Schwärmerei begangenen politischen Handlung aufzuzeigen. Er bezeichnete sein Trauerspiel als «Miniatürgemählde», von dem er zweifle, dass es je auf die Bühne komme.290 Man wundert sich, dass er die Form des Dramas wählte, da die tatsächlichen Ereignisse seine künstlerischen Möglichkeiten stark einengten. Offenbar hatte er nach einem fast vierjährigen Unterbruch Lust, sich wieder einmal an einem Theaterstück zu versuchen, moralisierend auf ein breiteres Publikum einzuwirken. Man muss Zschokke zubilligen, dass er sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzte, der Aufbau des Stücks eine in sich schlüssige Handlung voranbringt, die Dialoge stimmig sind und viel Liebe in den Details steckt. Das Drama ist mit grosser Sorgfalt abgefasst und in Blankverse gesetzt,291 aber es wäre besser gewesen, Zschokke hätte es als Fragment belassen, so, wie es im «Litterarischen Pantheon» abgedruckt ist.
Anna Bütikofer, Mitorganisatorin des Zschokke-Symposiums vom Herbst 2005 in Aarau, hatte die gute Idee, zum Abschluss der Tagung in einer szenischen Lesung Auszüge aus der «Charlotte Corday» vortragen zu lassen. Der alte Saal des Geschworenengerichts im Ratshaus war gefüllt, und das Publikum genoss sichtlich den Charme dieses über zweihundert Jahre alten Werks, dessen sprachliche Kraft in der schauspielerischen Leistung von Marianne Burg und Hansrudolf Twerenbold ausgezeichnet zur Geltung kam – vermutlich handelte es sich um die Uraufführung des Stücks.
Noch in einem weiteren Drama befasste sich Zschokke mit der Französischen Revolution, im Bauernschwank «Der Freiheitsbaum»,292 der um 1793 in einem deutschen Dorf an der französischen Grenze spielt, an einem einzigen Morgen vor dem Haus des reichen Bauers Blum. Bedauerlicherweise wurde dieser unterhaltende Einakter voller Situationskomik und witziger Dialoge bisher kaum zur Kenntnis genommen. Gerhard Steiner nimmt ihn zwar in seine Sammlung «Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater» auf,293 schrieb ihn aber Nikolaus Müller zu.294 Obwohl er nach einer Korrektur durch Holger Böning295 den Irrtum in einer zweiten Auflage richtig stellte,296 beharrte er darauf, dass man das Stück «für eine Arbeit des Mainzer Jakobiners und Theaterdichters Müller» halten konnte»,297 und dass sich die revolutionäre Mainzer Bühne diesen Stoff sicher nicht habe entgehen lassen, sondern sie aus dem Manuskript spielte.298 Es ist zu wünschen, dass in einer dritten Auflage diese Vermutungen gestrichen und der Text des Stücks noch einmal sorgfältig mit dem Original in der Staatsbibliothek Berlin verglichen wird. Wie hätten die Mainzer ein Stück aufführen können, das erst ein Jahr nach dem Ende ihres politischen Experiments entstand?
Ganz sicher war es nicht als Revolutionsdrama gedacht. Politisch bezog Zschokke einmal mehr nicht Stellung. «Der Freiheitsbaum war eine Farce für eine Familiengesellschaft, die ich doch auch ausspielen wollte; ich verschenkte es an Apitz. Ob’s behagt, weis ich nicht», schrieb er im Februar 1796 an Behrendsen.299 Auf keinen Fall kann man Zschokke wegen dieses Dramas als Sympathisanten oder Anhänger der Französischen Revolution sehen. Hans-Wolf Jäger, der sich auf die Interpretation Steiners stützt, hält Zschokkes «Freiheitsbaum» aber für «das beste Erzeugnis jakobinischer Schauspieldichtung, [...] geradezu für diesen Zweck verfaßt».300 Das Gegenteil ist der Fall, und das lässt sich mit einer Fülle von Aussagen Zschokkes belegen: Er betrachtete die Revolution der Franzosen in jener Zeit als eine Revolte, hervorgerufen durch eine erhitzte Einbildungskraft.301 Die Zauberworte Freiheit! Gleichheit! hätten die Köpfe verwirrt; die Forderung entspringe nicht Idealen, sondern der Eigensucht; allgemeine Gleichheit komme in der menschlichen Gesellschaft nicht vor, sei eine Chimäre.302 Zschokkes politisches Engagement hatte zu jener Zeit ganz andere, persönliche Gründe.
POLITISCHE REBELLION
Im Dezember 1793 reichte Zschokke ein Gesuch an den preussischen König ein, dass man ihm entweder eine Bezahlung als Dozent gebe oder doch wenigstens zum ausserordentlichen Professor der Philosophie ernenne, mit der Option, «binnen Jahr und Tag» in Frankfurt oder an einer anderen preussischen Universität ein Gehalt zu beziehen.303 Er begründete seinen Antrag mit seinem geringen Vermögen, das er während seines akademischen Lebens teilweise aufgeopfert habe, zumal er sich bemühe, mittellosen Theologiestudenten behilflich zu sein.
Karl Franz von Irwing, der als Mitglied des preussischen Oberschulkollegiums Zschokkes Antrag bearbeitete, setzte den Entwurf zu einer Antwort auf, die, von ihm und Minister Woellner als Oberkurator der Universitäten unterzeichnet, am 7. Januar 1794 ausgefertigt und nach Frankfurt (Oder) geschickt wurde. Zschokke solle sich bis zur Verleihung des Titels eines ausserordentlichen Professors der Philosophie noch einige Zeit gedulden, zumal seine Bitte um Zusage eines Gehalts angesichts der fehlenden Mittel in der Universitätskasse nicht erfüllt werden könne. «Wenn aber derselbe in seinem bisherigen Fleiß fortfahren, und sich fernerhin wie bisher um das Beste der studirenden Jugend verdient machen wird, so könne er versichert seyn, daß bey vorkommender thunlicher Gelegenheit, auf ihn Bedacht werde genommen werden.»304
Man hat nicht den Eindruck, dass diese Zurückweisung aus politischen Gründen erfolgte, wie Zschokke später immer behauptete.305 Da sich sein hauptsächliches Begehren auf eine Geldentschädigung richtete, hatte er sich die abschlägige Antwort selber eingebrockt: Es gab dafür schlicht keine Mittel. Die ordentlichen Professoren erhielten an der Viadrina einen nur mageren Lohn, die ausserordentlichen Professoren oft gar keinen, waren also darauf angewiesen, eine zweite, bezahlte Stelle zu haben, als Schulrektor, Pfarrer oder Arzt. Die Schlange von Dozenten, die um ein Gehalt oder eine Gehaltsverbesserung anstanden, war lang, und Zschokke hätte sich weit hinten anstellen müssen, um an die Reihe zu kommen.
Im Sommer 1794 etwa, als die Witwe von Professor Darjes starb, bewarben sich mit Steinbart, Heynatz, Pirner, Madihn, Borowski, Meister und Huth sieben Professoren um die nun hinfällig gewordene Pension von 289 Taler jährlich, und selbst Berends bat im Namen der Frankfurter Sozietät der Wissenschaften um das Geld. Der König willigte zwar ein, die Rente umzulenken, aber nicht nur für die dort tätigen Lehrer, sondern auch für den alten Kanonikus Peine in Magdeburg.306 Ein weiterer Dürstender am tröpfelnden Geldhahn war ausgerechnet Woellners Liebling Friedrich From, ausserordentlicher Professor für Theologie, dessen Gesuch um eine ordentliche Philosophieprofessur – eine seit 1788 erledigte Stelle – im Mai 1795 nach fast siebenjähriger Wartezeit endlich genehmigt wurde, aber nur als Professor ordinarius supernumerarius ohne Emolumente (Nebeneinkünfte), um die anderen Professoren finanziell nicht zu schädigen.
Zschokke hatte diese Geduld nicht; er brauchte jetzt Geld. Also wandte er sich an Steinbart und bat ihn um eine Stelle als Lehrer in seinem Institut in Züllichau oder um «einige Aufmunterung und Unterstützung als akademischer Lehrer».307 Vermutlich bot er ihm auch an, ihn bei den Vorlesungen zu entlasten – Steinbart litt schon lange unter der Doppelprofessur an der theologischen und philosophischen Fakultät –, und Steinbart, der Zschokkes Fähigkeiten als Dozent ebenso schätzte wie Hausen, hätte ihm bestimmt gern geholfen, konnte ihn aber nicht aus der eigenen Tasche bezahlen. Die Theologieprofessur trug ihm ja selber nichts ein, und er hatte drei Söhne, die studierten oder noch studieren sollten.
Hätte Zschokke noch einige Jahre ausgeharrt, so wäre an der Viadrina doch noch eine Professur in Aussicht gestanden. Nach dem Tod des Königs (1797) schlug Steinbart Zschokke zu seinem Assistenten und Nachfolger vor, und Wilhelm Abraham Teller (1734–1804), einflussreicher Mann im Oberkonsistorium, schrieb ihm (wie Steinbart Zschokke mitteilte), «dass jeder, für welchen ich garantierte, dass er die Erwartung des Staates erfüllen würde, unbedenklich zum Substituten und Nachfolger in meinen akademischen Ämtern angenommen werden sollte».308
Zschokke hätte sich nur regelmässig melden und um eine Stelle nachfragen müssen, so wäre er 1798 vermutlich Steinbarts Assistent geworden, 1801 statt Wilhelm Traugott Krug (1770–1842) ausserordentlicher Professor der Philosophie und 1809, nach Steinbarts Ableben, in beide Professuren nachgerückt. Aber seit der ersten Absage im Januar 1794 und einer weiteren drei Jahre später309 hatte Zschokke seinen Wunsch nicht mehr erneuert, ja nicht mehr mit ihm Kontakt aufgenommen, und als Steinbart ihm im Sommer 1800 schrieb, dachte Zschokke nicht einmal im Traum mehr daran, die Schweiz zu verlassen und auf der universitären Karriereleiter an der Viadrina eine weitere Stufe zu erklimmen.
Die zu grosse Jugend, erinnerte sich Hausen später, sei der Grund dafür gewesen, wieso Woellner sein erstes Gesuch abgelehnt habe.310 Die Jugend, gewiss; Zschokke zählte noch keine 23 Jahre. Normalerweise standen Männer, die an der Viadrina eine Professur erhielten, in reiferem Alter und hatten Berufserfahrung, Zschokke dagegen hatte noch nicht einmal vier Jahre an der Universität verbracht, was normalerweise als Dauer bis zum Abschluss des Studiums betrachtet wurde und nicht schon zum Griff nach einer Professur. Dass es dazu viel zu früh war, war Konsens im Kollegium an der Viadrina wie im Oberkonsistorialrat in Berlin.
Steinbart glaubte ohnehin, «wie sehr wohltätig zur Reinigung unsrer theoretischen und speculativen Kenntnisse es ist, wenn man eine zeitlang ins Geschäftsleben hineingestossen wird», und daher meinte er auch, dass vorderhand jeder andere Aufenthalt Zschokke nützlicher sein würde als der auf Schulen.311 Gleichwohl behauptete Zschokke später, Oberkonsistorialrat Irwing selber habe ihm angeraten,312 ihn ermuntert,313 ja es schlechterdings gewollt,314 dass er sich um eine Professur bewerbe, und seine «väterlichen Freunde» Hausen und Steinbart hätten ihm beigepflichtet. Woellner dagegen habe es vereitelt, aus politischen Gründen und wegen einer Kränkung, die darin bestanden habe, dass der junge Privatdozent sich weigerte, ihm in Frankfurt (Oder) seine Aufwartung zu machen.
Schon Carl Günther zweifelte diese Behauptung an, die nur auf einer Spekulation gründete, seither aber fleissig in jeder Darstellung kolportiert wird. Günther argumentiert, erstens gebe es keinen Hinweis, dass Woellner in der fraglichen Zeit die Viadrina besuchte, zweitens wäre es ihm kaum aufgefallen, wenn sich ein Privatdozent dem Empfang des Gewaltigen entzogen hätte, und drittens sei Woellner die politische Gesinnung Zschokkes noch unbekannt gewesen, da vor 1793 noch keine politische Schrift von ihm erschienen sei.315
Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass Zschokke in «Eine Selbstschau» seine Verweigerung so realistisch schilderte, dass man fast nicht glauben kann, es sei alles nur eine nachträgliche Erfindung gewesen. Am Tag, da Woellner in Frankfurt (Oder) weilte, sei er, Zschokke, auf einem Spaziergang Steinbart begegnet, der eben von einem Besuch beim Minister zurückgekommen sei und ihm sagte, Woellner habe sich nach ihm erkundigt. Zschokke begründete sein Wegbleiben politisch, worauf Steinbart erwiderte, auch wenn er mit Woellners Grundsätzen nicht einverstanden sei, verlange es die normale Höflichkeit, an der Begrüssung teilzunehmen. Zschokke habe geantwortet, es gebe Zeiten, wo schon eine solche Höflichkeit zur Sünde gereiche. Die Mächtigen müssten spüren, dass man mit ihnen nicht einverstanden sei; nur dadurch würden sie zur Einsicht kommen. Darauf habe Steinbart ironisch versetzt: «Seine Exzellenz wird schwerlich von Ihrem Nichtbesuch dergleichen Nutzanwendung für sich machen; eher vielleicht eine unerfreuliche für Sie.»316