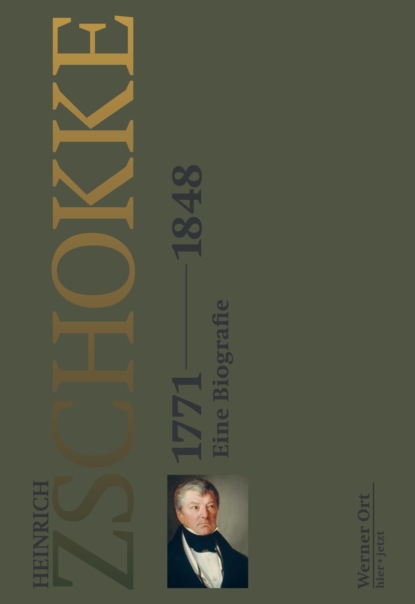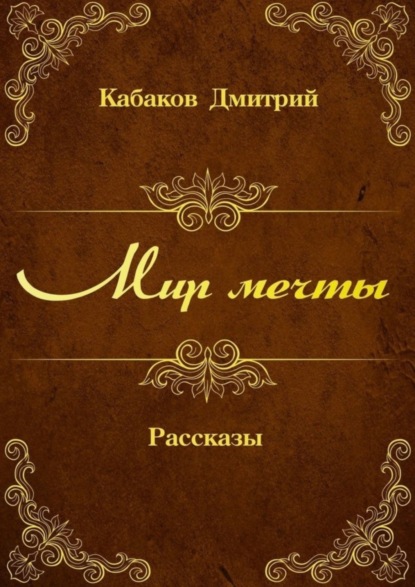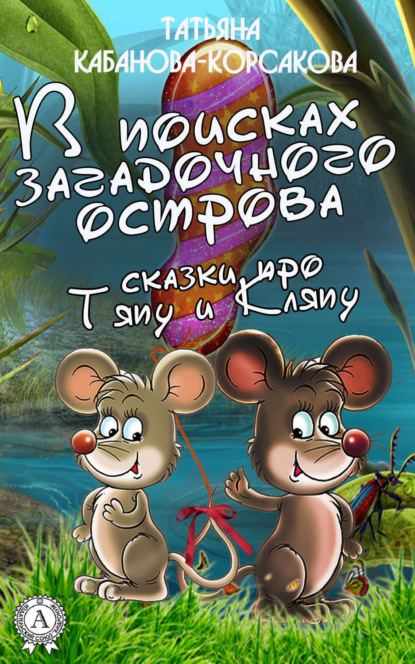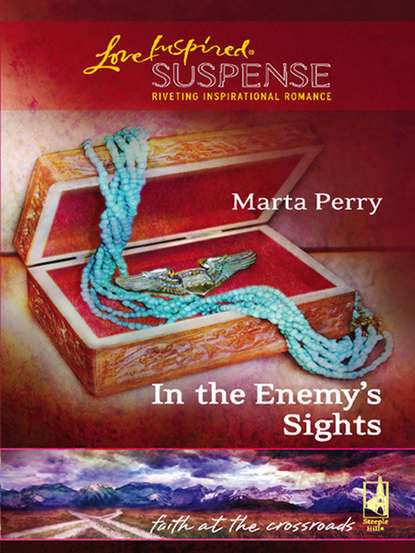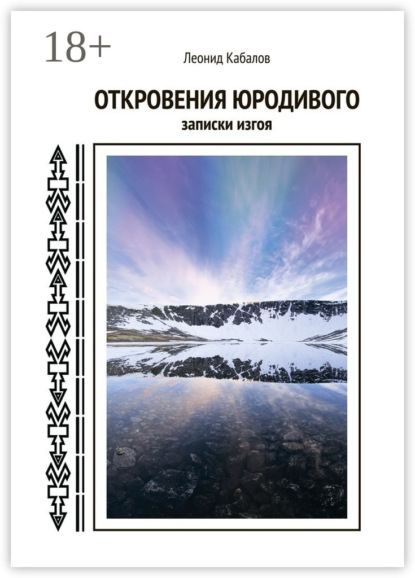- -
- 100%
- +
Günther hat sicher recht mit der Annahme, dass Woellner durch eine solche Respektlosigkeit, wenn er sie denn wahrgenommen hätte, höchstens momentan irritiert gewesen wäre. In den anderen beiden Punkten ist ihm nur teilweise beizupflichten. Woellner konnte sich durchaus nach Frankfurt (Oder) begeben haben, ohne dass dies aktenkundig geworden wäre. Womöglich fand das Geschilderte aber erst nach 1794 oder später statt, hatte also keinen Einfluss mehr auf die Ablehnung von Zschokkes Gesuch.
Es ist hingegen denkbar, dass der Minister sich bereits 1793 oder früher für Zschokke zu interessieren begann, da er als Dichter einen gewissen Ruf genoss, nicht wegen politischer oder theologischer Schriften, sondern durch seinen «Monaldeschi», den «Schriftstellerteufel» und die ersten beiden Bände der «Schwarzen Brüder». Vor allem die letztgenannten Werke, die, obwohl anonym erschienen, Zschokke ohne weiteres zugeordnet werden konnten, würden es begreiflich machen, wenn Woellner den Publikumsliebling, der an einer preussischen Universität dozierte, einmal persönlich hätte sehen wollen.
Auch folgende Anekdote ist kaum aus der Luft gegriffen: Irwing, mit dem Zschokke persönlich verkehrte, wenn er im Sommer sein Landgut in der Nähe von Frankfurt (Oder) bezog, habe ihm vertraulich mitgeteilt, Woellner habe sich unfreundlich über ihn geäussert und hinzugefügt, «man habe am wohlbekannten Dr. Bahrdt eine warnende Erfahrung gemacht, daß man keinem so jungen Menschen schon eine Professur anvertrauen solle. Ich müsse noch um ein Paar Jahre reifer werden.»317 Da Zschokke in Frankfurt einen untadeligen moralischen Ruf besass, keiner Studentenverbindung angehörte und sich politisch nicht hervortat, kann der Vergleich mit dem streitbaren Theologen und Pamphletisten Carl Friedrich Bahrdt (1741–1792),318 falls er 1793 oder zuvor erfolgte, sich eigentlich nur auf Zschokkes belletristische Schriften oder auf seine Vorlesungen beziehen, deren Beurteilung Woellner von Professor From hinterbracht worden sein könnte. Aber selbst wenn das stimmt, wäre Zschokke die Professur nicht verweigert worden und schon gar nicht wegen angeblicher Heterodoxie,319 sondern man hätte die Entscheidung einfach hinausgeschoben. Die knapp drei Semester als Privatdozent und was Zschokke bisher geliefert hatte, waren nicht ausreichend, um seine Tauglichkeit als Professor zu erkennen.
Auch in ähnlich gelagerten Fällen baute Woellner seine Druckmittel behutsam auf. Die Basis von Professoren und Theologen, die seine orthodoxe Haltung teilten, war zu schmal, als dass er alle überzeugten Aufklärer ersetzen konnte. Bahrdt, der ins Gefängnis geworfen wurde, war eine Ausnahme und diente als warnendes Exempel. Woellner setzte auf Abschreckung und auf die Lernfähigkeit preussischer Beamter, die selber merkten, wie sie sich verhalten mussten, wenn ihr Brotkorb bedroht war. Zschokke war noch jung und unerfahren, ein viel versprechendes Talent, und man konnte abwarten, was aus ihm noch werden würde. Dafür war die Ochsentour als Privatdozent ja da.
Aber dazu liess Zschokke es nicht kommen. Er brachte das laufende Semester im Frühling 1794 zu Ende und reichte die Themen seiner Vorlesungen für das Sommersemester noch ein, führte sie aber nicht durch. Im Geheimen Staatsarchiv in Berlin befindet sich eine Tabelle der von Ostern 1794 bis Ostern 1795 gehaltenen Vorlesungen, die vom 2. April 1795 datiert ist, und hier taucht Zschokke nirgends auf.320
Auch andere Indizien zeigen, dass Zschokke im Sommersemester 1794 mit seinen Vorlesungen pausierte. Kurz nach Semesterbeginn zog er aufs Land und etablierte sich auf dem Rittergut Lichtenberg, «eine kleine Meile»321 von Frankfurt (Oder).322 Dort, schrieb er einer Bekannten, wolle er «meinen ganzen Sommer verschwärmen um die Natur recht ungefesselt, in ihren täglichen und nächtlichen Reizen geniessen zu können; um wieder aufzuleben und an Geist und Körper wieder zu genesen, da mich die Stadtluft schon um Farbe und Heiterkeit der Jugend betrog und mich drei und zwanzig iährigen Knaben zum Greise umwandeln wollte».323
ABSCHIED VON FRANKFURT
Von den letzten Monaten Zschokkes in Frankfurt (Oder) wissen wir wenig. Mitte Januar 1795 war er in Berlin, erhielt Zutritt zu Gelehrten- und Familienzirkeln, lernte Theatermänner wie Johann Friedrich Ferdinand Fleck kennen und hielt in einer gelehrten Gesellschaft einen Vortrag zur Verdeutschung fremdsprachiger Literatur, der von Ernst Adolph Eschke in der Zeitschrift «Olla Potrida» kommentiert wurde.324 Viel mehr erfahren wir darüber leider nicht. Er hatte engen Kontakt mit dem Verleger Friedrich Maurer und dem Kupferstecher Johann Friedrich Bolt (1769–1836), bei dem er wohnte. Zurück in Frankfurt (Oder) schrieb er Bolt: «Seit meiner Wiederkunft in Frft. behagts mir hier wenig. Berlin hat mich wirklich noch nie so intressirt, nie so wirklich gefallen, als das leztemahl. Fast alle meine Vorurtheile wider diese Residenz hab’ ich fallen lassen.»325
Sein Entschluss war gereift, Frankfurt (Oder) und die akademische Laufbahn zu verlassen, wenigstens solange die bleierne Zeit unter Woellner andauerte.326 Er beabsichtige, schrieb er Bolt, Italien und Dalmatien aufzusuchen, um «Ardinghellos Vaterland zu durchschwärmen».327 Da Bolt ihn nicht begleite, habe er sich einen früheren Freund zum Reisegefährten genommen. Er meinte Wilhelm Burgheim,328 der sich noch immer in Landsberg aufhielt, dort malte, gärtnerte und sich im Glanz seiner kryptoadeligen Abstammung sonnte. Aber trotz der romantischen Entführungsgeschichte, die er Zschokke damals in Schwerin erzählt hatte, war er zum Ardinghello nicht ganz geeignet.
Zschokke schrieb viel und plante seine Reise, die ihn durch Deutschland in die Schweiz und von dort nach Frankreich führen sollte, falls bis zu diesem Zeitpunkt mit Preussen Frieden geschlossen war,329 oder sonst, und wenn Burgheim einwilligte, nach Italien. Dies teilte er Oberkonsistorialrat Karl Franz von Irwing mit, den er um einen Reisepass bat. «Der Aufenthalt in der Schweiz soll eigentlich für mich allein sein, der Aufenthalt in Frankreich, oder wenn dies nicht sein darf, in den unbekannten, wüsten Gegenden des venet[ianischen,] österreichischen und türkischen Dalmatiens für die Welt sein, damit ich doch auch mit meiner Reise zur Vermehrung der Länder- und Völkerkunde Nuzzen einbringe.»330 Nach zwei Jahren wolle er zurück sein und sich in der Zwischenzeit «zu einem nüzlichen und glüklichen Mann» bilden.
Aus anderen Briefen geht hervor, dass die Schweiz nicht nur Durchgang nach dem Süden oder Westen für ihn war, sondern ein Hauptziel. Seiner Schwester Christiana schrieb er, dass er sich damit einen seiner ältesten Lieblingswünsche erfülle,331 und Gottlieb Lemme bekannte er: «Nichts in der Welt, die Liebe meiner Verwandten und meiner hiesigen Freunde ausgenommen, intressirt mich mehr, als der Gedanke die Schweiz zu sehn.»332 Darüber, woher dieser Wunsch kam und wie er sich äusserte, wird noch zu reden sein.
Zschokke arbeitete die Etappenziele seiner Reise aus und bemühte sich, von Bekannten Empfehlungen zu erlangen, die ihm in der Fremde nützlich sein konnten. Er erhielt bereits einige Einladungen von «Freunden meiner Muse»,333 darunter eine bedeutsame von Johann Christoph Gottlieb Lübeck (1766–1811), der seit 1793 in Bayreuth unter der Bezeichnung «Johann Lübecks Erben» den Verlag seines Vaters führte. Lübeck löste bald Apitz als Zschokkes Verleger ab.
Zum Semesterabschluss und Abschied veranstalteten die Studenten am 18. April einen Umzug für Zschokke, um ihn hochleben zu lassen; eine Ehrenbezeugung, die «noch nie hier einem Magister widerfahren, und nur selten den Professoren, geschieht. Lieblinge der Studierenden müssen es wenigstens sein.»334 Zschokke war also an der Viadrina noch sehr präsent, auch wenn er, wie wir annahmen, seit einem Jahr keine Vorlesungen mehr hielt. Seine Beliebtheit mag zum grössten Teil auf «Die schwarzen Brüder» und «Abällino» zurückzuführen sein, der in Frankfurt (Oder) erst neulich aufgeführt worden war. Zschokke wurde aber auch als Vertreter des Mittelbaus der Universität wahrgenommen und von Studenten und Professoren als Redner geschätzt. So verfasste er noch vor seiner Abreise im Namen der Studierenden ein Festgedicht für Prof. Berends, das er vermutlich auch vortrug.335
Schon fast in den Reisekleidern wurde er am 4. Mai zum Mitglied der Sozietät der Wissenschaften und schönen Künste ernannt, «wegen seines in den schönen Wissenschaften sich erworbenen Ruhms und Verdienstes». Gemeint waren damit sicherlich auch seine «Ideen zur psychologischen Ästhetik», die so eine indirekte Würdigung erfuhren. Unterzeichnet ist das Dokument von Prof. Hausen und Dr. Dettmars.336 Hausen, der selbstverständlich von Zschokkes Abreise wusste, wünschte, ihn durch diese Ernennung an die Viadrina zu binden, und gab seiner Hoffnung Ausdruck, «daß Er für den Zweck und den Ruhm dieser Gesellschaft durch Seine gelehrten Beiträge thätigst sorgen werde». Er erteilte ihm den Auftrag, sich im Ausland nach Gelehrten umzusehen und sie der Gesellschaft als korrespondierende Mitglieder zuzuführen, was in einem Fall auch geschah,337 und sicherlich erwartete er auch, dass er ihm interessante Informationen aus den Gegenden, die er durchstreifte, mitteilte. Auch dies machte Zschokke wahr, wenngleich nur mittelbar, in seinem zweibändigen Reisebuch «(Meine) Wallfahrt nach Paris», das auch politische und kameralistische Betrachtungen enthält, wie Hausen sie wünschte.

Zschokke mit Künstlermähne und selbstbewusstem Blick im Zenith seines Ruhms als Dichter des viel gespielten «Abällino». Um seinen Freunden beim Abschied von Frankfurt (Oder) ein Geschenk zu machen, gab er im Frühling 1795 dem Berliner Freund, Kupferstecher Johann Friedrich Bolt, diese Kreidezeichnung in Auftrag, von der er eine grössere Anzahl Drucke bestellte. Bolt hatte ihn schon im Jahr vorher gezeichnet, und Zschokke verbot ihm, sein Porträt für eines seiner Bücher zu verwenden.
Am 2. Mai liess sich Zschokke als Lehrling in die Freimaurerloge «zum aufrichtigen Herzen» (au cœur sincère) in Frankfurt (Oder) aufnehmen,338 und am 8. Mai, einen Tag vor seiner Abreise, stieg er zum Gesellen und Meister auf. An diesen Daten kann kein Zweifel bestehen; sie stammen aus dem Logenarchiv und sind in einer Logengeschichte zu ihrem 150-jährigen Bestehen enthalten;339 selbst die Ernennungsurkunde ist noch vorhanden.340 Zschokke war die Frankfurter Loge schon längst vertraut; mehrere seiner Kommilitonen, darunter zwei seiner engsten Freunde, Samuel Peter Marot und Johann Gabriel Schäffer, gehörten ihr an, Marot seit 1790.341
Die Mitgliedschaft der Sozietät der Wissenschaften wurde an Zschokke herangetragen; um jene der Loge musste er sich selber bemühen. Wenn man bedenkt, wie kritisch er sich in jener Zeit gegenüber Orden und Geheimbünden äusserte, fragt man sich, was ihn zu diesem Schritt bewog. Weltanschaulich fühlte er sich der Freimaurerei verbunden; sie vertrat jene Vorstellungen, die er sich für die Menschheit der Zukunft wünschte: religiöse Toleranz, Beseitigung nationaler, konfessioneller und ständischer Schranken, Aufklärungsdenken, Einsatz für die sozial Schwachen und Armen. Alle Freimaurer waren Brüder, und als solche spielte es keine Rolle, ob einer Fürst war oder Bettler, wenn Leumund, Sittlichkeit und Gesinnung ihn zum wahren Menschen erhoben.
Breiten Raum gab Zschokke in seiner «Selbstschau» der Stellung der Freimaurerei als Mittlerin zwischen Staat und Kirche; als ihr eigentliches Ziel betrachtete er die «Verbrüderung der in Rechten, Pflichten und Hoffnungen, ursprünglich Gleichgebornen, ohne Rücksicht auf Menschenstämme, Vaterlande, Nationalreligionen u. s. w.; die Wiederanknüpfung der heiligen Bande, welche durch gesellschaftlichen und kirchlichen Zwang, durch Vorurtheile und Leidenschaften zerrissen worden sind».342 Diese Rolle konnten die Freimaurer aber keinesfalls unbehelligt spielen, da vorab die Kirche, aber auch der Staat, ihnen gegenüber Misstrauen hegte und nicht bereit war, ihnen einen politischen Einfluss oder die ihnen oft angedichtete Macht zuzugestehen. Zschokkes Idee war ein Wunsch, eine Vision, die zu den politischen Tatsachen in krassem Widerspruch stand und nur in der idealen Welt, wo er sich damals gern bewegte, realisierbar gewesen wäre.
Zudem entsprachen die Logen selber und ihre Arbeit nicht oder nur selten den Idealen Zschokkes. Es macht den Anschein, dass er der Frankfurter Loge hauptsächlich beitrat, um die Freimaurergemeinschaft von innen her zu reformieren, ihre Symbole und Rituale den höheren Zielen eines allgemeinen Menschenbundes anzupassen, auf dass demagogische und alchimistische Schwindeleien, theologische Geheimnisse und Scharlatanerien343 – die Eskapaden des Grafen von Cagliostro lagen noch nicht so lange zurück – darin keinen Platz fänden. Eine Woche nachdem er der Freimaurerloge «zum aufrichtigen Herzen» beigetreten war, einen Tag nach seiner Erhebung in den dritten Grad, verliess er Frankfurt (Oder) und nahm während der kommenden 15 Jahre an keiner Sitzung mehr teil, bis er im Herbst 1810 mit einigen Freunden in Aarau selber eine Loge gründete.
Johann Gabriel Schäffer erhielt von dem abgereisten Bruder Zschokke einen Aufsatz über den Ordenszweck zugeschickt, mit der Bitte, ihn in einer Meisterloge vorzulesen, was er aber nicht tat, da man erstens in diesen Sitzungen nicht viel über das Wesen der Freimaurerei spreche, sondern genug damit zu tun habe, die Aufnahme neuer Brüder durchzuführen, zweitens der Aufsatz manchem Meister unverdaulich sein könnte, «und endlich möchte ich nicht gern, daß Seidels Prophetie die er mir einmal in Rüksicht deiner gab: nehmlich daß nicht ein Jahr ins Land gehen würde, so würdest du reformiren wollen, jezt schon in Erfüllung gehen möchte».344 Er werde mit dem Vorschlag Zschokkes also noch zuwarten und den Aufsatz zuvor um eine Kleinigkeit ändern.
Schäffer, der Zschokkes Vorschlägen Sympathie entgegenbrachte, schätzte die Situation wohl richtig ein. Er hätte noch hinzufügen können, dass man sich in Frankfurt (Oder) (und anderswo) von einem jungen Bruder wohl nicht vorschreiben lassen wollte, wie und nach welchen Prinzipien eine Loge zu führen sei. Zschokke aber, unbekümmert um Traditionen und Realitäten, nahm seine Idee vom Wesen der Freimaurerei mit in die Schweiz und legte sie in verschiedenen Abhandlungen nieder.345
Traurig über Zschokkes Abschied waren vor allem die Frauen Apitz, Schulz und Hausen und ihre Freundinnen, die in ihren Salons verkehrten: die Ehepaare Görtz und Deutsch (beide Männer waren Apotheker), die Wilkes, Schades, Jachmanns (zwei Juristen, Brüder, die beide eine Tochter von Schulz heirateten), Kaufmann Harttung mit Familie, Madame Müller, Demoiselle Zimmerle, Minchen Badernoc. Das waren die Menschen, die Zschokke aus der Ferne grüssen liess oder die sich ihm in Antwortbriefen empfahlen, wobei er von Apitz, Schulz und den Frauen keinen einzigen Antwortbrief erhielt, was ihn sehr bedrückte. Die Freundschaften in Frankfurt (Oder) erwiesen sich, bis auf jene mit Professor Hausen und Johann Gabriel Schäffer, als brüchig. Bei dem Ehepaar Schulz lag das Verstummen vielleicht daran, dass Zschokke auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter Johanna drängte, die in ihrer Ehe unglücklicher war, als Zschokke ahnte, und von ihren Eltern nicht mit Erinnerungen an ihn belastet werden sollte.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.