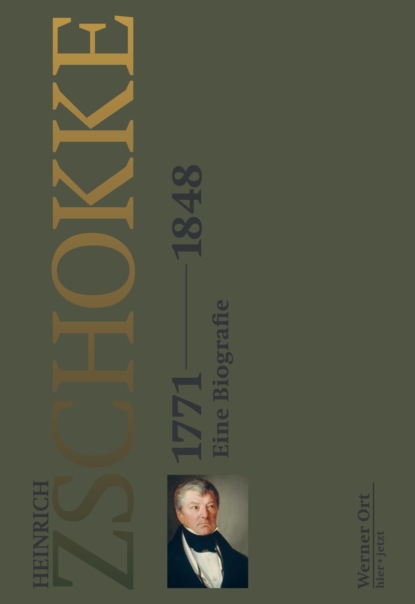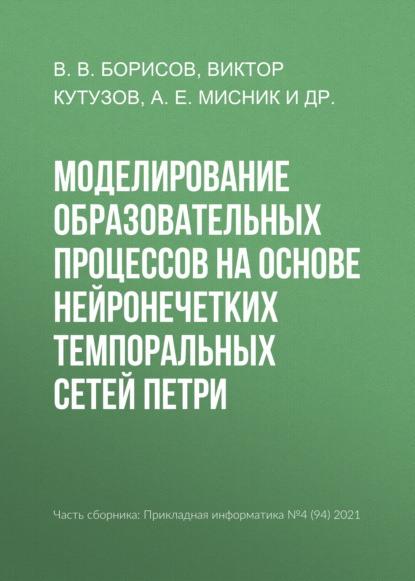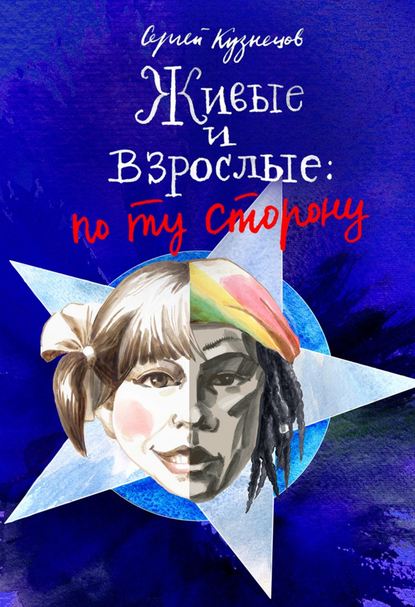- -
- 100%
- +
Wer sich der Mühe unterzieht, Zschokkes belletristisches, lyrisches und essayistisches Werk aufmerksam zu lesen, findet immer wieder Stellen, an denen er innere Spannungen, philosophische, weltanschauliche und politische Fragen aufarbeitete, die ihn damals stark beschäftigten. Was dem Germanisten oft als ein rotes Tuch erscheint, ist für den Biografen absolut notwendig: das dichterische Werk biografisch auszuwerten.
Wenn im Folgenden mit der «Selbstschau» eher kritisch umgegangen wird, dann nicht, um ihren literarischen Wert zu schmälern, sondern weil Zschokkes Faktentreue fragwürdig war. Der Biograf des 21. Jahrhunderts kann sich nicht mehr auf sie stützen; er muss alle erreichbaren Informationen einbeziehen und stösst dabei auf bedenkliche Ungenauigkeiten und Irrtümer. Hätte Zschokke ein Tagebuch hinterlassen, das er nach eigenen Angaben seit dem zwölften Lebensjahr regelmässig führte,15 so wäre es vielleicht nicht nötig, ständig auf seine Autobiografie zu rekurrieren. Man könnte sie als dichterisches Werk bestehen lassen, als farbige Schilderung von Erlebnissen, Befindlichkeiten, Lebensumständen und Betrachtungen, und müsste sie nur ergänzend für biografische Angaben heranziehen. Ohne ergiebige andere Dokumente ist sie jedoch die Hauptquelle für Zschokkes Leben, besonders für die Kindheit und Wanderjahre, die Studenten- und Dozentenzeit in Frankfurt (Oder). Erst mit der Reise in die Schweiz, im Mai 1795, sind wir nicht mehr oder nur noch teilweise auf sie angewiesen.
«Eine Selbstschau» mag ein glänzend geschriebenes Psychogramm sein, eine in sich stimmige Entwicklungsgeschichte, ein Memoiren- und Geschichtswerk von hohem Rang, sie ist aber auch ein Zurechtrücken der Vergangenheit mit pädagogischen und philosophischen Absichten. Die naive Sicht auf «Eine Selbstschau» als wirklichkeitsnahe Lebensbeschreibung änderte sich erst, als Hans Bodmer 1910 in Berlin «Zschokkes Werke in zwölf Teilen» erscheinen liess16 und «Eine Selbstschau» nach der vierten, noch von Zschokke autorisierten Auflage von 1849 wiedergab. Erstmals stellte jemand die falschen Zeitangaben und Eigennamen richtig. Bodmer holte Erkundigungen im Stadtarchiv Magdeburg und im Archiv der St. Katharinenkirche ein, erschloss weitere Quellen und griff auch auf den Bestand des Familienarchivs in Aarau, das sogenannte Zschokke-Stübchen, zurück.17 Selbst Briefe und Aktenstücke seien von Zschokke «keineswegs in authentischer Form, sondern stets mit kleineren und größeren, ganz willkürlichen Veränderungen» zitiert worden, stellte Bodmer ernüchtert fest.18 «Eine Selbstschau» war nicht mehr sakrosankt. Damit war die Zeit gekommen, Zschokkes Lebensgeschichte zu überarbeiten oder gar neu zu deuten.
Einen weiteren bedeutenden Schritt machte etwa zur gleichen Zeit Alfred Rosenbaum, der für die 2. Auflage von Karl Goedekes «Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung» alles zusammentrug und auf 56 eng beschriebenen Seiten aufführte, was von und über Zschokke in Buchform, Broschüren oder Zeitschriften erschienen war,19 darunter auch, was Zschokke als seine «Jugendsünden» bezeichnete und woran er nicht mehr erinnert werden wollte: sein dichterisches Werk vor seinem 25. Lebensjahr.20 Zwar hatte schon 1850 sein Neffe Genthe, notabene gegen Zschokkes Willen, eine solche Zusammenstellung versucht,21 aber nur sehr lückenhaft. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass Rosenbaum die bereitwillige Unterstützung der Familie Zschokke in Aarau in Anspruch nehmen konnte, die das ganze Schrifttum von und über ihren Ahnvater sammelte.
Aber selbst Goedekes Grundriss war nicht vollständig: Es fehlen die meisten kleineren Arbeiten Zschokkes, seine Aufsätze in Zeitungen und Zeitschriften, seine Reden, handschriftlichen Gutachten und Berichte als Beamter der Helvetik, im Forst- und Bergwesen, als Tagsatzungsgesandter, Grossratsmitglied und Mitglied zahlreicher Kommissionen und privater Gesellschaften, die meisten seiner Gedichte, die Kompositionen und, was die Sekundärliteratur betrifft, die Zeitungsartikel, soweit es sich nicht um Rezensionen handelte. Weiterhin ist die Arbeit Rosenbaums und seiner Nachfolger für die Zschokke-Forschung unentbehrlich, aber seither wurden einige neue, grössere Werke Zschokkes entdeckt, so durch Carl Günther und neuerdings den Heidelberger Bücherforscher Adrian Braunbehrens zwei Erstlingsromane.22 Es wäre also an der Zeit, das Literaturverzeichnis auf den neusten Stand zu bringen, sich vielleicht auch um eine textkritische Neuausgabe seiner Werke zu bemühen.
In der Nachfolge Bodmers und Rosenbaums begannen auch Mitglieder der Familie Zschokke, die über die bedeutendste Materialsammlung zu Zschokke verfügte, einen Beitrag an die Revision seiner Lebensgeschichte zu leisten. Eine eigentliche Pionierarbeit erbrachte Carl Günther (1890–1956), als er während des Ersten Weltkriegs für seine Dissertation über «Heinrich Zschokkes Jugend- und Bildungsjahre» unabhängig von der «Selbstschau» Nachforschungen betrieb und allen noch zugänglichen Spuren nachging.23 Bald stellte auch er fest, dass die «Selbstschau» viele falsche und irreführende Aussagen enthielt, und kommentierte dies so: «Zschokke vermochte sich nicht mehr genau aller Daten zu erinnern, seine Phantasie hatte, was ihm noch gegenwärtig war, umgearbeitet, die Forderung einer streng historischen Darstellung war ihm fremd: so rekonstruierte er sein Leben, unbekümmert darum, ob die Rekonstruktion auch überall der geschichtlichen Wirklichkeit entspreche. Dass aber irgendwo bewusste Fälschung vorliege, ist nicht wahrscheinlich.»24
Günther benutzte alle ihm zugänglichen Archive, wo er Dokumente vermutete, las, wie schon Hans Bodmer vor ihm, was Zschokke geschrieben hatte oder was über ihn erschienen war. Er benutzte dazu auch die reichhaltige Sammlung seines Onkels Ernst Zschokke (1864–1937) in Aarau, der sich in der Nachfolge von Emil Zschokke, seinem Grossvater, als Sachwalter von Heinrich Zschokkes schriftlichem Nachlass sah. Günther war zudem vertraut mit dem in Aarau liegenden Briefwechsel Zschokkes und stand in Korrespondenz und im Austausch mit privaten Sammlern von Zschokkiana, Nachfahren von Freunden oder Verwandten Zschokkes und mit Lokalhistorikern.25
Auch Günther hatte ein Zeitfenster der Zschokkeforschung zur Verfügung und ging wohl davon aus, dass andere seine Schilderung über das Jahr 1798 hinaus weiterführen würden. Wie jeder Forscher hoffte er, mit seiner Arbeit einen Stein ins Rollen gebracht zu haben und zu weiteren Studien anzuregen. Tatsächlich übernahm Helmut Zschokke (1908–1978), Nachkomme aus einem anderen Zweig der zahlreichen Familie, die Aufgabe, das fast unüberschaubare Material der Helvetik in öffentlichen und privaten Archiven zu sichten und die Jahre 1798 bis 1801 zu beschreiben.26 Die Herausgabe seiner umfangreichen und fast fertig gestellten Dissertation wurde vereitelt, als er wegen seines Engagements im spanischen Bürgerkrieg 1938 in der Schweiz zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt und von der Universität Zürich relegiert wurde.
Carl Günthers Zeitfenster ging gegen das Ende des Zweiten Weltkriegs zu. Verschiedene Privatnachlässe aus Deutschland sind seither verschollen, Kirchen-, Stadt- und Staatsarchive teilweise vernichtet und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften nicht mehr auffindbar. Besonders schmerzlich ist die Lücke im Stadtarchiv Magdeburg, wo die «Alten Akten» mit den Anfangsbuchstaben A bis O fehlen, oder in der Königlichen Staatsbibliothek Breslau (heute Wrocław), mit deren Vernichtung auch die Dokumente der Universität Frankfurt (Oder) untergingen.
Zum Glück rollte der Magdeburger Genealoge Willi Bluhme in der Zwischenkriegszeit die Familiengeschichte Zschokkes anhand von Bürgermatrikeln und Kirchenbucheintragungen auf,27 so dass wir in Ermangelung der Originalakten einen kleinen eisernen Bestand gesicherter Daten über Zschokkes Vorfahren und Magdeburger Verwandte besitzen. Der Zschokke-Biograf nutzt sie ebenso dankbar wie alles, was Carl Günther vor 95 Jahren fand und in seiner Dissertation auswertete.
Im Übergang zum neuen Jahrtausend hat sich zum Glück ein neues Fenster geöffnet: Von 1990 bis 2000 nahm sich die Zschokke-Briefforschungsstelle in Bayreuth unter der Leitung der Professoren Robert Hinderling und Rémy Charbon und im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) des Briefwechsels von Zschokke an, den sie systematisch und weltweit sammelte und damit das Korpus der bekannten Briefe auf über 6000 Einheiten erweiterte. Einige wesentliche Schweizer Bestände, auf die Günther noch nicht zurückgreifen konnte, stehen nun ebenfalls zur Verfügung: das ausgedehnte Archiv des Sauerländer-Verlags (jetzt im Staatsarchiv des Kantons Aargau) und der schriftliche Nachlass der Familie Tscharner im Staatsarchiv des Kantons Graubünden, um nur zwei zu nennen. Ohne sie und zahlreiche Dokumente und Hinweise aus anderen Archiven und Bibliotheken, von Bekannten und Mitgliedern der Familie Zschokke, ohne den Schweizerischen Nationalfonds, der während sechs Jahren die Edition von Teilen des Zschokke-Briefwechsels ermöglichte, und ohne die Unterstützung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel und zahlreicher anderer privater und öffentlicher Geldgeber wäre die Biografie nicht in dieser Reichhaltigkeit möglich gewesen.
Die Gründung der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft im Frühjahr 2000 schuf die Voraussetzung, um die Forschungen zu Zschokke weiter voranzutreiben, zu vertiefen und den meisten Spuren nachzugehen. Als Folge davon entstanden in den vergangenen Jahren grössere und kleinere Publikationen, als deren Abschluss diese Zschokke-Biografie zu betrachten ist. Damit ist ein Etappenziel erreicht, aber noch kein Ende; es ist zu wünschen, dass diese Publikation die Zschokke-Forschung auf einer breiteren Basis anregt und vielleicht auch das eine oder andere Ergebnis hinzufügt, neu deutet oder relativiert. Der Verfasser betrachtet seine Biografie als eine Annäherung an sein Thema.

NACHZÜGLER UND WAISENKIND
Am 22. März 1771 um zwei Uhr nachmittags kam an der Schrotdorfer Strasse 2 in Magdeburg ein Sohn zur Welt, Kind des ehrbaren Tuchmachers Johann Gottfried Schocke (1722–1779) und seiner Ehefrau Dorothee Elisabeth Schocke, geborene Jordan (1727–1772). Die «Magdeburgische Zeitung» verzeichnete in jenem März einen frostigen Frühjahrsbeginn.1 Am Gründonnerstag, dem 28. März, wurde er in der St. Katharinenkirche auf den Namen Johann Heinrich Daniel getauft: Johann nach dem Vater und wie drei seiner Brüder; Heinrich nach dem Paten Heinrich Ludowig Brand, einem Kontrolleur bei der königlichen Akzise (Steuerinspektor) und Daniel nach dem zweiten Paten, Tuchscherer Daniel Schächer.2 Aber nur der Name Heinrich, den schon ein kurz nach der Geburt gestorbener Bruder getragen hatte, blieb in Gebrauch.3
Wurde Heinrich, jüngstes von elf Kindern, geliebt, war er ein Wunschkind? Diese Frage stellte sich zu jener Zeit kaum. Eine Familienplanung gab es im Handwerkerstand nicht, und wenn Frauen früh heirateten und alle Geburten überlebten, waren Familien mit zehn, zwölf oder fünfzehn Kindern keine Seltenheit. Die Hälfte der Kinder starb früh, geschwächt durch Mangelernährung, dahingerafft von Epidemien, so dass es für die Eltern von Vorteil war, sich gefühlsmässig nicht stark an sie zu binden. Vier seiner Brüder und zwei seiner Schwestern lernte Heinrich nie kennen; einige hatten die ersten beiden Lebensjahre nicht überstanden. Ein Kind, das sich gesund entwickelte und das Erwachsenenalter erreichte, war im Nordwesten Magdeburgs, wo sich in einem Gewirr von Gassen, in schlecht gebauten, dumpfen, kleinen Häusern mit engen Stuben, die Strumpfwirk- und Webstühle aneinander reihten, fast schon ein Glücksfall. Ein Reisender, vermutlich Arzt aus Berlin, schilderte den elenden Zustand dieser Kinder:
«Es war mir ein äusserst rührender und schrecklicher Anblick, als ich die Schrotdorfer Baracken, wo alles von Kindern wimmelt, und einige Gassen in der Gegend der Hohenpforte, auch in der Neustadt und den anderen Vorstädten durchgieng, und da unter sechse kaum ein Kind von gesunder Gesichtsfarbe und körperlicher Gestalt bemerkte; mehrentheils sahe ich bleiche aufgedunsene Gesichter, dicke ungestaltete Leiber, krumme gebrechliche Füße, mitleidenswürdige Figuren vor mir. Ich nahm Gelegenheit, mit Eltern, denen solche Kinder angehörten, zu sprechen, und hörte da zu meinem grösseren Erstaunen, daß so ein elendes Kind von 6, 8, 10, die sie gehabt hatten, das einzige Ueberbleibsel sey, oder daß sie noch elendere krank liegen hatten.»4
Beide Elternteile starben früh, die Mutter, als Heinrich knapp ein Jahr, der Vater, als er acht Jahre alt war. An seine Mutter hatte Heinrich keinerlei persönliche Erinnerungen, besass auch keine Gegenstände, die mit ihr zu tun hatten. Sie sei eine schöne Frau gewesen, erzählte man ihm, habe ihn sterbend noch in den Arm genommen und geseufzt: «Armer Junge, warum bist du nicht ein Kirschkern, den ich hinabschlingen und mit mir ins Grab nehmen könnte!»5 Heinrich konnte sich nicht bewusst an sie erinnern; in «Eine Selbstschau» liess er sie noch im Kindbett sterben und nicht erst ein Jahr später.
Anders stand er zu seinem Vater; an ihm hingen seine Gefühle wie das Schiff an einem Anker; mit seinem Tod blieben Trostlosigkeit und eine grosse Leere zurück. Als Zschokke seine Lebensgeschichte niederschrieb, war die Erfahrung, früh eine Vollwaise geworden zu sein und niemanden gehabt zu haben, der ihn lieb hatte, immer noch lebhaft und schmerzlich. Heinrichs Welt verdüsterte sich. Neben einer Garnitur silberner Schnallen, einer silbernen Schnupftabaksdose, einem spanischen Rohr mit silbernem Knopf, Dokumenten und etwas Geld, das sein Vormund für ihn verwahrte,6 war ein Ausspruch des Vaters persönliches Vermächtnis – in der prägnanten Diktion Luthers: «Christum lieb haben, ist beßer denn alles Wissen.»7
Eigenartigerweise wusste Zschokke auch von seinem Vater fast nichts, nicht einmal die Lebensdaten. Er sei ein geachteter Tuchmacher gewesen, der es mit Tuchlieferungen für die Armee zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht habe, Oberältester seiner Innung oder dergleichen.8 Heinrich sei sein Schosskind gewesen, das er zärtlich geliebt und mit Nachsicht behandelt habe. Er habe ihn am Sonntag in die Kirche mitgenommen und dreimal am Tag laut beten lassen. Heinrich Zschokke hielt sich an diese spärlichen gemeinsamen Erlebnisse und malte sich das Übrige aus. Als der zwei Jahre ältere Neffe Gottlieb Lemme ihm viel später einiges vom Vater erzählte, antwortete er gerührt:
«Dein Gedächtniß ist treuer von jener Zeit, als das meinige. Du hast mir das Bild meines lieben Vaters, unter neuer Gestalt, wie ich sie mir nie zu denken pflegte wiedergegeben. Ich sehe ihn vor mir in deiner Malerei. O ich bitte Dich, sage mir doch alles deßen Du Dich von dem verewigten Guten erinnerst; Alles – ich weiß viel zu wenig von ihm! – Selbst das Dreiek auf den Silberknöpfen seines grünen Cashaquin’s9 ist mir wichtiger, & das Köstlichste was von Antiken in Herkulanum, Theben & Nubien ausgegraben wird.»10
Das Elternhaus wurde zwei Monate nach dem Tod des Vaters geräumt; Arbeitsgeräte und Mobiliar wurden in der «Magdeburgischen Zeitung» ausgeschrieben und versteigert.11 Das Haus ging für 520 Taler an die zweitälteste Tochter Friederica Elisabeth Nitze (1753–1816), eine Bäckersfrau.12 Im Familienrat wurde beschlossen, Heinrich dessen Bruder Johann Andreas Schocke (1747–1812) in Pflege zu geben, der bereits zwei eigene Kinder hatte.
STADT DER TUCHMACHER UND SOLDATEN
Viel wissen auch wir nicht über Zschokkes Vater. Er wurde als Johann Gottfried Tzschucke am 20. Oktober 1722 in Oschatz, einer sächsischen Kleinstadt östlich von Leipzig geboren, als ältester Sohn einer Tuchmacherfamilie.13 Schon der Oschatzer Stammvater Andreas Tzschucke (1627–1714), der aus dem sächsischen Rosswein eingewandert war und 1648 die Tochter und Enkelin eines angesehenen Oschatzer Berufskollegen heiratete, übte diesen Beruf aus. Der Berufszweig stand in Oschatz in Blüte: 1787 zählte man 62 Webstühle, auf denen jährlich 2000 Stück Tuch verarbeitet wurden,14 und noch 1815 bildeten die Tuchmacher die zahlenmässig stärkste Handwerkerzunft; sie war mit 126 Meistern fast doppelt so gross wie die nächst folgende der Schuhmacher.15
Die Schreibweise des Namens Zschokke erfuhr einen mehrfachen Wandel. In den Kirchenbüchern von Oschatz wurde er unterschiedlich geschrieben, da die Pfarrer sich hauptsächlich nach dem Gehör richteten: Tzucke, Tzschucke, Tzschocke, Zschocke, Zschucke, Zschuck oder Zschock.16 Die Herkunft des Namens war, wie in der Nähe der Elbe häufig, slawisch, genauer sorbisch, da das Volk der Sorben in jener Gegend weit verbreitet war.17 Nach einer Familienüberlieferung leitete sich Zschokke vom sorbischen Tschucka für Erbse ab.18 Andere damals existierende Deutungen zeigen, dass sich die Familie Zschokke später rege mit der Frage ihrer Herkunft befasste.19
Eine Zeitlang kursierte unter Zschokkes Söhnen das Gerücht, man sei adligen Ursprungs. Einen Hinweis darauf bot eine Anekdote Zschokkes, der sich im Übrigen kaum um dieses Thema kümmerte: Ein aus Norddeutschland stammender Herr von Tschock habe ihn in Frankfurt (Oder) einmal aufgefordert, seinen Adel registrieren zu lassen. Die Familie sei von alters her blaublütig, wenn auch der Zweig, dem Heinrich Zschokke entstammte, im Lauf der Zeit «hinabgekommen» sei. Der 17-jährige Sohn Achilles Zschokke, damals gerade Redaktor der handgeschriebenen Familienzeitung «Der Blumenhaldner», fügte hinzu, sein Vater habe den Rat des Herrn von Tschock verschmäht, da ihm das «von» vor dem Namen unnütz erschienen sei.20 Der Zschokke-Biograf Carl Günther meint aus der Kopf- und Gesichtsform Zschokkes, wie sie in vielen Porträts vermittelt wird, slawische Züge zu erkennen.21 Jedenfalls erleichterten es ihm das Slawische, Sächsische, Preussische und über die Mutter auch das Hugenottische seiner Abstammung, sich als Weltbürger zu fühlen.
In den Magdeburger Kirchenbüchern und Bürgermatrikeln finden sich nebeneinander Schocke und Schock. Da der Name mit der Witwe von Heinrichs Bruder Andreas Schocke 1819 in Magdeburg erlosch, stammen alle heute noch lebenden Verwandten der männlichen Linie, falls sie nicht Heinrich Zschokkes Nachkommen aus Aarau sind, von den Oschatzer Verwandten ab und heissen oft Zschucke, Tschucke oder Tschocke.22 Was Johann Gottfried Tzschucke aus Bequemlichkeit für sich und seine Nachkommen in Magdeburg beschloss: die Eindeutschung des Namens zu Schocke, machte sein Sohn Heinrich als Gymnasiast wieder rückgängig. Er fügte das Anfangs-Z wieder hinzu, veränderte «ck» in «kk» und schrieb sich fortan Zschokke. Daran hielt er unbeirrt bis an sein Lebensende fest. Nicht etwa Slawophilie oder ein Hang für die Familienvergangenheit waren das Motiv dafür, sondern sein Interesse für Geschichte. Wie er seinen Söhnen mitteilte, stiess er bei der Lektüre eines bekannten Geschichtswerks auf einen österreichischen General Zschock, fand den Namen attraktiv und nannte sich ihm nach.23
Um diese Namensänderung rankt sich ebenfalls eine Anekdote: Danach soll Bürgermeister Blankenbach, der als Scholarch und Vertreter des Magistrats von Magdeburg der Prüfung am Altstädtischen Gymnasium beiwohnte, Heinrich zur Rede gestellt haben: «Warum verändert Er seinen Namen? Sein Vater war ein ehrlicher Mann, der nannte sich Schocke; wenn die Erbschaft aus Lissabon ankommt, soll Er nichts davon abhaben.»24 Ob die Schockes wirklich Verwandte in Portugal besassen, ist unklar. Zschokke hatte die Genugtuung, dass sein um ein Jahr jüngerer Neffe Friedrich später seine neu-alte Schreibweise übernahm,25 ebenso auch die verheirateten Schwestern.
Wirtschaftliche Gründe bewogen wohl Johann Gottfried Tzschucke, schon in jungen Jahren von Oschatz wegzuziehen. Abenteuerlust kann es nicht gewesen sein, sonst wäre er sicherlich weiter weg gereist. Er wird einige Zeit nach dem ersten schlesischen Krieg (1740–1742) nach Magdeburg gekommen sein, in eine aufstrebende Stadt, grösser und attraktiver als Oschatz. 1738 war dort die Tuchmacherinnung gegründet worden, die den Zugang zum Gewerbe regelte und in die Schocke nach wenigen Jahren aufgenommen wurde. Am 13. August 1746 erhielt er durch ein königliches Reskript das Magdeburger Bürgerrecht und ehelichte zwei Monate später, am 23. Oktober, Jungfer Dorothea Elisabeth,26 jüngste Tochter des verstorbenen Tuchmacher-Altmeisters Joachim Peter Jordan.
Falls die Jordans hugenottischen Ursprungs waren, so kamen sie noch vor dem zweiten grossen Exodus nach der Aufhebung des Toleranzedikts von Nantes durch Ludwig XIV. im Oktober 1685 nach Magdeburg und assimilierten sich schnell. Seit 1714 besassen sie das Bürgerrecht der Stadt und gehörten der evangelischen St. Katharinengemeinde an, wo auch Heinrich Zschokke und seine Geschwister getauft und konfirmiert wurden.27
In der Familie Schocke herrschte ein ausgeprägter Berufsstolz: Ein achtbarer Tuchmacher zu sein, wurde als persönliche Auszeichnung empfunden. Da Heinrichs Vater, sein Bruder Andreas, der Onkel in Oschatz, die beiden Grossväter und drei der vier Urgrossväter diesen Beruf ausgeübt hatten, war es ausgemacht, dass er ebenfalls Tuchmacher würde. Man musste sich also um seine Schulbildung und Zukunft nicht besonders kümmern.
Magdeburg war um 1771 eine Stadt mit gegen 25 000 Einwohnern, nicht gezählt die mehreren tausend Armeeangehörigen mit ihren Familien.28 Im 17. und 18. Jahrhundert hatten sich das Verlagssystem und Manufakturwesen stark entwickelt. Vorab Textil-, Tabak- und Töpferwaren wurden massenweise hergestellt, wobei dem Elbschiffverkehr bis Hamburg eine besondere Rolle zufiel.29 Die Ansiedlung von Hugenotten hatte der Seiden-, Woll-, Baumwoll- und Leinenweberei, der Strumpfwirkerei und Strumpfstrickerei zu einem beachtlichen Aufschwung verholfen.
Die Stadt war von dicken Wällen, Gräben, Bastionen und Zitadellen umgeben, die Bevölkerung fühlte sich aber auch eingeschlossen: «Bei Annäherung an die Stadt, beim Durchschreiten oder Durchfahren der Festungswerke verstärkten die verwinkelten, über Grabenbrücken und durch Walltunnel geführten Straßen sowie die Doppeltoranlagen, die ständig mit Torwachen besetzt waren, diesen Eindruck.»30 Die Festungsanlagen umfassten 200 Hektaren gegenüber 120 Hektaren Stadtareal, so dass die bewohnbare Stadt flächenmässig wie eine Beigabe zur Festung wirkte. Der Enge im Norden Magdeburgs, wo sich die Arbeiter drängten und auch die Schockes wohnten, konnte man sich nur entziehen, wenn man vor die Tore, in die Neustadt, nach Friedrichsstadt oder Sudenburg zog.
In vielerlei Hinsicht war die Garnison autark: Sie besass eine eigene Verwaltung und Justiz, eigene Schulen und medizinische Versorgung. Die Stadt zog manche Vorteile aus ihrer Lage als stärkste Festung Preussens: Die Könige schenkten ihr mehr Aufmerksamkeit als einer anderen Provinzstadt, zumal der Hof Friedrichs II. im Siebenjährigen Krieg hier zeitweilig Zuflucht fand. Es wurde viel gebaut und ausgebessert, aber auch die erhöhte Kaufkraft war spürbar. Die militärische Präsenz mit zwei Infanterieregimentern, zwei Grenadierbataillonen und einer Artilleriekompanie31 kam dem Handwerk, vor allem dem Wolltuchgewerbe, zugute: Uniformen aus diesem Material spielten in der preussischen Armee eine wichtige Rolle.
In der Magdeburger Altstadt war die Tuchmacherinnung gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit 837 Arbeitskräften vertreten: 70 Meistern oder Witwen von Meistern, 40 Gesellen, 11 Lehrburschen und 716 Gehilfen (39 Wollkämmer, die übrigen Wollspinner).32 Über zehn Prozent der 8154 «Professionisten» befassten sich mit der Herstellung von Wolltüchern. Ob Johann Gottfried Schocke tatsächlich durch bedeutende Tuchlieferungen für die preussische Armee reich wurde, wie Zschokke behauptete,33 darf bezweifelt werden. Dagegen sprechen die kleinräumlichen Verhältnisse, in denen er lebte, und die wenigen Arbeitsgeräte, die nach seinem Tod versteigert wurden. Wie viele Tuchweber er beschäftigte oder ob er auch Tücher von eigenständig arbeitenden Webern kaufte und verkaufte, wissen wir allerdings nicht.
Schocke war ein Tuchhersteller, ein Tuchhändler aber war er nicht; diese besassen ihre eigene Zunft: die Gewandschneiderinnung mit einem Haus am Alten Markt.34 Es gibt keinen Hinweis, dass Schocke dieser Zunft ebenfalls angehörte. Dagegen war er Altmeister der Tuchmacherinnung und leitete als Präses (Vorsitzender) ihre Sitzungen. Im Stadtarchiv Magdeburg ist ein Protokollheft, das mit dem 6. September 1777 einsetzt. An dieser Sitzung nahm auch Schocke junior teil, Heinrichs Bruder Andreas. Später lassen sich die Anwesenden nicht mehr feststellen; die Eingangsformel lautete: «Bey der heutigen Zusammenkunft der Alt- und Schaumeister [...]», ohne weitere Angaben. Bei solchen Anlässen wurde die Aufnahme neuer Meister in die Innung beschlossen; Bedingung war eine abgeschlossene Lehrzeit, das Bürgerrecht von Magdeburg und ein Meisterstück. Vater Schocke war für die jährliche Rechnungsablegung verantwortlich.