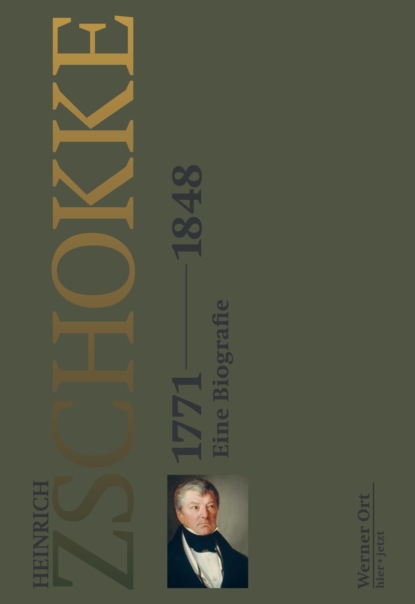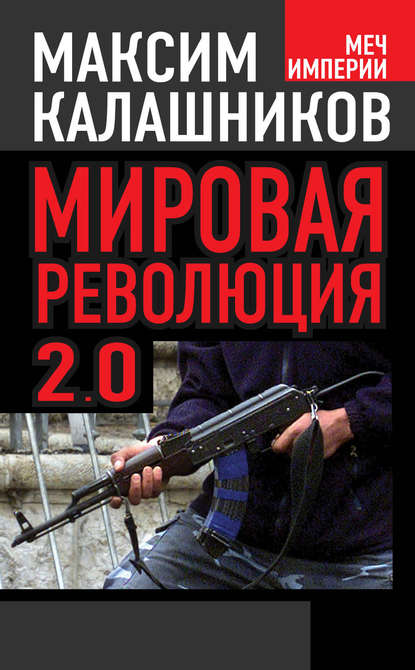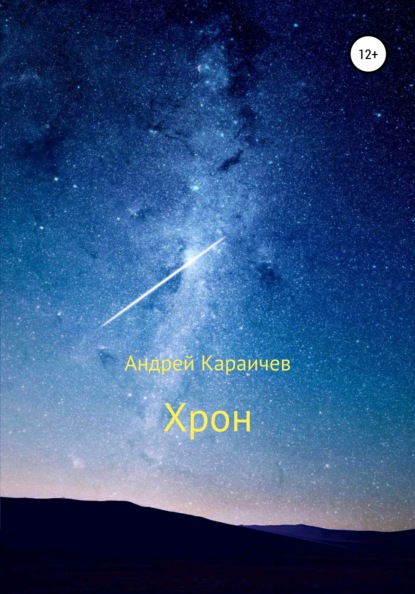- -
- 100%
- +

Magdeburg war geprägt durch die Elbe, ihre doppeltürmigen Kirchen und die Wallanlagen, welche die Stadt im 18. Jahrhundert zu einer unbezwingbaren Festung machten. In der Mitte des Flusses befand sich eine Zitadelle, welche die Stadt auch von dieser Seite schützen sollte. Ausschnitt aus einem Kupferstich des 18. Jahrhunderts.
Am 5. April 1779 liest man den Eintrag: «[...] Sollte eigentlich der Altmeister Nieschke sein Amt niederlegen; allein weil der Altmeister Schocke noch sehr krank ist, wurde festgelegt daß Meister Nieschke das Altmeister Amt bis zu Meister Schockens Wieder Gesundung versehen solle.» Da Schocke zwei Wochen später starb, rückte am 17. Mai der älteste Schaumeister zum Altmeister nach. Es galt dabei das Prinzip der Anciennität; man achtete ferner darauf, dass zwei Altmeister vorhanden waren, von denen der jüngere den «Oberältesten» in der Leitung der Innung ablösen konnte.35
ERSTE KINDHEITSERINNERUNG
Johann Gottfried Schocke hatte am 14. Mai 1757 in der Schrotdorfer Strasse 2 ein kleines zweistöckiges Haus erworben, das von einem einst doppelt so breiten Gebäude abgetrennt worden war und nach vorne eine Tür und zwei Fenster, im oberen Stock drei Fenster besass. Zur rechten Hand war eine schmale Gasse mit Hoftor, die später den Namen Fabriken Strasse erhielt. Eine Bleistiftzeichnung von 1828 und eine Tuschzeichnung, die um 1842 entstand, zeigen das Haus, in dem Heinrich und seine Geschwister geboren wurden.
Die Bezeichnung Schrotdorfer Strasse oder Grosse Schrotdorfer Strasse (um sie von der Kleinen Schrotdorfer Strasse zu unterscheiden) war eine gewaltige Übertreibung. Die einzige wirkliche Strasse in diesem Quartier war der Breite Weg, der die Stadt von Norden nach Süden durchquerte, durch den sich der Hauptverkehr wälzte und an der sich die Läden und Gasthäuser befanden. Die Einmündung vom Breiten Weg in die Schrotdorfer Strasse lag der Katharinenkirche gegenüber; es war eine Sackgasse mit Krümmungen und Verengungen, die auf die Casernen (oder Baraquen) Strasse mit Soldatenhäusern mündete, welche auf der Nordwestseite Magdeburgs der inneren Festungsmauer entlanglief. Ursprünglich hatte sich hier einmal ein Tor befunden, das zu einem Dorf mit dem Namen Schrotdorf geführt hatte.36
Wer sich heute in der Stadt bewegt, dem fällt es schwer, sich das Magdeburg von damals vor Augen zu führen. Durch die britische Bombardierung am 16. Januar 1945 – an der Peripherie der Stadt waren wichtige Kriegsbetriebe angesiedelt – wurde die nördliche und mittlere Altstadt in Schutt und Asche gelegt. Beinahe alle Häuser der Innenstadt waren zerstört oder schwer beschädigt.37 Nach den Aufräumarbeiten war der Stadtkern eine leere Fläche, aus welcher Kirchenruinen und einzelne weniger beschädigte Häuser wie Zahnstummeln ragten. Das DDR-Regime verzichtete auf eine Restaurierung und versuchte, eine sozialistische Vision zu verwirklichen, wie sie teilweise schon Otto von Guericke nach der ersten Zerstörung Magdeburgs 1631 entwickelt hatte: mit breiten Strassen und zentralen Achsen.38 Vom Nordwesten der Stadt blieb nichts mehr übrig, als 1966 auf Geheiss des Staatsratsvorsitzenden Walther Ulbricht und gegen den Willen der Magdeburger die beiden Türme der Katharinenkirche eingeebnet wurden.39 Stattdessen entstand ein Plattenbau, Haus der Lehrer genannt. Seit 2000 befindet sich auf dem Gehsteig als Mahnmal der Zerstörung ein Bronzemodell.
An die Schrotdorfer Strasse erinnert nichts mehr; nicht einmal die Strassenführung ist noch erkennbar. Dort stehen heute einfallslose, hintereinander gestaffelte Hochhäuser und davor, am Breiten Weg, zweigeschossige Läden und Baracken, die noch verlotterter wirken als die omnipräsenten Plattenbauten, die seit 1989 «rückgebaut», das heisst abgerissen werden. Als Hans W. Schuster, der sich um die Rettung der alten Bausubstanz Magdeburgs verdient gemacht hatte, im Auftrag der Heinrich-Zschokke-Gesellschaft eine Bronzetafel zum Gedenken an Heinrich Zschokke goss, war es nicht mehr möglich, sie dort anzubringen, wo einmal dessen Elternhaus stand. Der Standort wurde nach Westen versetzt, ins Gebiet der früheren Festungsanlagen, wo sich nun gegenüber der Universität ein Park befindet, und an die (neue) Zschokkestrasse, die 2001 durch den Einsatz der Literarischen Gesellschaft von Magdeburg und der Gesellschaft von 1990 umgetauft wurde.40

Zschokkes Geburtshaus an der Schrotdorfer Strasse 2, nach einer Federzeichnung von 1842 oder 1843. Im rechten Teil dieses Doppelhauses kamen auch Zschokkes acht Geschwister zur Welt. Das Gässlein rechts, die spätere Fabriken Strasse, hatte damals noch keinen Namen und war nur fussgängerbreit. Von hier ging ein Tor in den Hof.
Als im April 1827 Zschokkes zweitältester Sohn Emil nach Magdeburg kam, traf er noch vieles so an, wie sein Vater es erlebt hatte: den belebten Breiten Weg, wo die Kaufleute, Kornhändler, Brauer, Branntweinbrenner und Bäcker dicht an dicht ihre Geschäfte betrieben, die Katharinenkirche, die Strassen mit ihren niedrigen Riegelhäusern.41 Seine Eindrücke hielt er in der Artikelreihe «Erinnerungen aus Magdeburg» für seine Geschwister im «Blumenhaldner» fest.42 Mit seinem Vetter, Zschokkes Kindheitsfreund Gottlieb Lemme, besuchte er auch das Elternhaus. Die Seitenstrassen, stellte er fest, seien in dieser Gegend so schmal, dass man sie besser Gässchen nennen würde:
«Sie führen in die entlegenen Quartiere der Stadt, die sich an die innern Seiten der Festungswälle anlehnen, und bieten dem Fremden nicht die mindesten Sehenswürdigkeiten dar und werden darum auch selten von solchen besucht. Für den Blumenhaldner aber enthält zumal die leztgenannte [...] die größte, ihm heiligste Merkwürdigkeit Magdeburgs. Es steht da ein kleines graues Haus mit grünen Fensterläden, das, weil hier die Schrotdorfer-Gaße von einer andern durchkreuzt ist, zum Ekhause wird. Es ist nur zwei bis 3 Fensterlängen breit, und ein Stokwerk hoch. Auf seiner hintern Seite muß ein geräumiger Hofraum sich ausbreiten, der aber von einer hohen Mauer von dem obengenannten Quergäßchen geschieden ist. Die festgeschloßene Hofthür, welche in der Mauer angebracht ist, gewährt dem Neugierigen keinen Blik hinein. Nur einige überhängende grüne Zweige laßen ahnen, daß sich darin freundliche Schattengänge befinden. Zu diesem Hause führte uns Lemme einmal, und sprach, indem er ernst darauf wies: ‹Seht da ist Euer Vater geboren.›»43
Hier also verlebte Heinrich Zschokke die ersten acht Jahre seiner Kindheit, zusammen mit seinem Vater, der jüngsten Schwester Christiana Catharina und der nächst älteren Schwester Friederica Elisabeth, die 1775 heiratete und aus dem Elternhaus wegzog. Es ist anzunehmen, dass sich nach dem Tod der Mutter wenigstens eine weibliche Person um die beiden Kinder kümmerte. Vielleicht war dies in den ersten Jahren die ältere Schwester.
Das erste Kindheitserlebnis, das Zschokke anführt, war ein Komet, der 1774 über der Stadt erschien und die Bürger in Besorgnis versetzte. Man habe darin die Zornrute Gottes erblickt. Der Vater sei mit seinen drei Töchtern vor die Türe getreten und habe den kleinen Heinrich allein in der Stube gelassen.
«Ich bebte vor Entsetzen, zog grausend die kleinen Füße an mich auf den breiten, ledernen Lehnstuhl, und wagte kaum zu athmen. Denn ich stellte mir draußen die strahlende Zornruthe, hingestreckt durch die Nacht über eine schaudernde Welt, vor, und wie von der Welt dahin tausend leichenblasse Menschengesichter schweigend emporstarrten.»44
Heinrich war damals drei Jahre alt (in der «Selbstschau» gab er sich ein Jahr mehr), und es ist kaum anzunehmen, dass ihn in diesem Alter schon ein metaphysisches Gruseln packte. Ausserdem lebten ja nur noch zwei Schwestern im Haus.45 Fast jedes Jahr wurde ein Komet gesichtet; derjenige von 1774 war nicht einmal besonders spektakulär.46 Es ging Zschokke bei dieser Notiz um etwas ganz anderes als um ein tatsächliches Begebnis. Am Anfang des bewussten Lebens stand nach seiner Überzeugung eine namenlose Angst, in der ein Mensch sich allein gelassen fühlt. Da Zschokke die Angst vor der Strafe Gottes später oft in Zusammenhang mit Aberglauben und religiösem Wahn brachte, denen ein kindliches Gemüt hilflos ausgeliefert sei, schien es ihm bei bei der Abfassung seiner «Selbstschau» sinnvoll, die Kometengeschichte hier einzubringen.
In der «Selbstschau» wollte Zschokke die Geschichte seiner inneren Welt, «ihrer Verwandlungen, ihrer Religions- und Lebensansichten u.s.w.» schildern. «Ich entwikkle mir, wie ich zu meiner Religion stufenweis’ kam, zu meinem Leben in Gott, zu meinem Einswerden mit den Ansichten Christi von göttlichen Dingen, und schildre dann meine Religion.»47 Der erste Band sollte sein religiöses Bewusstwerden, sein geistiges Erwachen zeigen, ein zweiter Band seine philosophischen und religiösen Überzeugungen in einen logischen Zusammenhang bringen.48 Im Verlauf der Ausarbeitung kam Zschokke von dem Konzept für den ersten Band wieder ab. Er sah wohl ein, dass die Darstellung seines bewegten Lebens, all dessen, was er als Augenzeuge und Handelnder beobachtet und mitgestaltet hatte, für seine Mitmenschen mindestens ebenso interessant war wie die Auslegung seiner inneren Welt.
Die Beschreibung seiner ersten Lebensjahre ist noch ganz vom ursprünglichen Konzept geprägt. Die Summe seiner Erkenntnisse über das Wesen und die Entwicklung des Menschen führte er in einer doppelten Betrachtungsweise aus: die Quintessenz in einer systematischen und synoptischen Schau seines Weltbildes («Welt- und Gottanschauung»), die Entwicklung und Reifung, gleichsam das Erwachen des Menschen, in einer diachronen Sicht am eigenen Fall («Das Schicksal und der Mensch»). Dem diachronen Ansatz legte er ein Evolutionsmodell zugrunde, das die Entfaltung des Individuums in verschiedenen Stufen vom Säugling über den Jüngling bis zum Greis betrachtet. Dies kommt schon in der Einteilung des autobiografischen Teils zum Ausdruck, mit den Hauptkapiteln Kindheit, Wanderjahre, Revolutionsjahre, des Mannes Jahre und Lebens-Sabbath.
Zu Beginn jeglicher Menschwerdung, der individuellen wie der allgemeinen, steht nach Zschokkes Vorstellung ein Dahinfluten des Geistes zwischen Wachen, Schlafen und Träumen, bevor der Verstand sich zu regen beginnt. Also setzte er in der «Selbstschau» mit der Beschreibung seiner Kindheit so ein:
«Das erste Denken des Kindes ist ein leises Spinnen der Fantasie im Dämmerlicht des Bewußtseins; ein gedächtnißloses Träumen im Wachen. Die Welt gaukelt unklar an den Augen vorüber; und was sie zeigt, ist vergessen, sobald sie es wegnimmt. Der Mensch ist noch thierähnlich; der Geist hat sich noch nicht mit seinen irdischen Werkzeugen vertraut gemacht; das weiche Lebensgewebe des Leibes ist noch zu zart, als daß es ihm schon zum freiern Gebrauch dienen könnte. So gehn die ersten Jahre des Kindes vorüber. Der eben vorhandne Augenblick ist ihm ein Lebensganzes.»49
Die Stufenleiter, die jeder Mensch durchläuft, sah Zschokke vorgezeichnet und wiederholt in der Evolution der Natur vom Unbelebten über die Pflanzen und Tiere bis zu den Menschen und ein weiteres Mal in der Kulturgeschichte. Den Schlüssel zu dieser Interpretation gibt Zschokke im zweiten Teil der «Selbstschau». Er führt die geistige Entwicklung des Individuums parallel zu jenen ganzer Völker, mit den Stufenfolgen Wildheit, Halbwildheit, Barbarei, Halbbarbarei und Zivilisation. Die oberste Stufe des «Hochmenschlichen» habe bisher kein einziges Volk erreicht, wohl aber «der einzelnen Sterblichen Viele, unter Barbaren und Civilisirten, [...] Andre zur Nachfolge ermuthigend».50 Diese oberste Stufe sei für jedes Individuum erstrebenswert und werde auch die Menschheit schliesslich erreichen. Als Zschokke die «Selbstschau» schrieb, glaubte er, diese letzte Stufe erreicht zu haben oder ihr mindestens nahe zu sein.
Zur Gesittungsstufe der Barbarei gehörte auch der Aberglaube, dass ein Meteor die Zornrute Gottes sei, was erst später, im Verlauf der Verstandesbildung und Aufklärung hinterfragt werden könne. In einem gerafften Zeitablauf hatten sich Zschokkes Vater und die einfachen Leute, Handwerker, Soldaten und Arbeiter im Nordwesten der Stadt Magdeburgs um 1775 demnach noch auf der Stufe des Barbarentums befunden. Zschokkes eigener Weg, wie ihn jedes Kind durchlaufen musste, erfolgte als Befreiung aus dem dumpfen Zustand des Aberglaubens und der Ängste zur Freiheit des Denkens, aus der Dunkelheit zum Licht.
Wie von selbst stellt sich in der «Selbstschau» eine Übereinstimmung zwischen dem eigenen Erleben und dem kulturellen Zustand der Stadt ein: Magdeburg zwischen 1771 und 1780 passt sich der Befindlichkeit des Knaben an, als eine abergläubische, halb archaische Welt, die von irrationalen Kräften bestimmt ist. Dies wird dem Leser vor Augen geführt, indem Magdeburg aus der Sicht des kleinen Heinrich geschildert wird. Dabei musste Zschokke seine Phantasie zu Hilfe nehmen, da er sich nicht hauptsächlich auf selber Erlebtes, geschweige denn auf seine Gefühle von damals bezog. Dennoch gelang es ihm, seiner «Selbstschau» einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft zu verleihen. Er war ein Meister solcher Suggestion, wobei seine Vorgehensweise neben ihrer Stringenz und Kohärenz noch den Vorteil hatte, die psychische Verfassung eines Kindes zu verdeutlichen. Mit dem realen Magdeburg jener Zeit und dem regen Kulturleben der Stadt hatte das nicht viel gemein.51
Dem Biografen obliegt es, Zschokkes philosophisch-imaginative Wahrheit durch die Wirklichkeit, soweit rekonstruierbar, zu ersetzen. Erst wenn er andere Quellen und Darstellungen beizieht und damit vergleicht, stösst er auf Lücken, die es zu füllen, und auf Widersprüchlichkeiten, die es zu bereinigen gilt. Eine dieser Lücken besteht darin, dass Zschokke im Alter kaum noch frühe Ereignisse und Eindrücke abrufen konnte, selbst wenn er gewollt hätte. Einiges schien ihm für den Zweck seiner «Selbstschau» unnützer Ballast.
Als 7-Jähriger, berichtete Emil Zschokke, sei Heinrich von seinem Vater aus dem Schlaf gerissen worden und habe über den Häusern im Süden die Röte eines nahen Brandes gesehen. Dies habe «einen [...] unverwischlichen Eindruck» auf ihn gemacht.52 Obschon Zschokke dieses Erlebnis seinen Söhnen selber erzählte, liess er es aus den eben genannten Gründen aus der Lebensgeschichte weg.
Ein nächtlicher Brand in der Altstadt war aber für die Bürger von Magdeburg gewiss bedrohlicher als die Sichtung eines Kometen. Ein solches Feuer konnte leicht um sich greifen und in dem Gassengewirr mit seinen Fachwerkhäusern die Bewohner eines ganzen Quartiers gefährden. Mehr als einmal wurde Magdeburg von schweren Feuersbrünsten heimgesucht; am verheerendsten waren jene vom 10. Mai 1631, die fast die ganze Innenstadt zerstörten. Im Namen der katholischen Liga hatte Graf von Tilly während des Dreissigjährigen Kriegs das lutherische Magdeburg erobert. Ob die Brände, die sich über die ganze Stadt ausbreiteten, damals absichtlich gelegt wurden, ist nicht restlos geklärt.53 Ihnen fielen neun Zehntel der Häuser zum Opfer; von den über 33 000 Bewohnern blieben nicht einmal 500 in der Stadt.
Seither achtete man darauf, Feuerspritzen bereit zu halten und teilte die Altstadt in neun Bürgerviertel ein. Die gesamte waffenfähige Bürgerschaft war verpflichtet, bei einem militärischen Angriff oder im Brandfall Dienst zu tun und die Stadt zu verteidigen. Da diese Bürgerwehr bei Feierlichkeiten und Umzügen mit ihren Fahnen und mit Musik in Erscheinung trat und man sich jedes Jahr im Mai die Katastrophe von 1631 ins Gedächtnis rief, liess Zschokke dieses Thema sicherlich nicht unberührt.
Wenn er es darauf angelegt hätte, ein farbiges Panorama seiner Zeit und der Stadt zu zeichnen, hätte Zschokke aus dem Alltag des sechsten Viertels viel zu berichten gewusst. In allernächster Nähe des Elternhauses, an der Braunen Hirsch Strasse, die damals noch Kleine Schrotdorfer Strasse hiess, befand sich die Steingut-, Porzellan-, Fayencefabrik von Guischard mit (um die Jahrhundertwende) über hundert Arbeitern.54 Es ist kaum vorstellbar, dass einen Knaben das Treiben in und um diese Fabrik nicht interessierte, wie überhaupt die Geräusche und Gerüche dieser Stadt, das Laden und Entladen der Kähne an der Elbe, das Rattern von Kutschen und Wagen, die kirchlichen und weltlichen Feste, das Militär mit seinem Drill, den Pferden, der Musik, den Paraden und dem Auspeitschen fehlbarer Soldaten bleibend auf ihn gewirkt haben müssen.
Militär marschierte durch die Strassen und exerzierte auf dem Domplatz; es war ein ständiges Kommen und Gehen. Die häufigsten Nachrichten in der «Magdeburgischen Zeitung» zu städtischen Belangen handelten von Truppenverschiebungen, von Beförderung oder Abberufung von Offizieren und von den Besuchen hoher Persönlichkeiten. Selbstverständlich beeindruckten Zschokke die Soldaten in ihren Uniformen, das blankpolierte Metall, das glänzende Leder, ihre Waffen und Pferde. Er war von militärischen Formationen, vom Exerzieren und Defilieren ein Leben lang fasziniert.
Dabei ist eine sehr frühe Erinnerung erwähnenswert, die Zschokke seinen Söhnen mitteilte, ebenfalls ohne dass er sie in die «Selbstschau» hätte einfliessen lassen: «Papa sieht als kleiner Knabe in Magdeburg den König Friedrich den Großen bei einer Revue. Der Rok des Königs streifte an das Röklein Papas.»55 In seiner Erzählung «Der Feldweibel von der Potsdamer Garde» (1823) schilderte er den Einzug des Königs mit seinem Gefolge in Magdeburg durch das Krökentor, die zahlreichen Schaulustigen am Breiten Weg und die Schuljugend, die auf Brettergerüsten und Sandsteinplatten vor der in Renovation befindlichen Katharinenkirche turnten, um alles mitzubekommen.56 Diese Szenerie trägt autobiografische Züge; sie stand den Söhnen plastisch vor Augen, als sie 1826 nachsahen, ob die Steine und Bretter, auf denen ihr Vater als Kind herumkletterte, noch immer vor der Kirche lagerten.57
Vater Schocke kümmerte sich nicht darum, was sein Sohn den Tag hindurch trieb, und da sich Heinrich am liebsten im Freien aufhielt, wurde er zu einem der zahlreichen herumlungernden Jungen in seinem Viertel, die sich austobten und in ihrem Spiel nur beeinträchtigen liessen und davon stoben, wenn ein Gendarm auftauchte. Sein Vater wird ihm wohl befohlen haben, sich nicht zu weit von zu Hause wegzubewegen, denn oft hielt er sich im Innenhof auf, kletterte auf Bäume und über Dächer (die meisten Häuser waren nur zweistöckig) oder spielte in der Umgebung mit anderen Buben Krieg. Ausgerüstet mit hölzernen Säbeln lieferten sie sich Schlachten, bei denen auch Scheiben zu Bruch gingen.58
Das Militär war in Magdeburg allgegenwärtig, Preussen oft in Kriege verwickelt – es wäre seltsam gewesen, wenn die Knaben nicht Soldaten gespielt hätten; das Kriegsspiel diente dem Hineinwachsen in die Männerwelt. Er, Heinrich, sei zu ihrem Feldherrn ernannt worden, schrieb er in der «Selbstschau».59 Dies liess sich wohl nur zum Teil darauf zurückführen, dass er die Arbeiter- und Soldatenkinder in den umliegenden Häusern und aus den Baracken der nahe gelegenen Kasernenstrasse mit Holzwaffen versorgte. Er muss besonders wild und wagemutig gewesen sein und sich gegen andere durchgesetzt haben. Ausser mit ihren hölzernen Schwertern spielten die Knaben mit Spielzeugsoldaten. Beim alten Birnbaum hinter seinem Elternhaus sei diese kleine Armee «mit Trommel & Trompetenschall jedesmal unter den morschen Wurzeln vergraben worden, um am dritten Tag wieder aufzuerstehn».60

Auf diesem Plan der Stadt Magdeburg von G. Henner (um 1790) sind die Bürgerviertel der Altstadt und die wichtigsten Gebäude eingezeichnet. Die Hauptstrasse war der von Norden nach Süden verlaufende Breite Weg (hier von rechts nach links), von dem ein Gassengewirr abging. Die Schrotdorfer Strasse, wo Heinrich Zschokke die ersten sieben Jahre verbrachte, lag im Nordwesten. Das Schrotdorfertor im Westen der Altstadt, in das die Schrotdorfer Strasse mündete, wurde Teil des Festungswalls vor der Bastion Magdeburg, ganz oben auf dem Plan.
Man merkt es der Anekdote an, wie gern Zschokke sich diese Szene ins Gedächtnis rief. Noch als Erwachsener beschäftigte er sich oft mit der Welt des Militärs, spielte Schlachten auf der Landkarte nach und beschrieb Kriege ausführlich in Büchern und Zeitschriften. Besonders Napoleons Heldentaten hatten es ihm angetan.61 Soll man dies als ein Erbe seiner Magdeburger Kindheit betrachten? Als ihm die Aargauer Regierung 1818 einen Offiziersrang im kantonalen Generalstab anbot, lehnte er ab, als er erfuhr, dass er nur zum Major und nicht zum Oberstleutnant ernannt werden sollte.62 So blieb er Zivilist, der nie einen Tag Militärdienst tat und, zu seinem Glück, Schlachten und Kriege bis auf die Zeit zwischen 1798 und 1800 in der Schweiz nur von seinem Schreibtisch aus verfolgte. Aber einmal wenigstens, als Kind, war er ein General gewesen.
Bei allen Erinnerungslücken mass Zschokke zwei Dingen in «Eine Selbstschau» besondere Bedeutung bei: dem frühen Besuch der Schule und der Kirche. Im Alter von fünf Jahren habe ihn sein Vater in eine Schule gesteckt, ohne sich darum zu scheren, ob sie für ihn taugte oder nicht.63 Von diesen Trivialschulen gab es in Magdeburg eine grössere Zahl; eine davon war im Besitz der Stadt: die Altstadtschule an der Schulstrasse, nur zwei Strassen vom Elternhaus entfernt. Sie befand sich in einem ehemaligen Franziskanerkloster und war in einem erbärmlichen Zustand. Zwei der Schulzimmer lagen halb unter der Erde, waren feucht und dunkel, mit halbblinden Fenstern und kaum heizbar.64
Ob Zschokke diese Schule besuchte, wissen wir nicht; dass ihm aber auf einer von den Kirchgemeinden betriebenen Parochialschulen oder in einer der vielen Winkelschulen Besseres widerfahren wäre, ist nicht anzunehmen. Die Privatschulen im Magdeburg «waren meist in Hinterhäusern untergebracht, dunkel und, wenn der Betrieb gut ging, furchtbar überfüllt; von Schulhof, Lehrmitteln usw. war natürlich keine Rede».65 Die Lehrer wurden schlecht besoldet, ihre Qualifikation war ungenügend, der regelmässige Schulbesuch wurde nicht kontrolliert; Hauptsache, das Schulgeld ging ein. Jedermann konnte eine solche Schule eröffnen.66 In die Schulstuben wurden bis zu 100 Kinder im Alter von drei bis vierzehn Jahren gepfercht; was und wie unterrichtet wurde, blieb besser ungefragt. Der Magistrat erfüllte seine Aufsichtspflicht nur schlecht;67 die Übelstände waren längst bekannt, aber es vergingen noch über dreissig Jahre, bis man ernsthaft daran ging, das Primarschulwesen zu verbessern.68
Zschokke schrieb über die Schule nur, dass er sie als Plage- und Zwangsanstalt empfand.69 Ob er sich ihrem Zugriff entzog, indem er den Unterricht schwänzte, oder lust- und teilnahmslos die Stunden absass – seine erste Begegnung mit der Schule war auf jeden Fall unerfreulich. Sein Vater habe ihn fleissig zum Schulbesuch angehalten, schrieb Zschokke, ob mit Erfolg oder nicht liess er offen; er dürfte schon damals nicht besonders willfährig gewesen sein. Der zwei Jahre ältere Neffe Gottlieb Lemme half ihm beim Buchstabieren und Lesen.70 Der Vater habe ihn auch zur Predigt mitgenommen und von ihm verlangt, dass er Gebete hersage, deren Inhalt er nicht begriff.71 So also sahen Gottfried Schockes Mittel aus, seinen jüngsten Sohn zu einem braven Bürger und guten Christen zu erziehen.
Luthers Leitspruch, den er seinem Sohn auf den Lebensweg gab, «Christum lieb haben, ist beßer denn alles Wissen», deutet auf eine pietistische Haltung hin, wie sie, von Halle ausstrahlend, in Magdeburg vor 1800 weit verbreitet war. Pfarrer Georg Andreas Weise an der St. Katharinenkirche war ein Vertreter dieses bekenntnishaften persönlichen Glaubens. Er interpretierte die Bibel sehr lebhaft und regte die Phantasie des kleinen Heinrich an, in dessen Phantasie fortan geflügelte Engel und «der rauhhaarige Teufel, mit Lahmfuß, Pferdehuf und langem Schwanz» herumspukten.72
Es ist offensichtlich, dass Gottfried Schocke seinem Sohn keine grosse Aufmerksamkeit schenkte. Zschokke blieb dabei, dass er ihm ein liebevoller Vater gewesen sei, gerade dort, wo die Vernachlässigung am deutlichsten hervortritt: «Der zärtliche Vater strafte wirkliche Unarten seines Lieblings selten; überließ die Erziehung des Wildfangs vertrauensvoll dem Zufall, und so ward dieser ein lebenslustiger Springinsfeld, oder besser gesagt, ein Gassenjunge der Stadt, im strengsten Sinn des Worts.»73 Diese vorteilhafte Würdigung des Vaters ist bemerkenswert, da Zschokke als erwachsener Mann ganz andere Erziehungsprinzipien vertrat und es ihm nie eingefallen wäre, seinen Söhnen nur einen Bruchteil von dem durchgehen zu lassen, was er sich bei seinem Vater leisten konnte.