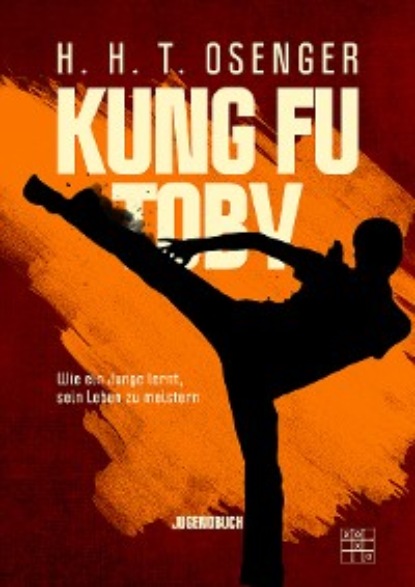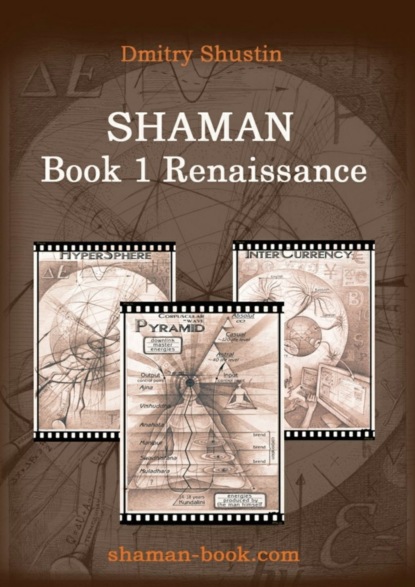- -
- 100%
- +
Ohne einen Zwischenfall zu erleben standen sie schließlich vor der Abgewrackten Dschunke. Die Kneipe verdiente den Namen. Das Haus war total herunter gekommen. Innen brannte nur trübes Licht, der Wirt wollte wohl Kerzen sparen. Es stank aus dem Laden nach altem Schweiß, Fusel und dem Rauch von Rauschgift. Ein wirklich übles Loch!
»Ich schlage vor«, sagte Zhao, »dass ich allein rein gehe. Ihr folgt und tut erst mal so, als gehörten wir nicht zusammen.«
Lim schüttelte den Kopf. »Das halte ich für zwecklos. Die da drinnen wissen, dass wir kommen werden. Die weghuschenden Schatten haben denen das längst geflüstert.«
Zhao nickte langsam. Wo Lim Recht hatte, hatte er eben Recht. »Also gut. Gehen wir rein?«
Weng stapfte los und sagte über die Schulter: »Wir gehen rein!«
Die Situation in der Kneipe war im Nu überblickt. Eine Handvoll ausgemergelter Gestalten hockte an oder lag über Tischen, die schmierig und klebrig von verschütteten Getränken waren. Von denen ging keine Gefahr aus. Die waren so voll Alkohol oder anderer Rauschgifte, dass sie nicht angreifen konnten. Sie wären nicht einmal in der Lage gewesen, sich ihrer Haut zu wehren oder auch nur zu fliehen.
Nein, die Gefahr thronte groß, breit und wichtig an einem Tisch, der in der Mitte der düsteren Kneipe stand. Dort saßen fünf Männer und hielten offensichtlich ein Mädchen gegen ihren Willen fest. Dem Mädchen war die Angst anzusehen. Dennoch war sie die schönste Blondine, der Zhao je begegnet war. Die Männer am Tisch aber waren wirklich übel. Der Abschaum der Seefahrer, den das Meer in die Bucht gespült hatte.
Zwei hatten olivbraune Haut und schwarzes Haar. Die anderen drei waren hellhäutig wie Nordmänner. Einer von denen hatte Ohren, die so abstanden, als wolle der Träger dieser Lauschorgane den Wind damit einfangen. Alle waren bewaffnet. Sie machten sich einen Spaß daraus, ihre Dolche in die Tischplatte zu bohren. Der Wirt stand in einem Winkel bei seinen angeschlagenen Fässern und sah so aus, als würde er jeden Moment aus seiner eigenen Kneipe flüchten. Als er der drei Freunde ansichtig wurde, schien er etwas Hoffnung zu schöpfen.
Der Anführer der Gruppe, es handelte sich um den mit den abstehenden Ohren, grinste die drei Freunde bösartig an. »Wenn ihr saufen wollt, müsst ihr euch eine andere Kneipe aussuchen. Die hier ist heute Abend unsere. Jemand anders als wir wird hier nicht bedient.« Und damit warf er einen schiefen Blick auf den Wirt, der sich prompt wieder unbehaglicher fühlte und zu zittern begann.
»Ich habe keine Lust zu Saufen«, antwortete Zhao in ruhigem Ton. »Aber ich habe gehört, dass fünf Dreckschweine ein junges Mädchen gegen ihren Willen festhalten. Habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte?«
Die fünf miesen Kerle begannen ihre Dolche aus dem Holz der Tischplatte zu ziehen. Einer setze die Spitze der Klinge wie spielerisch an den Hals des blonden Mädchens, dessen Atem plötzlich stoßweise vor Angst ging.
»Wenn du nicht augenblicklich unsere Kneipe verlässt, dann zieh ich dir die Haut ab und verstärke die Segel meines Schiffes damit«, fauchte der Anführer. Auch aus den Augen der anderen sprach die pure Brutalität und Mordlust.
Zhao blieb die Ruhe selbst, aber er entgegnete: »Von einer stinkenden Kanalratte wie dir lasse ich mir nichts befehlen.«
Der Anführer sprang wutentbrannt auf. »Wie hast du mich genannt? Sprich dein letztes Gebet, du Stück Dreck!«
Damit stürzte er auf Zhao los und wollte ihm das Messer in den Hals rammen. Aber Zhao wich minimal zur Seite aus, fing mit einer blitzschnellen Bewegung der rechten Hand den Messerarm des Angreifers und setzte einen Hebelgriff an. Sofort fiel die Waffe aus der kraftlos gewordenen Hand. Mit der gleichen Schnelligkeit ließ Zhao die nun unbewaffnete Hand los und schlug gegen den Hals des Gegners. Gleichzeitig hieb er seine Ferse in dessen Kniekehle. Der Kerl mit den Segelohren sackte zu Boden und schnappte nach Luft. Die ganze Aktion hatte nur eine Sekunde gedauert, seine linke Hand hatte Zhao überhaupt nicht gebraucht.
Voller Bestürzung sahen die vier Übeltäter am Tisch, in welch kurzer Zeit ihr Kumpan vom Angreifer zum überwältigten Opfer geworden war. Lim nutzte den Zeitpunkt der Überraschung, schnellte vor zum Tisch und packte mit einem Hebelgriff den Arm des Kerls, der das Mädchen mit dem Messer bedrohte. Dadurch zwang er ihn mit dem Oberkörper auf den Tisch.
Weng blieb in dieser Zeit nicht untätig. Er lief, seiner beleibten Statur zum Trotz, blitzschnell um den Tisch, und schickte zwei Strolche, die sich gerade erheben wollten, mit einer Kette von Fausthieben zu Boden. Die Dolche trat er dann den am Boden Liegenden aus den Händen, so dass sie in die dunklen Ecken der Kneipe flogen.
Der fünfte Mann, der noch nicht überwältigt war, wollte dem Anführer zu Hilfe kommen. Er sprang über den Tisch und wollte mit der Wucht seines Sprungs Zhao zu Boden werfen. Doch der wich geschickt aus und verpasste aus einer Drehbewegung dem Kerl einen Tritt in die Seite. Der Angreifer brüllte vor Schmerz auf und sackte in die Knie.
Der Kampf hatte nur einen kurzen Augenblick gedauert und war entschieden. Die drei Freunde hatten nicht einmal einen Kratzer davon getragen. Zhao, Lim und Weng machten sich nun ans Saubermachen. Sie holten sich hölzerne Eimer, hießen den Wirt, sie mit Wasser zu füllen und gossen das kühle Nass über die bewusstlosen Übeltäter. Die wurden davon langsam wieder munter. Mühsam und ächzend erhoben sie sich.
Zhao behielt die fünf Männer im Blick. Sie mochten im Augenblick noch erledigt sein, aber das konnte sich schnell ändern. »Ich will nicht viel Worte machen. Wenn ihr jetzt friedlich verschwinden wollt, dann lassen wir euch in Ruhe gehen.«
Der Anführer kam langsam auf die Beine, stand schwankend da und warf Zhao einen hasserfüllten Blick zu. »Ich will auch nicht viel Worte machen. Ich werde dich bald wieder sehen, und dann wirst du sterben.«
Zhao zeigte ein leises Lächeln. »Nimm dir nicht zu viel vor!«
Als sich die Fünf anschickten, die abgewrackte Dschunke zu verlassen, wurde der Wirt wieder deutlich nervös. Zhao verstand sofort. »Halt!«, rief er. Sofort blieben die Männer stehen. »Zuerst bezahlt ihr dem Wirt, was ihr getrunken habt.«
Der Blick des Anführers wurde noch glühender, als er zwischen dem Wirt und Zhao hin und her pendelte. Widerwillig griff er nach ein paar Münzen, warf sie zu Boden und fauchte: »Diesen Reiswein zu bezahlen wäre nicht nötig gewesen, der hat nämlich wie Pisse geschmeckt!«
»Dann wird er für dich gewiss eine Delikatesse gewesen sein«, sagte Lim breit grinsend. Weng begann darauf schallend zu lachen, auch Zhao musste lächeln. Wie begossene Pudel hinkten die fünf Männer aus der Kneipe. Eilig begann der Wirt die Münzen aufzusammeln.
Das junge blonde Mädchen warf den drei Freunden, vor allem Zhao, freudige Blicke zu. »Wie kann ich euch danken?«, sagte sie. »Die Kerle wollten mich auf ihr Schiff mitnehmen. Sie sind Piraten, und sie wollten mich an Menschenhändler verkaufen.«
»Denen hätte gewiss eine so schöne Frau sehr viel Geld eingebracht«, sagte Zhao freundlich, und die Blonde schlug verlegen die Augen nieder. Dann sah sie wieder auf und fragte erneut: »Wie kann ich euch danken?«
»Wie wäre es mit einem Spaziergang zu einem wirklich guten Restaurant?«, fragte Zhao. »Wir laden dich gerne ein. Und danach geleiten wir dich nach Hause, wo immer du auch wohnen magst.«
Die Rückkehr ins Grau
Als am Morgen der Wecker am Kopfende seines Bettes klingelte, erwachte er als Toby in der Tagesrealität. Er konnte sich an jedes Detail der vergangenen Nacht erinnern. An die geheimnisvolle Stadt unter dem bleichen Vollmond, an die Gefahr, an den Sieg über die fünf Piraten, an die Dankbarkeit des blonden Mädchens.
Toby brauchte nicht darüber nachzudenken, ob die Abenteuer der Nacht wirklich geschehen sein konnten oder nur ein Traum gewesen waren, in denen er die Erlebnisse, Ängste und Wünsche des Tages verarbeitet hatte. Für ihn war es Realität. Sein Leben am Tag war für ihn hoffnungslos. Die dunkle Welt Zhaos zog ihn deshalb in ihren Bann und wurde sein Lebensinhalt. Und sie wurde mehr und mehr seine wahre Existenz. Folgerichtig wurde Toby mit der Zeit tagsüber immer verschlossener und kapselte sich so weit wie möglich von der Umwelt ab. Er erledigte seine Hausaufgaben, war aber im Unterricht still. Er reagierte auf Bedrohungen, die er durch Flucht abzuwenden suchte. Und er warf ab und zu noch versteckte Blicke auf die schöne und blonde Bellinda, die ihn aber nicht bemerkte.
Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter mit seinen Stärken und Schwächen. Ein anderer Junge in Tobys Situation hätte wohl anders reagiert. Vielleicht hätte er genug Selbstbewusstsein gehabt, um die ständige Bedrohung durch die Bande der fünf Jugendlichen zu beseitigen. Entweder aus eigener Kraft, oder vielleicht hätte er sich an seine Lehrer gewandt, an seine Eltern, an die Polizei. Unter Umständen wäre er einer der Jungen gewesen, an die sich die Bande erst gar nicht heran getraut hätte. Er hätte vielleicht auch die Aufmerksamkeit der schönen Bellinda erringen können. Und falls sie auf seine Versuche, mit ihr in Kontakt zu kommen, nicht reagiert hätte, hätte dieser andere Junge sich wohl gedacht: »Dann eben nicht!« und hätte sie fortan ignoriert. Aber das Desinteresse des Mädchens wäre für ihn kein Weltuntergang gewesen.
Toby hingegen reagierte auf die einzige Art und Weise, wie es ihm möglich war. Er wechselte nachts in seine andere Realität und verlor langsam aber sicher den Bezug zum Hier und Jetzt.
Die Luft war rein gewesen, als Toby die Schule betreten hatte. Vor dem Gebäude des Gymnasiums hatte niemand Streit gesucht oder gepöbelt. Trübsinnig war er auf den Pausenhof gegangen, hatte auf den Dreiklanggong gelauscht, der den Beginn des Unterrichts anzeigte. In der Masse der anderen Schülerinnen und Schüler war er über den Flur gegangen, hatte den Klassenraum betreten und seine Schulsachen für die erste Stunde ausgepackt. Es würde Englisch geben.
Neben ihm saß Lars, ein schmächtiger Junge mit rotblondem Haar, blauen Augen und einer Unmenge Sommersprossen, der ebenfalls häufig ein Opfer von Gewalt und Erniedrigung durch die fünfköpfige Bande war. »Haben sie dich gestern in die Finger gekriegt?«
Toby brauchte nicht zu fragen, wen Lars meinte. Sein Mitschüler hatte wohl sein Ausreißen vom Vortag beobachtet. Toby schüttelte den Kopf.
»Wie bist du ihnen entkommen?«, fragte Lars weiter.
»Bin schnell genug gelaufen«, antwortete Toby einsilbig. Doch dann entschloss er sich, die Sache mit dem Lieferwagen und dem freundlichen Fahrer zu erzählen. Lars begann zu lächeln.
»Mensch, das war aber `ne tolle Idee!«, meinte er begeistert.
Toby hätte sich gewünscht, Lars hätte den Mund gehalten oder er hätte seine Bewunderung für den Einfall leiser geäußert. Der Englischlehrer hatte den Raum noch nicht betreten, aber Sascha, einer der Jungen, die in der Klasse das Sagen hatten, kam gerade an der Bank vorbei.
»Wer hat `ne tolle Idee gehabt, hä?«, fragte Sascha. »Doch wohl nicht der blöde Decker, diese Flasche?«
Toby und Lars schwiegen. Sascha baute sich vor der Bank der beiden auf. Er war knapp einen halben Kopf größer als Toby und sportlich. Mit einem geringschätzigen Lächeln sah er auf ihn hinab. Toby hielt den Blick auf die Tischplatte gesenkt. Er vermutete, dass Lars dasselbe tat, aber im Grunde genommen war es ihm gleichgültig.
»Also `raus mit der Sprache«, fuhr Sascha fort, während die übrigen Schüler aufmerksam wurden und zuhörten. »Wer hatte `ne tolle Idee? Um worum ging es dabei?«
Toby hob den Blick. »Ich bin gestern vor den fünf Typen abgehauen, die immer wieder vor unserer Schule aufkreuzen und Ärger machen. Beinahe hätten sie mich geschnappt, aber ich habe mich in einem Lieferwagen versteckt, aus dem Kartoffeln ausgeladen wurden.«
Gelächter brandete auf. Für den Rest des Tages wurde Tobias erst Kartoffel-Toby, dann einfach Toffy genannt.
Nach dem Englischunterricht musste Toby eine Doppelstunde Sport überstehen. Er hasste Sport, da er sich für unsportlich hielt. Er hatte auch nie ernsthaft versucht, etwas daran zu ändern, sondern nahm seine geringe Fitness als gegeben hin. Die erste Stunde verging mit Bodenturnen, danach wählten die vier sportlichsten Schüler Mannschaften für Handball aus. Die Jungen und Mädchen, die im Sport erfolgreich waren, wurden natürlich als erste ausgewählt, danach kamen die an die Reihe, die weniger gut waren, und so weiter. Toby, Lars und Wim, ein dicklicher Junge mit brauner Haut und pechschwarzem, dichtem Haar, der immer mit beiden Händen seine Hose hochzog, waren die Letzten, die mit Murren zwischen den anderen geduldet wurden. Toby lief zwar so gut er konnte im Spielgeschehen mit, kam aber nicht einmal in den Ballbesitz. Er hatte auch nichts anderes erwartet. Wenigstens sorgte er nicht dafür, dass die Klasse etwas zu lachen hatte. Aber Wim stolperte einmal, während er versuchte, dem Ball nachzulaufen, und fiel hin, dass der Holzboden der Turnhalle krachte. Er rappelte sich mühsam auf, während sein Kopf wie eine reife Tomate glühte. Jetzt hatte die Klasse etwas zu lachen, und sie tat es auch.
Logisch!, dachte Toby bitter. Wim war genau solch ein Außenseiter wie Lars und er selbst. Anfangs hatten sich auch manche über sein etwas exotisches Aussehen lustig gemacht, bis Wim in der Erdkundestunde Gelegenheit gehabt hatte, etwas über sich zu erzählen. Seine Eltern waren Deutsche, die einige Jahre in Mexiko gelebt und gearbeitet hatten. Dort war ihnen Wim als Kleinkind, das kaum gehen und nicht sprechen konnte, zugelaufen. Trotz aller Bemühungen waren seine richtigen Eltern nicht festzustellen gewesen. So hatte das deutsche Ehepaar den Jungen behalten, ihn adoptiert und mehrsprachig aufgezogen. Wim beherrschte nicht nur Deutsch, sondern auch Spanisch und Englisch. Irgendwie besorgte ihm diese Geschichte soviel Respekt, dass er nicht mehr wegen Haut- und Haarfarbe gehänselt wurde.
Zum Schulschluss ging Toby wieder mit einem fürchterlichen Druck in der Magengrube Richtung Ausgang. Er spähte erst vorsichtig vom Gebäude aus nach draußen. Gott sei Dank, die fünf Schläger schienen nicht da zu sein. Trübsinnig machte sich Toby auf den Heimweg.
Tobys Mutter
Nora Decker bemerkte die Veränderung an ihrem Sohn mit großer Sorge. Er war immer schon ein stiller Junge gewesen, in sich gekehrt, nicht sehr kontaktfreudig. Nun musste sie diesen langsamen, aber stetigen Wandel registrieren: Toby sprach noch weniger als sonst, zeigte an fast nichts mehr Interesse, machte immer häufiger einen schwermütigen Eindruck. Und er ging immer früher in sein Zimmer, wenn es Abend war. Ihre Versuche, den Jungen zum Sprechen zu bringen, waren vergebens. Auf ihre Fragen, was mit ihm nicht stimme, antwortete Toby einsilbig, dass alles in Ordnung sei.
Sie hatte nur kurz erwogen, mit ihrem zweiten Mann über die langsame Verwandlung ihres Sohnes zu sprechen. Aber ihr war klar, dass Tobys Stiefvater nicht das geringste Interesse hatte, an seinem kostbaren Feierabend oder am Wochenende über die Probleme eines Jungen zu sprechen, der von einem anderen Mann abstammte. Sie musste allein eine Lösung finden. Aber welche?
Als erstes bat sie um Gesprächstermine bei Tobys Lehrern. Das hatte überhaupt keinen Erfolg. Die Mehrzahl der Männer und Frauen bestätigten lediglich ihre eigenen Beobachtungen, einer kam sogar noch auf die Idee, ihr wegen des passiven Verhaltens ihres Sohnes Vorwürfe zu machen. Sie solle mehr auf die Erziehung ihres Sohnes Einfluss nehmen und ihn ermahnen, mehr aus sich heraus zu gehen. Auf Nora Deckers Frage, wie sie da vorgehen solle, wusste er auch keine Antwort.
Der nächste Schritt war ein Besuch beim Hausarzt. Der Doktor versprach einen »gründlichen Check-up«. Nach den Untersuchungen bestätigte er, dass Toby körperlich gesund und vollkommen normal entwickelt sei. Ja, gewiss, es gebe da Anhaltspunkte für eine seelische Verstimmung, aber dafür sei er nicht der richtige Ansprechpartner. Er empfahl einige Kollegen aus dem Bereich der Seelenheilkunde bzw. ein Hilfegesuch an den schulpsychologischen Dienst zu stellen. Die Terminkalender der empfohlenen Psychiater waren allerdings auf Monate hinaus ausgebucht, der schulpsychologische Dienst aufgrund von Urlaubsvertretungen und Krankheitsfällen überlastet. Tobys Mutter vereinbarte einen Termin bei einem Psychiater, der dann mit ihrem Sohn in dreieinhalb Monaten sprechen würde, und wandte sich umgehend, wie es ihr die Sprechstundenhilfe am Telefon aufgetragen hatte, an die Krankenkasse, um zu klären, ob die Behandlungskosten übernommen würden.
In ihrer Verzweiflung begann Tobys Mutter auf ein Wunder zu hoffen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.