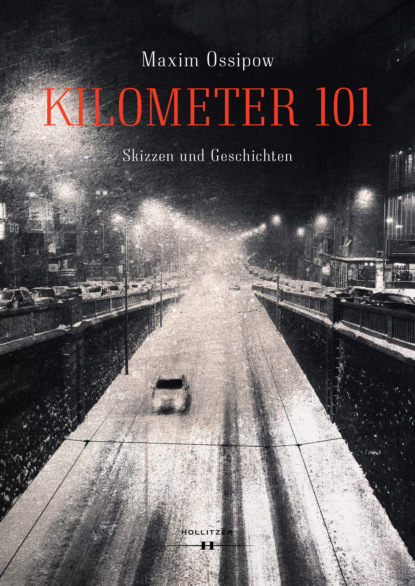- -
- 100%
- +
Nach zwei Monaten ist sie wieder da, betrunken (sie sagt, sie hat nur Bier getrunken, wenig glaubhaft), sie hat sich ganz schön den Bauch aufgeschnitten, wir haben es genäht. Sie sieht schon gröber aus. Stöhnt vor Schmerzen: „Dieser bescheuerte Husten.“ Dem Anschein nach ist sie ein Opfer, aber sie kann in Zukunft fast alles Böse tun, beispielsweise ihren Mann oder das Kind oder mich erstechen. Es wäre am einfachsten, Olja für psychisch krank zu erklären (obwohl sie keine Fantasien und Halluzinationen hat, doch die Frage, was die Seele ist, gilt in der Psychiatrie als unanständig), aber erklärt das etwas? Du schaust Olja an – und es ist klar, dass das Böse für diesen Menschen nicht charakteristisch ist, sondern in ihn eindringt, in ihn hineinfährt und die Leere, den Zwischenzellraum ausfüllt. Das Böse und das Gute sind von unterschiedlicher Natur, aber die Leere hat nun mal eine Affinität zum Bösen. (Vor kurzem erfuhr die Geschichte der Olja M. eine Fortsetzung. Ihr Mann, der Trinker, kam ins Krankenhaus. Er hatte eine Schnittwunde am Bauch mit Verletzung des Dünndarms und einer Iliakalarterie. Er behauptet, seine Hand sei vom Fleischwolf abgerutscht, er sei gegen den Tisch geprallt, auf dem ein Messer lag und so weiter).
Es gibt auch weniger schwere Begegnungen. In der Stadt N. geht man sehr viel besser als in Moskau mit Menschen um, deren Überleben gefährdet ist, insbesondere mit Obdachlosen. Vor kurzem fuhr der Krankenwagen bei bitterem Frost los, um eine „kriminelle Leiche“ zu holen. „Es sieht so aus, als wäre Sascha Terechow endlich entschlafen“, so drückte es die Arzthelferin aus. Während sie unterwegs waren, setzte sich der lebende Leichnam in ein Taxi, erschien im Krankenhaus und täuschte Atemnot vor. Er kam in das „soziale Bett“, am nächsten Morgen war er verschwunden. Ein anderer Obdachloser, einer der längst russifizierten Deutschen, mit schwerer Aorteninsuffizienz, wohnt schon seit drei Monaten im Krankenhaus, weil man ihn nirgendwohin entlassen kann. Äußerlich hat er sich aus einem Penner und Alkoholiker in einen anständig aussehenden Mann verwandelt, der nicht trinkt, mit Bärtchen und Stock. In dieser Zeit kam seine Exfrau ins Krankenhaus, er bat, sie möglichst lange dazubehalten: Ihre (gemeinsamen) kleinen Kinder kamen zu Besuch. Er nahm siebzig Rubel für einen Umschlag, er will nach Deutschland schreiben, schließlich ist er ein Deutscher und weiß, an wen er schreiben muss.
In einigen Moskauer Krankenhäusern geht man folgendermaßen vor: Nach drei Tagen im Krankenhaus werden die Landstreicher in einen Bus gesetzt und möglichst weit entfernt vom Krankenhaus ausgesetzt, es gibt tatsächlich Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind.
Auch das Lustige bleibt, obwohl es weniger auffällt, weil es sich wiederholt. Neulich brachte mir eine Patientin als Geschenk ein Dreiliterglas Gurken, sie preist die Gürkchen an, ich bedanke mich bei ihr. Auf einmal fragt sie nach: „Maxim Alexandrowitsch, und wie machen wir es mit dem Glas?“
Aktives, bewusstes Böses sehe ich überhaupt nicht, nur die Leere. Auf dem Krankenhausklo liegen Bruchstücke eines Kreuzworträtsels (Patienten wie Mitarbeiter lösen viele solcher Rätsel): „erbärmliche Menschen“, Wort mit vier Buchstaben. Eine Frau hatte ordentlich eingetragen: VOLK (die Autoren des Kreuzworträtsels meinten eigentlich: „Pack“). Ich habe dieses Wort immer gemieden, noch vor der Ankunft in N., doch ich habe mich in vieler Hinsicht stark getäuscht. (Brodsky über Solschenizyn: „Er dachte, der Grund ist der Kommunismus. Er versteht nicht, dass der Grund der Mensch ist.“) Man kann das sogenannte „Volk“ nicht wie kleine Kinder behandeln: in der Mehrheit sind das erwachsene, verantwortliche Menschen. Jedenfalls habe ich bei näherer Bekanntschaft mit ihm keinerlei Gefühl des Verlustes oder nicht verwirklichter Möglichkeiten gefunden. Sie sind wirklich bereit, fünfzig, sechzig Jahre zu leben – also kürzer als im Westen –, die Brücke „war nicht da, und wir brauchen auch keine“, sie ziehen wirklich die billige Popmusik Beethoven vor: Zu dem von uns organsierten Benefizkonzert kamen fast ausschließlich Datschniki. (Apropos: Der Hass auf die klassische Musik – trotz ihrer riesigen Erfolge – ist ein unerklärliches Phänomen. Meinem Bekannten, einem Musiker, der in die Psychiatrie musste, erlaubte man nicht, seinen Plattenspieler zu benutzen – er sollte keine klassische Musik hören, da die selbst schizophren sei. Den anderen Patienten erlaubte man es, weil sie „normale“ Musik hörten, sprich: Humtata-Humtata.) Die aktuellste Erzählung Tschechows ist trotzdem „Das neue Landhaus“ und nicht „In der Schlucht“. Da wählen die Leute aus ihrer Mitte – unter den Bedingungen ganz realer Autonomie – die Lytschkows.
DIE OBRIGKEIT (die, zu denen man nicht „nein“ sagen kann).
Ein einfacher Sowjetmensch und ein einfacher sowjetischer Sekretär der Kreisleitung, das waren sehr verschiedene Leute. Dieser Unterschied gilt noch jetzt. Lytschkow, der alle fertigmacht, die ihn stören, und auch noch legal gewählt ist, ist natürlich sehr dumm nach den Maßstäben eines Intellektuellen (was sollte es sonst für Maßstäbe geben?), aber er hat ein feines Gespür. Ich rede mit ihm, doch in meinen Augen steht geschrieben: „Ich brauche deine Unterschrift so dringend, dass ich sogar bereit bin, mit dir einen zu trinken.“ Er hat nichts dagegen, einen zu trinken, aber nicht unter diesen Bedingungen.
Mit der Obrigkeit sind viele Geschichten verknüpft, keine ist erfreulich, zwei wunderten mich. Die erste: Ich bat eine große westliche Firma, mir eine Rechnung über einen CT-Scanner auszustellen (Förderer hatten versprochen, ihn zu bezahlen), und zwar zu seinem echten Preis – für eine halbe Million und nicht für eine Million Dollar, ohne Schmiergeld. Sie redeten lange auf mich ein: Mit der Differenz können Sie noch andere Apparate kaufen (hm, ja, und die bringen ebenfalls Schmiergeld und so weiter bis zu Kopfkissenbezügen und chirurgischen Nadeln). Deshalb ist im Russischen das äußerst dehnbare Verb durchölen aufgetaucht, das heißt, für alles und jeden Geldaufschläge zahlen. Dann kam heraus, dass man den CT-Scanner ohne Schmiergeld nicht kaufen kann: Die Obrigkeit stünde in einem schlechten Licht da. Obwohl man bei Rot nicht fahren darf, ist das also die einzige Möglichkeit, ans Ziel zu kommen.
Die zweite Geschichte passierte, als ich mir bekannte einflussreiche Ärzte bat, mich vor der Obrigkeit in Schutz zu nehmen. „Kein Problem. Sag, wen wir anrufen sollen, wir regeln alles.“ Ich frage, wie. „Ehrlich gesagt, wir drohen normalerweise mit einer physischen Strafaktion“ (mithilfe früher einmal kurierter Banditen). Ich drossele schnell das Gespräch und schneide ein neues an: über Infarkte, Schlaganfälle und andere liebe Dinge.
All das bekümmerte mich stark, aber dann sah ich das Problem mit anderen Augen. Die Schwierigkeit ist nicht, dass „man in diesem Land nichts machen kann“ (schließlich hat man dort eine Revolution machen können), sondern dass meine Sprache ihnen genauso unverständlich ist wie mir die ihre. „Patient, was heißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten?“ „Ich bin gar kein Schuster“, das ist aus dem Lehrbuch für Psychiatrie. So halten wir es auch mit der Obrigkeit. „Sie sind doch ein Staatsmann“, sage ich zu einem großen Bonzen. Antwortet der doch: „Staat – das ist ein relativer Begriff.“
Da gibt es zwei Wege. Der erste: eine neue Sprache lernen, was schwierig ist und wozu ich keine Lust habe, zumal sie meiner Muttersprache so ähnlich ist, dass man womöglich alles durcheinanderbringt. Da gibt es nicht nur „ich werde Sie anrufen“, „Bleiben Sie bitte in der Leitung“, „das kostet zu viel“, „zum Erfolg verurteilt“, „das wird nachgefragt“, „keine Rechtsgrundlage“, „schlechte Ökologie“, „Unterfinanzierung“, „Realisierung von nationalen Projekten“ – es geht um ein System von Begriffen und die Arten des Beweises. Was ich sage, hat absolut nichts mit dem zu tun, was ich als Antwort zu hören bekomme. Die Obrigkeit hat denselben Eindruck, denke ich. Der zweite Weg – nacheinander auf alle Knöpfe drücken wie bei einem unbekannten Computerprogramm, das ist häufig erfolgversprechend. Also machen wir das.
März 2007
Es könnte schlimmer sein
„Arbeit, wie auch Liebe, davon kann man nicht genug kriegen“, sagte Vater Ilja Schmain einmal, der ebenfalls in unserer Stadt lebte (und diente). „Nun los, versuchen wir’s: das Steuer linkisch wenden / Wir um, und mag’s auch knirschen sehr!“
Ein weiteres halbes Jahr ist vergangen, vieles hat sich äußerlich zum Besseren verändert, aber die Verzweiflung überkommt einen zeitweise mit der früheren Wucht: Wenn es nur um die Verpflanzung neuer Organe, ein künstliches Herz oder eine andere Revolution in der Medizin ginge, aber nein, es geht um gewöhnliche Dinge, die mit schrecklicher Mühe und durch Zufall gelingen. „O, Lord, deliver me from the man of excellent intentions and impure heart“, könnten unsere Feinde sagen, wenn sie Eliots „Die hohlen Männer“ gelesen hätten. Ich verstehe: Sie haben auf die Schwätzer mit unreinen Händen und Absichten gehört. Der Tatkräftige ist verdächtig, den mitfühlenden Beobachter kann man entschieden besser verstehen.
Aber der Traum zeigte Wirkung. Durch ihn, nur durch den Traum bekommen wir Apparate und Medikamente und anderes für die Arbeit Notwendige. Die Freundschaft – ein nur in diesem Sinn russisches Phänomen der Intelligenz – funktioniert, und jetzt haben wir fast alles, um zurechtzukommen. Also versuchen wir’s.
Um zum Leben, nicht zum abstrakten des Volks, sondern zum eigenen Leben vorzudringen, braucht man Raum, in Moskau reicht er nicht aus. „Diese Stadt habe ich drangegeben“, sagt mein Bekannter, ein Künstler. In Moskau hat alles kein menschliches Maß, und es ist auch nicht wie in einer riesigen Kathedrale, im Gegenteil. Wenn man etwas zu tun hat, ist es sehr viel besser, in der Provinz zu leben. Zur Arbeit: zwei Minuten, und wenn man sich beeilen muss, anderthalb. In einer winterlichen Mondnacht ist alles im Umkreis weit zu sehen, und Jahreszeiten gibt es im mittleren Streifen Russlands weit mehr als vier. Die Hauptsache, die das Leben des Provinzlers vergiftet, ist die Ausweglosigkeit. Die Sicht aus dem Fenster bleibt unverändert bis ans Ende deiner Tage, der Platz auf dem Friedhof, wo du liegen wirst, ist bekannt, es gibt keinen Ausweg. Wenn du das Leben in der Großstadt nicht ausprobiert hast, kannst du keinen Trost in dieser Beständigkeit finden. Gut, dass die Beerdigungsprozessionen verschwunden sind, die einen in der Kindheit so erschreckten: Sie trugen den offenen Sarg durch die Stadt, und die Bläser spielten mehr schlecht als recht Chopin.
Der Umzug aus der Provinz nach Moskau ist eine natürliche und richtige Angelegenheit und hat Massencharakter: In unserer Stadt gibt es fast keine Bewohner zwischen zwanzig und vierzig, außer denen, die mitten auf der Straße mit einem Bier stehen. Der Umzug aus Moskau in die Provinz dagegen ist individuell, schwer nachzuahmen, ein Manko, wenn man es mit den Augen eines westlichen Menschen betrachtet, für den ein Marginaler meist ein Loser ist.
Der Blick von außen auf Moskau greift alle möglichen Details heraus: Je näher wir ihm kommen, desto mehr schrumpft der Abstand von der Straße, wo die Männer pinkeln (das ist nicht mehr „der an die wand pisset“ aus dem Alten Testament): warum sich schämen – keiner kennt keinen, alle sind fremd. Aus der Ferne erscheint Moskau wie ein gigantischer Polyp (so verschönern sie Moskau!), mit stellenweise bösartigen Auswüchsen. Bei näherem Hinsehen aber finden sich dort Menschen, die bereit sind, Zeit, Geld und Kräfte zu opfern, um unser Krankenhaus so einzurichten, wie wir es uns gedacht hatten.
Auf alle Knöpfe nacheinander zu drücken, war ein Fehler: Unser ruhiges und stilles Leben wurde schlagartig zerstört, Gottseligkeit und Ehrbarkeit verschwanden. Alles begann mit den Reden eines progressiven Journalisten. „In Russland“, sagt er, „ist alles besser, als es scheint.“ Aha, good to know. Er lächelt, er und ich sind die Elite. Jetzt wird uns der Staat unterstützen. Und die Beamten kamen zu uns in die Stadt gefahren – zu ungebetenen Kontrolluntersuchungen (wie kann sich der Staat anders in Friedenszeiten melden?) und Konsultationen.
Die Obrigkeit hatte aus irgendeinem Grund beschlossen, dass, wenn es etwas nicht im Regionalkrankenhaus gibt, es auch bei uns nicht vorhanden sein kann (Der Minister zu mir: „Ich nehme dich ins Regionalkrankenhaus!“). Die kleinen Chefs, muss man sagen, sind dazu noch sehr ungepflegt, sehen hässlich aus. Was haben diese Jungs in ihrer Kindheit gemacht: Tiere gequält, waren Oberfeldwebel in der Armee? Die Krone der Evolution – eine besondere biologische Spezies, völlig desinteressiert an einem Lebensinhalt. Wort, Blick, Händedruck: alles sinnlos. Die Beamten, besonders die mickerigen, gehen davon aus, dass es kein größeres Glück gäbe, als ihren Platz einzunehmen. In dieser schizophrenen Fantasiewelt wird über nicht existente Dinge gesprochen, die aber durch die Kraft der Gespräche eine dämonische Halbexistenz annehmen. Eins ist jetzt gut – die verfluchte Ideologie ist weg (auf dem Lenindenkmal ist mit Kohle geschrieben: „Mischa, das ist Lenin“, niemand wischt es ab), über meine Gedanken wollen sie nicht bestimmen.
Ein großer Bonze (mittlerweile schon ein ehemaliger, sie werden häufig ausgetauscht) ist redselig. Er spricht von sich in der dritten Person („Der Soundso verspricht Ihnen …“), als wäre Bonze zu sein sein Wesen. Wie anders redet Blok über Hamlet: „Ich sterbe, Prinz, in meiner Heimat …“ – einen Prinzen kann man erstechen, absetzen kann man ihn nicht. Als Gegengewicht zur Rhetorik der Sowjetzeit (Heldentat des einfachen Arbeiters et cetera) redet der Bonze jetzt über das „Volk“ mit Abscheu oder herablassender Verachtung: „Kam da so eine Oma in die Poliklinik …“ Söhnchen, ist das deine Oma? In der Nachbarregion wurde die Chefärztin eines Krankenhauses zur Bewährung verurteilt und entlassen. Eine verrückte Alte kam dauernd zu ihnen ins Krankenhaus gerannt, ging ihnen auf die Nerven und stand ihnen ständig im Weg. Die Chefärztin bat den Chef der Miliz, etwas zu unternehmen: Sie wusste nicht, dass die Alte „nicht herrenlos“ war, wie man heutzutage sagt. Die Milizionäre brachten die Alte in den Wald, wo sie verwilderte Hunde totbissen. Die Milizionäre bekamen sechs bis acht Jahre.
Es gibt allerdings eine Macht, mit der die Obrigkeit bereit ist, zu rechnen, die von ihr ernstgenommen wird: die Banditen. Über sie zu schreiben macht Angst und ist abstoßend. „Banditen sind auch Menschen“, „Banditen haben ihre Gesetze“ – ein Krebsgeschwür hat auch seine Gesetze von Wachstum und Metastasenbildung, es besteht ebenfalls aus lebendigen Zellen. Aber indem es den Wirt tötet, kommt das Geschwür selbst um. Nach der These der Theologen besteht darin auch die ätzende Absicht des Teufels: die Welt und sich selbst zu vernichten.
Solange es mir gelang, nicht direkt mit den Banditen konfrontiert zu werden, hatte die Gewalt in unserer Stadt unsystematischen Charakter: „Bürger A., Geburtsjahr soundso, geboren in der Stadt B., kam in das Haus des Bürgers C., geboren in der Stadt D., und dort auf den Bürger E. treffend, brachte er ihm zwei Schnittwunden mit dem Messer in den Brustkorb bei“, so sieht das der Ermittler der Staatsanwaltschaft. Aber den Handlanger eines Banditen zu finden, ist genauso leicht, wie von einer anständigen Internetseite auf eine unanständige zu geraten: Man braucht nur ein-, zweimal zu klicken.
Banditen zur Lösung aller möglichen Aufgaben zu Hilfe zu holen, ist die größte Versuchung unserer Zeit. Früher spielte diese Rolle die Staatssicherheit, eine ebenso universelle wie alles durchdringende Institution. Hilfe bei ihr zu suchen galt unter anständigen Menschen als unzulässig, die Situation mit den Banditen ist anders. So rät mir eine äußerst liebenswerte ältere Dame, doch einen reichen Mann um Geld zu bitten: „Er ist kein Bandit mehr, vielleicht ist er es einmal gewesen …“ Er hat der Bibliothek hübsche Vorhänge geschenkt, und eine örtliche Berühmtheit liest an seinem Geburtstag Gedichte vor. Die Berühmtheit ist in der Situation: „Spuck den Übeltäter nicht an, küss ihm die Hand“, ihre Zuneigung zu einem Mann der Tat ist aufrichtig. Was heißt: kein Bandit mehr? Er hat einen großen geistigen Weg zurückgelegt, seine Strafe abgesessen, hat bereut? Oder gibt es jetzt einfach keine Notwendigkeit zu töten? „Dafür studieren seine Kinder in Oxford …“ Kinder sind so eine sensible Angelegenheit! Und wie steht es dann damit: „Der du die missetath der Veter heimsuchest auff Kinder und Kinds kinder“? Der Vorrat an Bösem reicht für lange, die Intelligenzler lassen sich zu leicht von der Stärke verzaubern.
Ein paarmal musste ich die „Brüderchen“ mit den toten Augen behandeln.
Ich frage unschuldig: „Woher stammen die Tätowierungen? Was bedeuten sie?“
„Warum willst du das wissen, Doktor?“
Wozu sind sie denn da? Ein Erkennungszeichen (wie statt „bei der Flotte“ „in der Flotte“ zu sagen), damit wir uns schweigend vor ihm verneigen. Mitwisser niederträchtiger Geheimnisse. Im Flugzeug erzählte mir mal mein Sitznachbar, ein Psychiater (der vier Jahre abgesessen hatte): wie man sich im heutigen Gefängnis oder Lager benehmen muss, um es zu überstehen. Das schien mir vor allem langweilig.
Zum Glück besteht unser Provinzleben in etwas ganz anderem. Es gibt viel Einzigartiges, Rührendes. Da fährst du morgens zur Arbeit, es dämmert noch, und überholst einen winzig kleinen Jungen, der sich mit einer Riesentasche zur Schule schleppt. Das ist Filipók, so etwas siehst du sonst nirgends.
Oder, ein Glückstag, etwas Neues (für mich Neues natürlich) ist dir gelungen und gut ausgegangen, und dann noch einmal, und dann befindest du dich im Zentrum ähnlicher Fälle und wirst von allen gebraucht wie Jewgraf Schiwago. Oder ein Patient (besonders, wenn er nicht sehr krank ist) sagt etwas so Lustiges, dass du schon überlegst, wie du es einem Freund erzählen, wie du es niederschreiben kannst, und du möchtest das schnellstens tun. Während der Anamnese eines sehr erfolgreichen und, wie ich denke, unbegabten Regisseurs frage ich: „Rauchen Sie?“ Und er macht eine einladende Geste mit der Hand: „Nein, aber Sie können ruhig rauchen, wenn Sie wollen.“
Es ist eine Freude, eine bestimmte Perfektion zu erreichen, etwas nicht schlechter zu machen als im Westen. Darin liegt das Wesen unseres Berufs: im ärztlichen Verhalten. Gogols Doktor verhält sich übrigens durchaus arztgerecht: er lügt, dass er die Nase wieder anbringen kann (damals log man ununterbrochen, weshalb Tschechow den Arzt auch Byzantiner nennt), und rät dann: „Waschen Sie die Stelle öfters mit kaltem Wasser …“ – so behandelte man damals: die Hydropathie war eine fortschrittliche Methode. Heute heißt sich arztgerecht benehmen, etwas gemäß den westlichen medizinischen Lehrbüchern tun, sie schützen den Patienten vor der Genialität des Arztes. Wir sind keine Heiler und Retter wie der Seemann aus dem populären Zeichentrickfilm („Was könnte ich denn mal so an Gutem tun?“). „Leute, seid ihr Arzt, weil euer Vater Arzt ist, oder aus Berufung?“ „Weil wir dafür ausgebildet wurden.“
Übrigens behaupten die Spezialisten, Gogol meine nicht die Nase, sondern ein anderes Körperteil. Ich finde, sie haben unrecht, so sehr bin ich nach der Bekanntschaft mit den russischen Beamten von der buchstäblichen Wahrheit dessen überzeugt, was Gogol über sie geschrieben hat.
Viele Menschen und Begegnungen, jeder steht für sein eigenes Russland.
Hier ein dreißigjähriger Programmierer aus der Nachbarstadt: ordentlich, gepflegte Sprache, er erinnert sich, was wann war, womit man ihn behandelt hat, fester Händedruck. Bittet, ihm Literatur zu seiner Krankheit zu geben – er wird schon klarkommen. Äußerst angenehmer Eindruck: man sieht, er braucht dasselbe, was wir brauchen – Freiheit und Ordnung.
Es gibt natürlich auch Kummer, in gewissem Sinn aber auch tröstlichen – weil er zum Leben gehört. Alexander Pawlowitsch ist gestorben, ein zäher, listiger Siebzigjähriger. Ich habe ihn nicht dazu überreden können, seine Aortenklappe auswechseln zu lassen. Genauer: Ich habe es geschafft, aber zu spät. Weder Angsteinjagen noch freundliche Worte, nichts half. Wenn wir einander auf der Straße begegneten, blinzelte er ein bisschen (Sie haben mir umsonst Angst gemacht, Doktor, ich lebe immer noch), dann, als es doch bergab ging, fuhr er nach China (chinesische Medizin), nach einem Lungenödem willigte er in die Operation ein, doch seine Tochter aus Magadan pöbelte mich verzweifelt an (Wer soll sich um ihn kümmern? Was für Garantien können Sie geben, wenn wir einwilligen?). Und so hat es nicht geklappt.
Ein schwerstkranker Oberst a. D. lebt im Dorf. Er hat einen heftigen Infarkt, begegnet den Ärzten mit begründetem Verdacht, lässt sich aber überreden. Ich untersuche ihn zusammen mit einem Kollegen, und wir tauschen kurze englische Stichworte aus – in der dummen Hoffnung, dass der Patient uns nicht versteht. Als wir ihm dann den Sensor aus dem Mund nehmen, sagt der Oberst auf einmal: „How did you manage to get such a piece of equipment?“
Man brachte auch einmal einen echten Amerikaner (er lebt seit ein paar Jahren in unserer Stadt, ist mit einer Ortsansässigen verheiratet) – bewusstlos, er hatte ein Kühlmittel getrunken. Das tut man nicht zum Vergnügen, sondern, um sich umzubringen. Den Tätowierungen nach zu schließen ein einfacher Mann – und zudem ein Trotzkist. Wie sich später herausstellte, spricht er kein Russisch. Warum wollte er sterben? Hat er sich im Jahrhundert vertan? Wir haben es nicht erfahren – wir behandelten ihn mit Äthylalkohol und schickten ihn zur Dialyse. Wieder ein anderes Russland: In Moskau leben anscheinend siebzigtausend Amerikaner.
Ein Wojuross, sprich: ein wohlhabender junger Russe, der sich langweilte, kam aus Moskau. Kerngesund. „Was machen Sie beruflich?“ – „Ich habe ein Business“ (also Arbeit). Nachzufragen traut man sich nicht.
Es gibt in unserer Stadt auch sehr reiche Menschen, die manchmal ebenfalls plötzlich erkranken. Mit einem kamen wir ins Gespräch (der Verdacht auf einen Infarkt bestätigte sich nicht). Er hat Angst zu sterben, und zwar nicht die adrenalinhaltige Angst, die einen nachts weckt und nach Luft ringen lässt, sondern eine ganz rationale: Es gelingt ihm nicht, will ihm doch partout nicht gelingen, sein Lieblingsspielzeug mitzunehmen. Solche, so glaube ich, lassen sich nach dem Tod einfrieren – der Gipfel der Taktlosigkeit dem Schöpfer gegenüber: Ich kümmere mich selbst um mich. Ich reagierte auch gereizt auf die Frage, ob er mir mit etwas dienen könne, war schon drauf und dran, das klassische „Geh mir aus der Sonne“ zu sagen, bat aber um einen weiteren Apparat. Ein dicker, gieriger Junge mit einer schönen Brille, so einer gibt schwerlich jemandem ein Bonbon ab oder lässt einen mit seinem Fahrrad eine Runde drehen. „Nicht mit Fisch füttern, sondern lehren, Fisch zu fangen“, ist das christlich? Hat der Erlöser gelehrt, wie man Fisch fängt, und ihn nicht zu essen gegeben?
Dagegen gibt es Menschen, die von allen zur hinterletzten Sorte gezählt werden: die tadschikischen Arbeiter. Man vergisst schon, dass wir alle in einem Land gelebt, dass sie und wir in der Schule ein und dasselbe gelernt haben. Mühsam rufst du dir in Erinnerung, dass der Komfort unseres Lebens zu diesem Preis gekauft ist, aber es gelingt dir nicht besonders gut: Sie sind Tadschiken, anders, fremd.
Die Nachbarin hält Vieh und interessiert sich für die Ereignisse in der Welt auf ihre Weise. Sie gießt im Gemüsegarten: „Hätten wir doch so einen Schlauch wie der, mit dem man in Europa die Demonstranten auseinanderjagt.“ Auf den Putsch von 1991 reagierte sie folgendermaßen: „Was für Ereignisse es in unserem Land doch gibt, und der arme Gorbatschow ist krank.“ Ihr tun alle leid: Michail Sergejewitsch ebenso wie jeder kranke Mensch und das Kälbchen oder Ferkel, das sie verkauft: „Borja, Ringelschwänzchen“, murmelt sie vor sich hin und sofort danach: „Wollen Sie nicht das Fleisch haben und Schaschlik machen?“
Die Nachbarin erinnert sich ein bisschen an den Krieg, an die Dreißigerjahre erinnert sich niemand mehr. Vor kurzem habe ich (aus zweiter Hand) erfahren, wie man den Trotzkismus in unserer Stadt ausgerottet hat. Der Vorsitzenden der Kolchose – einer Frau mit einer interessanten Biografie und dem Ruf einer Hexe – schickte man die Order: Fünf Trotzkisten enttarnen. (Nach der lokalen Legende zeichnete sich die Vorsitzende durch seltene Schönheit aus. Im Ersten Weltkrieg wurde sie von ihrem Bräutigam, einem Flieger, also zur damaligen Elite gehörig, verlassen, und zwar zugunsten ihrer Schwester. Um die Schwester ins Grab zu bringen, stellte sie Kerzen auf, schrieb Zettel für ihr Seelenheil – ein altes Volksmittel. Mit Erfolg, die Schwester starb, aber den Bräutigam bekam sie nicht zurück.)