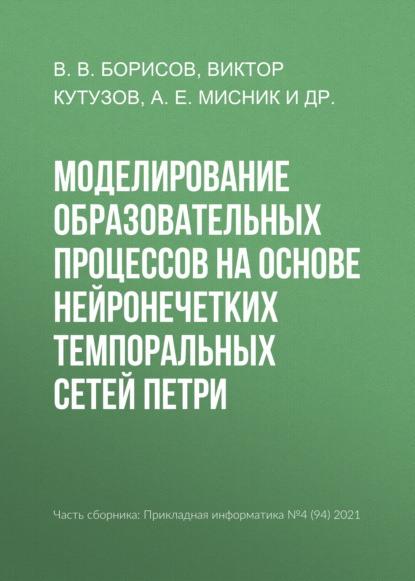- -
- 100%
- +
Obwohl Geisteswissenschaften large scale theories darstellen, bringen sie doch nicht weniger zeitepochale Denkströmungen zum Ausdruck, als dies empirische Wissenschaften tun. Sie sind kulturell, ethnisch, gesellschaftlich und religiös imprägniert, von den Werten, Orientierungen und Sinnattraktoren ihrer Zeit durchsetzt, in unserer Zeit auch politisch und wirtschaftlich „engagiert“ – im doppelten Wortsinn (Gadamer, 1960; Bühler, Ekstein & Simkin, 1998). Man denke hierbei an Fragen der Ethik, die neuzeitlich von Wirtschaft, Politik und Wissenschaften an die Philosophie herangetragen werden, in denen sie bloß noch die Rolle einer „Magd der Notwendigkeiten“ spielt (Badiou, 2015a, 47f.; Fuchs et al., 2010).
Unsere Philosophie ist eurozentrisch, mittelschichtspezifisch und tendenziell an den Geschlechterstereotypien orientiert. Sie hat stets versucht, den „Armen Möglichkeiten und Muße des Denkens zu nehmen, um das Privileg der Philosophie vor der unheilvollen Vermischung mit Zwitterwesen und Bastarden zu bewahren“ (Rancière, 2010). Sie ist daher weder vor Ideologisierungen noch vor Mythenbildungen geschützt und ihren Nutzern, wie die Psychotherapie eine ist, wird hiermit eine dekonstruktivistische Haltung ihren Entwürfen gegenüber angeraten (Petzold & Sieper, 2014; Williams, 2011).
Erkenntnisinteressen von Psychotherapeutinnen richten sich auf die intersubjektive Erfassung von Bedeutungen in den Lebensläufen ihrer Patienten. Lebensgeschichte aber wird subjektiv erinnert und in Begegnungen erzählt (Schacter, 1996; Röttgers, 1992; Bläser, 2015). Psychotherapeutische Einsicht ist daher durch das Maß sozialkonstruktivistischer Erkenntnismöglichkeiten limitiert. Das ist nicht etwa wenig, impliziert aber einen Verzicht auf Objektivierung. Erlebte, erinnerte und erzählte Wirklichkeit ist immer individuelle und soziale Konstruktion, sie ist narrativ, das heißt, nie faktizistisch deutbar (Bläser, 2015). Im Erzählen selbst erfüllt sie die naturwüchsige Funktion, dass die sich erinnernde und erzählende Person in einem Zuge ihre Identität narrativ ,neu erfindet‘ und zusammen mit dem Zuhörer eine entsprechende sequenzielle Wirklichkeit erschafft, eine Wirklichkeit, auf die man sich bezieht, weil sie im intersubjektiven Raum unmittelbarer emotioneller und kognitiver Bezogenheit ko-kreativ erschaffen wurde (Berger & Luckmann, 1969; von Tiling, 2008; Röttgers, 1992).
Dabei spielen die Sprache und das Sprechen nicht die einzige, aber eine zentrale Rolle (Petzold, 2010f.). Hinsichtlich dessen wäre es naiv zu glauben, dass sie bloß dazu da seien, Gedanken, Gefühle oder Bedeutungen zum Ausdruck zu bringen, denn gleichzeitig konstruieren wir im Geflecht ihrer Strukturen und Verwerfungen unser Sein (Jullien, 2010; Krämer, 2001; vgl. Krappmann, 2005). Wie das erlebt wird und wie das intersubjektiv (zurück-)wirkt, hängt ganz vom Erleben und den Attributionen der beteiligten Subjekte ab (Försterling & Stiensmeier-Pelster, 1994). Subjektive Vorstellungen, ihre Bedeutung und ihre Wirkungen auf das Erleben und Handeln sind aus der positivistischen Außenperspektive der Naturwissenschaften schlichtweg nicht erfassbar (Putnam, 1998; Searle, 1991).
Die spezialisierten Gebiete der Natur- und Sozialwissenschaften untersuchen stets nur partialisierte Phänomene (Kühn & Petzold, 1992). Die kürzlich von den Neurowissenschaften aufgeworfene Infragestellung des freien Willens und weitere hegemoniale Deutungsansprüche dieser Teildisziplin zeigte dies überdeutlich (Libet, Freeman & Sutherland, 1999; Libet, 2005; Singer, 2004; Roth, 2003). Der Wille als Epiphänomen neurophysiologischer Vorgänge: Mereologische (Verhältnis vom Teil zum Ganzen), perzeptiologische und deterministische Fehlschlüsse der Hirnforschung konnten schnell nachgewiesen werden (hierzu: Pothast, 2016; Janich, 2009; Pauen, 2004; Bieri, 2003; Schuch, 2012). Das Hirn ist weder die „Seele“ noch der Mensch, schon gar nicht die Person, und es ist auch nicht das handlungssteuernde Organ. Die ehrgeizigen Neurowissenschaften denken, den Menschen allein in biologischen Begrifffen erklären zu können. „Darwinitis und Neuromanie“ (Tallis, 2016) minimieren die Unterschiede zu unseren nächstverwandten Tieren, leugnen die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen und verhindern damit ein klares Denken darüber, wer wir sind und, vor allem, wer wir sein könnten (ebd., 16).
Die Inanspruchnahme wissenschaftlich „geliehenen Wissens“ kann zu Zwecken der Manipulation und Fremdentmündigung angestellt werden, etwa um mit solchem „Faktenobskurantismus“ (Steinweg, 2015) persönliche Interessen in Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft hinein zu kolportieren. Jede Theorie muss an der Erfahrung scheitern können, nur so können sich Erkenntnisprozesse weiterentwickeln (Popper, 1971). In jedem Fall zeigt sich „starkes Denken“ (Arnold, 2018) darin, dass es Alterität, Pluralität und Diskursivität zulassen kann, somit den „Abschied vom Prinzipiellen“ (Marquard, 1986a) vollzogen hat.
Ob aus korrelativen Zusammenhängen und Signifikanzergebnissen in einem Organ des Köpers die Deutung der Unfreiheit des Menschen als Ganzes zulässig ist, dafür sind Metaüberlegungen, der Einbezug anderer Teilwissenschaften erforderlich. In Deutung und Übertragung ihrer Geltungsansprüche sowie in ihren Anwendungen sollten naturwissenschaftliche Erkenntnisse daher plurale hermeneutische Diskurse durchlaufen (Petzold, 1994a). Dies bringt die Aufgabe mit sich, die multiparadigmatische Vielfalt von Begrifflichkeiten aus Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften unter das Dach von „Integratoren“ zu bringen, wie dies im integrativen Ansatz geschehen ist (Petzold, 1993). Es ist traditionell die Aufgabe der Philosophie, in Einzelbefunde zersplittertes Wissen wieder zu kontextualisieren und sie unter das eine Dach des menschlich Wahrnehmbaren zusammenzuführen (vgl. Petzold & Sieper, 2008; Fuchs, 2012; Höffe, 2015).
2 Humanwissenschaftlicher Hintergrund
Mit dieser Hinführung beginnt die Darstellung derjenigen geistes- und humanwissenschaftlichen Ansätze, die eine klinische Relevanz für das Thema der Integrativen Psychotherapeutischen Diagnostik ausweisen. Obligate Lebensthemen, die den Menschen und seine Lebensgestaltung betreffen, wurden ausgewählt und in aller Kürze essayistisch ausgeführt. Sie sollen in dieser Art der Darstellung nicht nur informieren, sondern vor allem zu eigener Auseinandersetzung anregen. Es werden zum Teil starke Positionen bezogen, mit denen man ringen, ja streiten sollte. Erst so erschließt sich der Sinn der Texte. Bei allem steht eine pragmatische Ausrichtung der Philosophie im Vordergrund (Kant, Böhme), die der klinischen Praxis den Vorrang vor der Auseinandersetzung vergleichender theoretischer und metatheoretischer Reflexion gibt. Bestehende Verhältnisse werden nicht einfach nur beschrieben, sondern kritisch beleuchtet und mit einer Tendenz zu transversalen Entwicklungen dargestellt (Petzold, Sieper & Orth, 2013b). Hauptintention dieser Ausführungen „Klinischer Philosophie“ (Petzold, 2003) ist, ein Bewusstsein für ein weiträumiges Menschenbild zu schaffen, das Individuumszentrierung und Solipsismus überschreitet, mit entsprechenden Orientierungen die Haltung der Therapeutin betreffend. So kann jedes der behandelten Themen als diagnostische und klinische Kategorie angesehen werden, die sich auch interventiv nutzen lässt.
Von seiner Charakteristik her präferiert der integrative Ansatz durchgängig ein existenzialistisches, phänomenologisch-hermeneutisches, leibphilosophisches und an Intersubjektivität orientiertes Denken. Der Existenzialismus – als Erbe der Metaphysik (Tugendhat, 2010) – tritt als Versuch des Menschen auf, sich ohne Gott und ohne Seele, nur aus sich selbst heraus zu erklären. Es handelt sich dabei um eine Konkretisierung des Subjekts (Waldenfels, 1987), aber nicht im strukturalistischen Sinn, auch nicht im Sinne eines szientistischen Naturalismus oder im Sinne der Suche nach weiteren genetischen Theorien, sondern im Sinne dessen, was sich dem Subjekt als lebendige Evidenz seiner Selbst- und Welterfahrung, also seiner Wahrnehmungen und Verarbeitungsmöglichkeiten zeigt. In der phänomenologisch-hermeneutischen Leibphilosophie wird eine anthropologische und mundanologische (auf die ganze Welt, z. B. auf Wirtschaft und Ökologie bezogene) Sicht vertreten (Welsch, 2012). Ihr gilt der Leib in der Lebenswelt als der erste, unhintergehbare Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen (Merlau-Ponty, 1966; Bischlager, 2016; Fuchs, 2018). Von dort aus wird das Menschenbild im integrativen Denken aus Ansätzen der philosophischen und evolutionären Anthropologie sowie aus benachbarten Disziplinen heraus beschrieben. Auch hier werden nur jene Themen bearbeitet, die hinsichtlich des Verstehens des Menschen mit seiner Verwundbarkeit für multiple Entfremdungsprozesse bedeutsam sind.
Wenn hierfür der Leib der erste Ausgangspunkt ist, so wird als der nächstdringende die Angewiesenheit des Menschen auf die Einbettung in zwischenleibliche, soziale, gesellschaftliche und ökologische Welten verstanden. Im Kleinen ist damit das erste Biotop gemeint, die Familie, im weiteren Sinne aber die Kultur, die Gesellschaft und die Zeitepoche, das ,Ökotop‘, in das der Mensch hineingeboren ist. Persönlichkeit und Identität des Menschen wurzeln in seiner Leiblichkeit und sind zutiefst durch eine produktive zwischenleibliche und psychische Auseinandersetzung mit seiner sozialisatorischen und kulturellen Umgebung geprägt. In der Zeitepoche der Moderne, der Postmoderne oder der transversalen Moderne ragen aus dieser Ebene auch verstörende Schatten in Entwicklungsräume und Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums hinein, die zum Teil weit abseits des „Unbehagens in der Kultur“ liegen, wie es Sigmund Freud (1999c [1930]) verstand. Globalisierung, Fundamentalismus, Beschleunigung von Arbeitswelten, entgrenzte Machbarkeitsvorstellungen und Entleiblichung von Kommunikation, Überflutung durch Information, Quantifizierung sozialer Beziehungen (social network), Entgrenzung sozialer Transparenz, Erosion der öffentlichen Räume, die Erosion und Agonie der Innerlichkeit aufgrund eines ständigen „Nach-außen-gewand-Seins“ sind nur einige Stichworte hierzu (Kleiner et al., 2003).
Unter diesen Bedingungen wird sowohl die Epigenese der Person als auch die Genese ihrer Störungen als ein komplexer Prozess verstanden, als ein Wechselspiel von Handlung und Wille auf der einen, Widerfahrnis und Kontingenz auf der anderen Seite (Birgmeier, 2007; Seel, 2014). Dem psychotherapeutischen Nachvollzug dieser Metamorphosen, also der Diagnostik, sind damit Limitierungen gesetzt, die mit dem Verständnis des Subjektbegriffs, der hier verwendet wird, noch deutlicher werden. Insofern der Leib mit den Sinnen, seinem Bewusstsein, seiner Ausrichtung auf die Welt hin (être au monde; Merleau-Ponty, 1966) als der unhintergehbare Ausgangspunkt des Subjekts betrachtet wird, kann dieses nicht der „selbstmächtige Grund aller seiner Setzungen“ sein, wie Henrich (2016, 18) im Sinne Heideggers (1929) erläutert. Das Subjekt wird auch nicht allein durch seine Selbstgegenwart (Sartre, 1952) definiert. Dem Subjekt fehlt ganz offensichtlich „jene Fülle, von der jeder Zweifel ausgeschlossen sein könnte“ (Henrich, 2016, 25). Das sich selbst bewusste Subjekt besitzt in diesem Verständnis immer auch Präpersonales, aus dem es schöpft, das es nicht kennt und von dem es nur weiß, dass es als „Chaotisches“ oder „Mannigfaltiges“ in ihm existiert (Schmitz, 2017).
Dies führt in diesem Kapitel zuletzt zu Fragen der Erkenntnistheorie unter solchen Bedingungen. Entsprechend dieser Grundannahmen kann der Weg vom Bewusstsein, von der Wahrnehmung über das Lernen bis hin zum ,Wissen‘ (als ein Festhalten von Bewusstseinsinhalten) nur über phänomenologische, (meta-)hermeneutische und sozialkonstruktivistische Verstehensweisen erfolgen, die den subjektiven Erfahrungs- und Deutungsmöglichkeiten des Menschen keine objektivierende Diagnostik entgegenstellen – in der Terminologie des Verfahrens: über „diskursive Hermeneutik“ (Petzold, 2017a).
Es ist trivial, dass mit der Darstellung geisteswissenschaftlicher Haltungen immer auch Weltanschaulichkeit transportiert wird. Menschen gewinnen ihre Anschauung meist aus traditionellen, kulturellen und religiösen Werthaltungen und Zeitgeistströmungen – bei Psychotherapeutinnen müssen wissenschaftliche Überzeugungen hinzukommen. Alle diese von Foucault so genannten „Diskurse“ beinhalten jedoch deterministische und tendenziell entmündigende Auffassungen, je nachdem, wie weit man an sie glaubt. Eine philosophische Weltanschauung muss es dabei wagen, sich immer wieder auf die eigene Vernunft zu stellen, sie wird alle hergebrachten Meinungen versuchsweise bezweifeln und darf nichts anerkennen, was ihr nicht persönlich einsichtig und begründbar ist (Scheler, 1929; Petzold, 2014e, f). Hierzu soll dieser Abschnitt beitragen.
Im Text verwende ich aus pragmatischen Gründen immer wieder die Termini „wir“ oder „der Mensch“ oder „man“ oder „das Subjekt“. Damit nehme ich eine gewisse Prekarität in Kauf, denn der Einschluss aller Subjekte in eine einzige Aussage ist genau genommen nicht statthaft. Leserinnen und Leser sollten für den Fall, dass sie sich unter eine Aussage nicht subsummiert wissen wollen, sich dieser souverän entziehen. Weibliche und männliche Artikel verwende ich in derselben Weise, in lockerer, intentionaler Folge.
2.1 Einbettung des Psychischen: Leibphilosophie
In der westlichen Welt erleben wir eine Zeit des erst allmählichen Zurückgehens von Vermeidung und Verdrängungen der Erfahrung leiblicher Existenz. Dabei ist die stereotype Art und Weise, wie die Begriffe von Körper und Seele bis vor kurzem gedacht wurden, nicht erst mit dem cartesianischen Denken entstanden. Die Herabsetzung leiblicher Existenz war schon in Platons Metaphysik impliziert, in der nicht die Gegenstände der Sinneserfahrungen die Wirklichkeit abbildeten, sondern deren maßgebliche Urbilder, die „vollkommenen Ideen“ (Vonessen, 2001). Diese Herabsetzung wurde danach lange Zeit in der christlichen Leibfeindlichkeit tradiert, bevor René Descartes zwischen einer denkenden und einer ausgeweiteten Substanz (res cogitans und res extensa) unterschied und diese Differenz als Grundlage des neuzeitlichen wissenschaftlichen Denkens festsetzte (Descartes, 2009 [1641], 79f.).
Dadurch kam es im Deutschen zu einem Bedeutungswandel von dem älteren Begriff des Leibes zu dem des Körpers. Derweil verschwand in der Transzendentalphilosophie (Kant) der Begriff des Leibes fast vollständig. Erst durch Arthur Schopenhauer (1819; Die Welt als Wille und Vorstellung), Friedrich Nietzsche (1883; Also sprach Zarathustra) und die neuere Phänomenologie in Frankreich (Marcel, Lévinas, Sartre, Merleau-Ponty, Henry, Derrida) und in Deutschland (Husserl, Buytendijk, Plessner, Schmitz, Petzold, Böhme, Fuchs, Waldenfels) wurde der Begriff des Leibes, dem noch immer eine religiöse Konnotation anhaftet, in eine andere und erweiterte Bedeutung gefasst.
Diese Bewegung wurde forciert einerseits durch die cartesianische Spaltung, andererseits durch die neuzeitliche Wahrnehmung der Faktizität von Leiblichkeit, eine unhintergehbare und unaufhebbare Konkretheit des Menschen in seiner eigenleiblichen Wahrnehmung, seiner ökologischen Welt- und Selbsterfahrung. Die globale Bedrohung der Leiblichkeit durch Umweltzerstörung, Krieg und Atomrüstung dürfte in diesem Prozess eine Rolle gespielt haben (Beck, 1986, 2008). In den Entwürfen der Phänomenologie suchte man einen kraftvollen Ausdruck, der der cartesianischen Spaltung etwas Wirksames entgegenzusetzen hatte – dieser fand sich im Leibbegriff (Petzold, 1986).
Körper und Leib
Insofern der frühzeitliche Mensch, zu Zeiten Platons Ideenlehre, den Körper als Materie, als Gefäß oder Fahrzeug für die Seele verstand und die Seele als eine den Körper gebrauchende Instanz‘, entfernte er sich vom einheitlichen Leiberleben, sah im schwer zugänglichem Dunklen seiner Leiberfahrungen, in dessen diffusem, irrationalen Wollen eine Art Gegenspieler der Seele oder des Geistes. In der Konstruktion verschiedener Instanzen sind der Alpdruck der Natur und der Versuch seiner Verdrängung zu finden. Auch wenn es unter den Stoikern, etwa mit Hierokles (Inwood, 1984), Philosophen gab, die bereits in die neuzeitlichen Richtungen eines „Selbstbesitzes und der Zugehörigkeit“, sogar eines „Bei-sich-zuhause-Seins“ (griech. oikeiosis) dachten, schlug diese Angst vor dem Leiblichen erst mit der Renaissance in eine wissenschaftliche Erkundung und Entdeckung des Körpers im heutigen Sinne um (Böhme, 1985).
Was man hier im Wortsinn ,ent-deckte‘, ist aber nicht der eigene, lebendige Leib, sondern der Körper des Anderen, ein Körperding, das sich dem ärztlichen Blick preisgibt. Der Körper wird als Maschine konzipiert, die sich über verschiedene Organe und Stoffwechselvorgänge am Leben erhält. Dafür sind Transportsysteme (Blut, Lymphe), Informations- und Steuerungssysteme (Nerven, Gehirn, Hormone), Austauschsysteme (Haut, Immunsystem), reproduktive Systeme (Geschlechtsorgane) und Bewegungssysteme (Gelenke, Muskeln) vonnöten. Innerhalb dieser zergliedernden Vorstellungen werden gleichzeitig mögliche therapeutische Zugangsweisen zum Körperlichen festgelegt. Der Stoffwechsel muss versorgt und reguliert, die Transportsysteme müssen beschleunigt oder gebremst, in die Steuerungssysteme muss eingegriffen, die Immunsysteme müssen unterstützt, die Bewegungssysteme trainiert oder apparativ substituiert werden (ebd., 117).
Die Verwissenschaftlichung des Körpers zeigt sich hier als die radikalste Verdrängung des subjektiv Leiblichen. Wahrnehmungen und Zeugnisse des eigenleiblichen Spürens, die sich durch das anatomische Wissen nicht mehr deuten lassen, werden als bloße Epiphänomene in die Seele oder ins Geistige abgedrängt.
Dabei sind es bezeichnenderweise leibliche Phänomene, die zur Aufnahme einer ärztlichen oder psychologischen Behandlung führen: Unwohlsein und Schmerzen. In cartesianischer Sicht sind Schmerzen Begleiterscheinungen‘, Korrelate nicht funktionierender Systeme, ihre Ursachen werden im Körperlichen gesucht, auch im Rahmen psychischer Symptomatik. Die primäre leibliche Anmutung und das Auf-sich-zusprechen-Lassen des Schmerzes werden als unsinnig gedeutet. Psychosoziale Aspekte von Krankheit, seien sie verursachender Natur oder deren Folgen, werden marginalisiert oder in eine Wechselwirkung hineingedeutet, deren Mechanismus man nicht mehr versteht, weil die Schnittstelle‘ nicht aufgefunden werden kann. Dabei wird gerade die affektive Betroffenheit in der Art und Weise, wie wir leibliche Empfindungen erfahren – der Umstand, dass wir ihnen nicht ohne Weiteres ausweichen können –, zum Anlass, ihnen eine unabhängige Substanz zuzuschreiben, die ,Seele‘. Von dem Moment an aber drängt sich die Frage auf, wie das Problem vom einen in den anderen Bereich hinüberwechseln kann. Und als ob dies nicht alles schon ausreichend kompliziert wäre, wurde dieser Übergang, das ,Somatisieren‘, etwa durch die frühe Psychoanalyse, auch noch als neurotisch und unreif gedeutet.
Damit wird verständlich, dass man von Leib nur sprechen kann, wenn man erstens die Seele – als metaphysisches Konzept, das rein phänomenologisch vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann – verneint, zweitens die Rede vom Körper von der über die Leiblichkeit und das eigenleibliche Spüren trennt. Die Existenz des Mentalen scheint an den Körper gebunden zu sein, seine Wahrnehmung an den Leib und die Bedeutungssysteme des Subjekts. Den Körper als solchen kann man nur im Modus der Fremderfahrung wahrnehmen: als den toten Körper des Anderen, als materielles Ding unter anderen Dingen. Leiblichkeit dagegen ist vom Grund her lebendige Selbsterfahrung. Als Leib ist dasjenige zu verstehen, als was ich mich selbst spüre, mit dem Bewusstsein, dass ich es selbst bin, das ich da spüre (Schmitz, 2007a; Böhme, 1985, 120).
In diesem ,eigenleiblichen Spüren‘ ist immer schon das Bewusstsein um sich und die Ökologie des Leibes enthalten, außerdem phylogenetische Informationen – im integrativen Denken spricht Petzold (2011a) vom „informierten Leib“. Die Strukturen eigenleiblichen Spürens entsprechen dabei selten den körperlich-biologischen. In der Selbstwahrnehmung der Leiblichkeit spüren wir die Grenzen des Leibes nicht so, wie wir sie etwa im Spiegel wahrnehmen. Vielmehr zeigt sich eigenleibliches Spüren als ein lockeres Ensemble wahrnehmbarer Leibesinseln mit unklaren Rändern, die schwankend mehr oder weniger stark hervortreten, die okkasionell auftauchen und wieder verschwinden. Hermann Schmitz (2007a) spricht von Engung und Weitung, von Spannung und Schwellung, ergänzend könnte man von Schwere und Leichtigkeit, auch von Hellung und Dunkelung sprechen.
Den eigenen Leib spürt man weder vollständig noch andauernd. Im alltäglichen Tun verschwindet die Wahrnehmung eigenleiblichen Spürens bisweilen fast vollständig. Sie kann sich auf das Spüren einer gerade verrichteten Tätigkeit zuspitzen, hin und wieder verschwindet sie im Rücken hoher Konzentration. Weil es vom Spüren her keine feste und kontinuierliche Konstitution gibt, gilt dieses Phänomen auch für andere Formen eigenleiblicher Wahrnehmung, etwa das Ich, das Bewusstsein, die Identität usw., die in ihrer räumlichen Ausdehnung auch über Körpergrenzen hinaus ausgreifen können. So etwas geschieht etwa in der Wahrnehmung von Atmosphären, beim gemeinsamen Musizieren oder in gemeinsam verrichteter handwerklicher Tätigkeit. Diesen Prozess nennt Hermann Schmitz (ebd.) „Einleibung“.
Obwohl eigenleibliches Spüren eine eigene Kategorie der Wahrnehmungen darstellt, wird es natürlich vom empirischen Wissen über den Körper überlagert. Wenn wir etwa unter den letzten Rippenbögen in der Mitte des Körpers Schmerz wahrnehmen, vermuten wir, dass es der Magen sei, den wir da spüren, aber den Magen als solchen und als Ganzen spüren wir nicht. Wenn wir Lustempfindungen haben, spüren wir den eigenen Leib in der Gegend der Geschlechtsorgane, aber mit ausgeweiteten Rändern. Beim Schreiben dehnen wir unsere Leiblichkeit durch die Hand hindurch bis in die Bleistiftspitze hinein aus. In dieser und ähnlicher Weise betrifft dies das Gesamt des eigenleiblichen Spürens.
Entfremdungsprozesse vom eigenleiblichen Spüren registrieren wir, wenn wir uns im Falle von Unwohlsein nicht mehr zutrauen zu wissen, was mit uns los ist. Der Mensch hochtechnisierter Gesellschaften weiß entweder nichts mehr von seinem Leib, will nichts von ihm wissen oder er möchte die Verantwortung für ihn an Wissenschaftsexperten delegieren. Seine Leiblichkeit ist ihm unheimlich, er kann die leiblichen Regungen nicht mehr als Empfindungen und Gefühle deuten, weiß sich in ihnen nicht zurechtzufinden, noch weniger, sich ihnen hinzugeben, sich vom Angenehmen oder Unangenehmen führen zu lassen. Er hat die Vertrautheit darein verloren. Das kann zu Ängsten und weiter bis zur ständigen Besorgnis, krank zu werden, führen. Bedingungslos begibt er sich dann in die Hände von Spezialisten.
Dort aber wird nur der Körper behandelt. In der neuzeitlichen Medizin geht die Entfremdung von Leiblichkeit so weit, dass in Form evidenzbasierter Behandlungsleitlinien nicht mehr der Mensch, sondern nur noch die vermeintlichen körperlichen Ursachen von Funktionsstörungen medikamentös oder instrumentell manipuliert werden. Obwohl also die Stimmungen und Gefühle leiblich erfahren werden – sie den eigentlichen Grund zur Aufnahme einer ärztlichen Behandlung darstellen – und auch körperliche Schmerzen immer mit affektiver Betroffenheit einhergehen, richtet sich die Behandlung nicht mehr an den phänomenologisch wahrgenommenen Symptomen aus, die den Menschen unmittelbar betreffen.
Begriff und Vorstellung von Leiblichkeit heben mit diesen Überlegungen den Dualismus auf. Der Leib wird zum ersten, unhintergehbaren Ausgangspunkt der Verstehensweisen des Menschen. Dies hat weitreichende Konsequenzen für Diagnostik und Therapie psychischer und psychosomatischer Krankheiten. Wenn der Leib die Einheit darstellt, die die Kategorien des Körpers, der Gefühle, des Geistes, der Erinnerung, der Wahrnehmungen, des Willens und des Verhaltens in das Bild einer einzigen, in sich komplex aufgebauten Entität fasst, ist es nicht mehr nötig, einen wie auch immer gearteten Übergang vom Geistigen ins Körperliche zu suchen. Rein phänomenologisch drücken sich Befindlichkeiten und Verstörungen des Menschen dann auf irgendeiner dieser Ebenen aus und sind nur noch drauf angewiesen, dass sie vom Subjekt oder von Spezialisten richtig verstanden und gedeutet werden, nämlich als vitaler Ausdruck des Lebendigen selbst. Von dort aus beginnt die Suche nach den Sinnimmanenzen von Symptomen auf dem Weg des Sicheinlassens auf die Kontingenz eigenleiblichen Spürens und auf intersubjektive Validierungen der Erfahrungen.