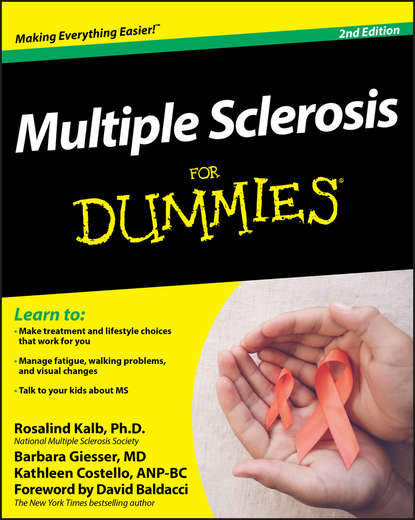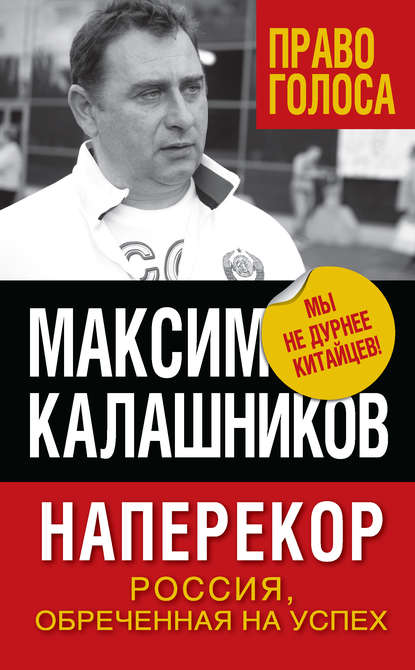- -
- 100%
- +
Dennoch bleibt es Aufgabe des Menschen, Körper und Leib zu integrieren. Das gilt für alle Aspekte naturwissenschaftlicher Erkenntnis, etwa der Anatomie und Physiologie, heute insbesondere für die Genetik und Epigenetik, die Resultate der Hirnforschung und der neurohumoralen Prozesse. Und es gilt natürlich auch für Identitätsprozesse, die zum Teil im eigenleiblichen Spüren wurzeln. Leiblichkeit kann nicht ohne ihre Bettung in soziale Kontexte und Ökologie, daher auch nicht ohne ihre Intentionalität gesehen werden. Merleau-Ponty (1966) sprach von einem „Sein zur Welt hin“. In dieser Form ist unsere gesamte phylogenetische Ausstattung auf die Anpassung an unsere Umwelten ausgerichtet (Stefan, 2019). Dies alles will in einen Selbstentwurf im Sinne der Leiblichkeit überführt werden (Petzold, 2011a).
Eingedenken der Natur im Subjekt
Die Philosophie der Neuzeit zeigt umgekehrt ein entschiedenes Desinteresse dem Thema „Natur“ gegenüber. Sie überließ dieses Feld lange Zeit kritiklos den empirischen Wissenschaften, so als hätte sie mit der Natur des Menschen nichts mehr zu tun. Erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde die Thematik wieder aufgegriffen, etwa durch Merleau-Ponty, Plessner, Buytendijk, Petzold, Waldenfels und Böhme. Böhme (1985) arbeitete das Programm des „Eingedenkens der Natur im Subjekt“, das ursprünglich in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno formuliert wurde, für die Leibphilosophie weiter aus. Sein Diktum in der Sache ist, dass der „Leib die Natur ist, die wir selbst sind“ (ebd., 119ff.).
Was in leibphilosophischer Hinsicht als Natur verstanden wird, ist unterschieden von dem, was einerseits die Biologie, andererseits die platonische Philosophie darunter subsummierten. Das ist zunächst einmal wenig spezifiziert als geboren werden, atmen, essen, trinken, schlafen, behütet werden, später spüren, sich bewegen, erkunden, lieben, leiden, wachsen und reifen, denken, wollen, fühlen, handeln und schließlich wieder sterben. Die Wiederentdeckung der Leiblichkeit muss als eine Folge der Entwicklungen in der technischen Zivilisation verstanden werden. Dass sie in diesem basalen Sinne heute auffällig wird, liegt etwa am sogenannten „Umweltproblem“. Das ausbeuterische und zerstörerische Verhalten des Menschen der Natur gegenüber schlägt auf den Menschen selbst zurück: Es wird am ,eigenen Leibe spürbar‘. Es zeigt sich hier als unhintergehbares, eigenleibliches Erleben, „dass die Beziehung zur äußeren Natur im Kern eine Beziehung des Menschen zu sich selbst ist“ (ebd., 120). Betrachtet man die Umgangsformen des Menschen mit der äußeren Natur, so zeigt sich, dass er mit der eigenen Natur nicht viel anders umgeht: objektivierend, instrumentalisierend, ausbeuterisch, destruktiv.
Auf der anderen Seite haben die platonische Philosophie und die Theologie die Natur als etwas betrachtet, wovon der Mensch sich abheben muss, um Mensch zu sein. Kultur und Tugenden waren Resultate der geistigen Distanzierung von Natur, sodass Natur als etwas Äußeres, ja, als eine Gegeninstanz der Tugenden gesehen wurde (Aristoteles, 2009). Die bewusste Rekognition des Umstandes, dass das Leben nicht nur Handlung, sondern auch Widerfahrnis ist, hat unter Umständen als Wunsch, sich von der Unmittelbarkeit dieser Erfahrung herausnehmen zu wollen, viel dazu beigetragen, dass Instanzen wie das Ich und die Seele erfunden wurden. Bei Hegel (1807) wird die Naturerfahrung als ein Außer-sich-Sein des Geistes bestimmt; bei Helmut Plessner (1975) wird das Charakteristikum des Menschen als Möglichkeit zur Exzentrizität beschrieben. So erscheint die Natur in klassischen Selbstdefinitionen des Menschen (Gehlen, 1950) als etwas Äußerliches oder zu Überwindendes. Natur wird zu etwas, ,was wir nicht selbst sind‘. Aber diese Bewegungen entfremden den Menschen seiner selbst und machen ihn in Hinsicht auf seine eigene Natur heimatlos (Böhme, 2008, 123).
Mit diesen Überlegungen wird eine neue Sicht auf Natur gefordert. Dadurch, dass wir durch unsere Leiblichkeit selbst Natur sind, ist uns quasi eine Möglichkeit gegeben, die Substanzialität von Natur von innen her zu sehen und zu spüren (Bischlager, 2016). Diese Sicht wird Kontrolle und Ausbeutung hinter sich lassen können, auch die Idee, in einer Art „Gehäuse“ zu sitzen, das wir nach unseren Vorstellungen benutzen könnten. Was daher Natur für uns ist, hängt davon ab, wie wir uns zu ihr verhalten (ebd., 158). In unserer Kultur und Zeitepoche steht es weder um die Kultivierung der Innerlichkeit noch um Orientierungen des eigenleiblichen Spürens besonders gut. Die deutsche und die österreichische Kultur pflegten ein intensives Nach-außengewandt-Sein und höchste Leistungsbereitschaft, um eine ganze Epoche traumatisierender politischer, gesellschaftlicher und persönlicher Ereignisse aus dem letzten Jahrhundert ins Vergessen zu bringen.
Der moderne Mensch der Hochleistungsgesellschaften lebt als cartesianischer Mensch größtenteils über seinen Leib hinweg. Er glaubt, über seinen Körper wie über ein Eigentum verfügen zu können, er konzipiert sich als biologische Maschine, die ihm im Leben Möglichkeiten eröffnet. Um den Erhalt dieser Optionen zu sichern, muss er die Maschine irgendwie am Laufen halten. Bei allem, was er für sich selbst, seine Mitmenschen oder die Natur entscheidet, sind Vorteilserwägungen im Vordergrund und nicht das Bewusstsein um eine singuläre oder kollektive Dimension der Leiblichkeit. Die Regungen des Leibes sind ihm fremd und er kann damit wenig oder gar nichts anfangen. Er kann sie weder als Empfindungen erleben noch als Hinweise, die ihn orientieren könnten. Im Umgang mit unangenehmen Widerfahrnissen denkt und deutet er sie schnell als Symptome einer Störung, als Folge seiner Fehler. Über Schwächen und die Unveräußerlichkeit des eigenen Leibes tröstet der moderne Mensch sich mit den Handlungsmöglichkeiten der Hochleistungsmedizin hinweg.
In Hinsicht auf Verantwortlichkeit und Selbstfürsorge macht es also einen Unterschied, ob ich im Bild meiner Vorstellungen einen „Körper habe“ oder in selbstverantwortlicher Regie „mein Leib bin“. Mit Medikamenten jeder Art die Maschine wieder zum Laufen zu bringen, macht in Krisen Sinn, genauso viel Sinn macht es aber, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Vorgehensweise die implizite Idee propagiert, dass für die Widerfahrnisse des Lebens keine subjektiven oder sozialen Kompensations- und Regulationsmöglichkeiten zu Verfügung stünden. Unter psychopharmakologischer Dauermedikation können mentale, emotionelle und leibliche Möglichkeiten atrophieren, die Herausforderungen des Lebens direkt auf sich zusprechen zu lassen, der Bewegung, die daraus entsteht, zu folgen und auf diese Weise ein sich stellendes Problem auch als Startkapital für die eigene Entwicklung zu betrachten. Manchmal geht es nicht anders, aber Lernerfahrungen und organismische Anpassungen wirken. All diese Vorstellungen bleiben nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sie treten als Einstellungen zum Anderen hin und als handlungsrelevante Vorstellungen auch ins Gesellschaftliche und Politische hinüber.
Auch wenn ich Leib bin, kann ich in Exzentrizität hierzu treten und meinen Leib zum Gegenstand der Aufmerksamkeit machen (Plessner, 1982). Ein Resultat von Bewusstheit und Exzentrizität, von Aneignung eigenleiblichen Spürens, Reflektierens und Konnektivierens ist das, was die Psychologie mit großer Selbstverständlichkeit wie eine eigene Entität behandelt und das „Selbst“ nennt. Bei Sokrates war das die Seele, die den Körper und alle Dinge benutzt. In platonischer und auch in cartesianischer Tradition nimmt dieses Selbst vom Körper Gebrauch und vergisst, dass es selbst Leib ist. So wie das Ich jedoch eine Bezeichnung für eine Konstruktion ist, so wird auch das Selbst als eine Konstruktion des Geistes verstanden. Allerdings stellt diese sich als eine durchaus selbstbewusste, sich verselbständigende dar: Das Ich und das Selbst haben nicht das Selbstverständnis, eine Konstruktion zu sein. Damit aber das Selbst als ein Eigenes erfahren werden kann, müssen wir es uns erst aneignen. Diese Aneignung ist aber genau nicht als Inbesitznahme zu verstehen, sondern als eine Hinwendung, als ein Versuch, Einvernehmen damit zu erreichen, dass das Leben nicht nur Handlung, sondern auch Widerfahrnis ist. Dies bezeichnet die „Urtatsache, dass uns etwas zustößt, zufällt, auffällt oder einfällt, dass uns etwas glückt oder auch verletzt“ (Waldenfels, 2015, 20). Somit geht es also darum, aus der Entfremdung von der Leiblichkeit in eine Form der Teilhabe oder sogar Vertrautheit mit ihr zurückzufinden.
Vom Kopf auf die Füße gestellt, müssten wir daher aus leibphilosophischer Sicht von einem „Leib-Selbst“ sprechen (Petzold, 2011), in philosophischer Hinsicht von einem „Selbst-Sein, das sich selber denkt“ (Henrich, 2016), und weiter von einem Selbst, das weder transzendent noch naturalistisch, sondern rein phänomenologisch verstanden werden kann (Metzinger, 1995, 1996). Dieses könnte sich dann zumindest auch als Natur denken – als ein Teil von etwas – und seine Biologie als eine Kategorie der Leiblichkeit verstehen. In Identifikation mit seiner eigenen Grundlage müsste dem personalen Selbst mit dem ,Körper‘ nicht notwendig etwas Fremdes entgegentreten, wodurch die Person ihrer Kraft und Produktivität beraubt werde. Es könnte sich synthetisieren mit der Natur der eigenen Leiblichkeit, sich sogar eingemeinden lassen, das heißt, sich eingelassen und verbunden fühlen.
In dieser Verbundenheit besteht das Selbst-Sein im Natur-Sein vor allem darin, dass die Lebensvollzüge eine latente Selbstbezüglichkeit erhalten. Wie der Mensch seine Natur erfährt, hängt nicht nur von seiner Ökologisation, seiner Sozialisation in Lebenswelt und Einbettung in die Natur, ab (Petzold, 2016), sondern auch von seinem Verhalten zu sich selbst. Herrmann Schmitz (2007a) nennt das „leibliche Betroffenheit“, Gernot Böhme (2008, 165ff.) auch die „betroffene Selbstgegebenheit“. Sie zeigt sich im Schönen und in der Emphase genauso wie im Leiden. Sie zeigt sich außerdem in der Erfahrung des Getragen-Seins von einer Natur, die auch „nicht ich selbst bin“. Hier geht es also nicht nur um das Erlangen eines „partnerschaftlichen Verhältnisses“, sondern um das unhintergehbare Verständnis, dass die eigene Natur weder vollständig zu verinnerlichen noch vollständig zu veräußerlichen ist (Thürnau & Barkhaus, 1996). In diesem Sinn, und auch weil der Leib dem Menschen damit erste und letzte Autorität ist, stellt sich die Beziehung des ,autonomen Subjekts‘ zu ihm oft als scharfkantige Herausforderung dar.
Reflektierend nimmt der Mensch von sich Abstand und wird so zum bewusst Handelnden. Diese Reflexivität aber schießt über ihr Ziel hinaus, der postmoderne Mensch vergisst, dass er auch Kontingenzen und Widerfahrnissen ausgesetzt ist, und er versteht sich in der Moderne nur noch als handelndes Subjekt. Für alles, was ihm widerfährt, glaubt er nicht nur final Verantwortung übernehmen zu müssen – das wäre hinzunehmen –, sondern er hält sich auch kausal für alles verantwortlich. Hierin zahlt er den Preis dafür, sich vom Leib, von der eigenen Natur, die ihn trägt, von der Welt als ein autonomes Selbst distanziert zu haben. Regungen und Bewegungen des Leibes aber setzen sich durch, unbeachtet und unbewegt vom Ich, das im Gespinst seiner Ideen gefangen bleibt (Böhme, 2017).
Vom Menschen muss der Leib daher als etwas Gegebenes betrachtet werden. Er ermöglicht innerhalb der Grenzen, die ihm gesetzt sind, Handlungsspielräume, er zeigt aber auch Limitierungen auf, die wir nicht ohne Schaden zu nehmen überschreiten können. Man wird sich daher mit Gernot Böhme (ebd.) fragen, ob in der Moderne nicht eine gewisse Bereitschaft, sich etwas geben zu lassen, notwendig ist, um den Ernst der eigenen Existenz zu wahren – Gutes wie Herausforderndes.
So behandeln auch die Naturwissenschaften das Menschsein in einem Modus, der das Selbst-Sein ausblendet. Bei all dem ist freilich zu bedenken, dass der Cartesianismus, der in unserer Kultur gelebt wird, uns spaltet in ein Ich und ein Körperding, das dieses Ich zu seinen Zwecken nutzt. Das Programm der Leibphänomenologie will aufzeigen, wie tief diese Differenz in unserem Denken eingesenkt ist und wie ungesund diese Entfremdung wirkt.
Ursprung des Subjekts
Die Leibphilosophie (Böhme, 1985) stellt den Aspekt des Lebens als Widerfahrnis in den Vordergrund, weil das leibliche Sich-gegeben-Sein zunächst immer eine pathische Erfahrung ist, also etwas, das einem geschieht. Es sind nicht die Akte des Willens, der Handlung oder des Ichs allein, in deren Gefolge das Leibsubjekt in Erscheinung tritt. In der Dialektik der Aufklärung stellen Horkheimer und Adorno (1988) den Ursprung des Subjekts als Ergebnis einer Überlebensstrategie des Menschen dar. Die Entzweiung von Natur und Vernunft habe dem Menschen die Beherrschung der äußeren Natur ermöglicht. Der Preis dafür war die Unterwerfung auch der eigenen Natur. So entstand das autonome Subjekt als Abhebung von seiner eigenen Natur. Das Subjekt wird in dieser Vorstellung als Instanz der Naturbeherrschung vollkommen entleiblicht.
Böhme (2008) hingegen sucht den Ursprung des Subjekts nicht in der Entzweiung mit der Natur, sondern aus der Leiblichkeit selbst heraus zu deuten. Die Furcht vor dem Leiden, Scheu vor der Regression, die Angst vor dem Selbstverlust, das sind Themen, die das Einverständnis mit der eigenen Natur behindern. Er definiert den Ursprung des Subjekts genau hier, in der Erfahrung von Schmerz, wo keine andere Theorie eine Fundierung des Selbst für möglich halten würde: „Es ist das verpanzerte Ich, das sich auf solche Erfahrungen nicht einlassen will oder kann“ (ebd., 143). Es ist die „Enge eines auf sich zurückgeworfenen Lebensvollzugs, aus dem das Ich sich losreißt“ (ebd.), gleichzeitig kann es aber seine Eingelassenheit in den Leib wieder erleben.
Dem Schmerz ist eine Betroffenheit mitgegeben, die das Ich-Bewusstsein im ersten Moment in den Hintergrund treten lässt. Angst, Schmerz, Hunger, Durst usw. rufen eine Ahnung oder sogar die Gewissheit der Selbstgegebenheit auf den Plan – ein Ich ist dafür noch nicht vonnöten. Der Schmerz wird zunächst als etwas Fremdes erfahren, das mich aber angeht: „Es schmerzt mich.“ Es ist der Schmerz, der mir den Körper unausweichlich als meinen Leib zuordnet (ebd., 156). Das phänomenologisch verstandene Leib-Selbst erlebt sich verwundbar im „Urzustand seiner kreatürlichen Unfreiwilligkeit“ (Lévinas, 1998; Czapsky, 2017) oder im Zustand seiner „Jemeinigkeit“, wie Heidegger (1929) es ausdrückte. Erst im Austritt aus der Regression des Schmerzes bildet sich das Ich, das nun konstatiert: „Ich habe Schmerzen“, und das diese Schmerzen nun im nächsten Schritt – entfremdet – als Sachverhalt des Körpers versteht und behandelt. Diese Form „leiblich betroffener Selbstgegebenheit“ ist bei Böhme das Prinzip der Subjektivität.
Leiblichkeit indes ist niemals isoliert zu denken, sondern immer im Aspekt von Interaktion, Sozialität und Ökologie, also der Zwischenleiblichkeit (Merleau-Ponty, 1966). Sie entsteht aus der erotischen Begegnung von Frau und Mann (Marion, 2013), die ein Ereignis im Sinne Badious (2016a) darstellt. Sie reift während der Gestation im Mutterleib in engster organismischer Verbundenheit (Petzold, 1995, 2011) heran, und ihr Überleben ist auch nach der Geburt ohne intimste leibliche Eingebundenheit nicht denkbar. Formen der Angewiesenheit verwandeln sich über die Lebensspanne zwar qualitativ und graduell, sie stellen aber eine der grundlegenden konstitutiven Bedingungen dessen dar, was wir die „Person“ nennen. Im Abschnitt über die Epigenese der Person werden diese Skizzen noch weiter ausgeführt (siehe II/2.4).
Böhme verneint die Bildung des Subjektbewusstseins aus der Interaktion mit dem Anderen nicht, aber er hält sie für prekär. Den Ursprung des Subjekterlebens nicht allein auf die Sozialität oder die Kultur zu projizieren, macht Sinn, denn hierin wäre es erstens vollkommen entleiblicht, zweitens sozialökologisch vollkommen abhängig. Es umgekehrt nur in die Leiblichkeit zurückzudeuten, wäre ebenso prekär, weil hiermit die soziale und ökologische Dimension der Leiblichkeit ausgeblendet würde. Erst wenn Leiblichkeit, Sozialität und Ökologie als zusammengehörig verstanden werden, kann ein Bild unhintergehbarer Bezogenheit des Subjekts auf die Welt hin entstehen. Bei Merleau-Ponty (1976) ist es das Verhalten des Menschen „zur Welt hin“ (être au monde), die leibliche, sinnsuchende Interaktion des Menschen mit der Welt, die eigentlich erst Humanbewusstsein erzeugt. Bewusstsein und Subjekt-Sein sind daher nie an sich primär, sondern sie sind primär in den Leib zurückgebunden. Das sinnbezügliche Verhalten, somit auch die Sprache und das Sprechen, das Denken und das leibliche Empfinden treten als Vermittler zwischen Leib und Umwelt auf und stellen so die Grundbedingungen des Bewusstseins und des Person-seins erst her (Derrida, 2012, 2013; siehe II/2.5).
So müssen vielschichtige „Quellen des Selbst“ anerkannt werden (Taylor, 1996). Das Selbst im Gefolge dieser Vorstellungen ist ein phänomenologisches Leib-Selbst, das epigenetisch aus der Synergie von Leiblichkeit, Sozialität und Ökologizität emergiert. Als im pragmatischen Sinn inkarniert (Merleau-Ponty, 1966) kann das Subjekt betrachtet werden, wenn vonseiten einer phänomenologisch wahrnehmbaren Bewusstseinsinstanz durch das Subjekt die Selbstaneignung der Leiblichkeit im Modus einer Identifikation vorgenommen wurde (Metzinger, 1996). Das ist aber nicht nur Aktivität im engeren Sinn, sondern auch ein pathisches Geschehen (Böhme, 1985), das etwas mit reflektierender Besinnung (Henrich, 2016), mit Zustimmung und Hingabe zu tun hat (Lévinas, 1998) und dann erst zu einem reifen Subjektsinn führt: Aneignung als ein Prozess des „wachen Nichthandelns“ (Hogrebe, 2006).
Weil die Natur, die Selbsttätigkeit des Leibes, uns immer wieder einholt, uns bedrängt, wir ihr ausgesetzt sind bis in die Regression und bis ins Sterben, bleibt es für das emanzipierte Subjekt immer noch und immer wieder eine Frage des praktischen Selbstverhältnisses, ob man die leiblichen Regungen als Gefährdungen des Selbstbesitzes erfährt, sie wegdrängt, sie als ,bloß körperlich abtut‘ oder sie zulässt, sich von ihnen führen lässt, aus ihnen lernt und sie als Zeichen der eigenen Lebendigkeit, sogar als Orientierung für das eigene Denken, Urteilen, Fühlen und Handeln entgegennehmen kann. Freilich, wenn diese Bewegungen nicht leidvoll sind, mag uns das leichter gelingen und sie erfreuen uns sogar – etwa beim Einschlafen oder im Vollzug der Sexualität. Wie auch immer, dem reifen Menschen ist seine Natur nie bloß äußerlich, sondern etwas, das er mit seinem Leib selbst ist: „Ich bin überhaupt nur ein [Subjekt], insofern ich mir unausweichlich [als Leib selbst] gegeben bin“ (Böhme, 2008, 148f., 157, Einfügung durch Autor; vgl. auch Waldenfels, 2000). In dieser Sicht ist das Subjektsein etwas potenziell Radikales, weil unverwechselbar und solitär. Damit stellt es die grundlegende Bedingung des revolutionär Neuen dar (Badiou, 2014).
Leibliche Präsenz, Daseinserfüllung
In Zeiten des Krieges, in mühsamer körperlicher Arbeit und Produktion, Versklavung und Verachtung des Lebens muss es notwendig gewesen sein, Leiblichkeit zu verleugnen, den Körper zu disziplinieren, ihn auf Herausforderungen und Gefahren hin abzurichten. Aber auch jetzt, da in unserer Gegenwart und Kultur diese Notwendigkeiten weitgehend in den Hintergrund getreten sind, ist die leibliche Präsenz im Sinne einer positiven Daseinserfüllung nicht von selbst gegeben.
Zum einen sind unsere Kultur und unser Denken, auch ohne die krassen Notwendigkeiten früherer Zeiten, immer noch vom Leistungsprinzip und anderen Verdrängungen durchdrungen (Marcuse, 1965), zum anderen ist das eigenleibliche Spüren oder Bei-sich-Sein immer an die Herausforderung der Begegnung mit sich und anderen gebunden – Konsequenzen des Daseins als Mensch. Der schlichte Wunsch, ,mehr bei sich sein zu können‘, impliziert oft nicht im Geringsten seine Bindung an die Konfrontation mit existenziellen Lebensthemen: Es sucht das Feine, Vergnügliche, Beruhigende, Saturierte. Bei sich sein kann aber bedeuten, in einem Zug mit dem Schönen auch alles Unangenehme spüren zu müssen. Das Selbst-Sein im Vollsinn eigenleiblichen, also phänomenologischen Spürens und Wahrnehmens stellt sich dem Menschen als eine Aufgabe dar (Böhme, 2012, 2017).
Daseinserfüllung wird in unserer Kultur nicht in erster Linie in lustvoller leiblicher Existenz gesucht, sondern eher in Bereichen des Erfolges, der gesellschaftlichen Stellung, im Besitz und im Ansehen. Obwohl das Gelingen dieser Vollzüge an sich nur eine mögliche Voraussetzung für das „Glück der Sterblichen“ (Janke, 2002) darstellt, spreizt es sich oft genug schon als „Glück an sich“ auf (Fenner, 2004). Als tiefgreifend wirksam für diese Verschiebungen werden hier der christlich-abendländische Glaube und Dogmatismus angesehen, die Formen leiblichen Vergnügens an sich schon als schuldhaft ausgearbeitet haben (Caillois, 1988; Frielingsdorf, 1997). Die psychische Gewalttätigkeit durch christliche Moral und religiöse Schuldzuschreibungen die Natur des Menschen betreffend, die Entwertung leiblichen Daseins, die Entmündigung, Okkupation und Verfolgung haben dafür gesorgt, dass das Bewusstsein des Menschen in ein Gegenstands- und Sozialbewusstsein ohne Leiblichkeit habituiert ist: Man ist „außer sich“ (Girard, 2012; Agamben, 2010).
In Sein und Zeit beschreibt Heidegger (1929), wie über Schuldbewusstsein die Vergangenheit und Sorgen die Zukunft betreffend die leibliche Gegenwart versäumt wird. Diese Bewegung wird heute durch eine dritte Ebene der Ablenkung geboostet, in der hybride Formen von Information und Kommunikation, die Akkumulation digitaler sozialer Welten im globalisierten Kontext, den Menschen in eine mentale und leibliche Ataxie verfrachten, in eine Agonie des Gegenwartsbezugs (Baudrillard, 1978), in der er zuerst seiner Mitte und seines Daseins verlustig geht, anschließend ungeheure Anstrengungen zur Wiedergewinnung des zuvor Verlorenen unternimmt (Böhme, 2017; vgl. Han, 2016). Das ist moderne Daseinserfüllung.
Reine Lust und Freude am leiblichen Dasein im Sinne des Verweilens (Han, 2015a) sind heute alles andere als eine selbstverständliche Kategorie. In den meisten Verrichtungen unseres Alltags ist die leibliche Anwesenheit schon gar nicht mehr vonnöten. Die zwischenleibliche Kommunikation wird vielfach durch jene am Bildschirm ersetzt oder in Algorithmen digitaler Medien simuliert (Jullien, 2014a). Bloß noch im Urlaub will man ,selbst da‘ gewesen sein. Wenn es (auch) hier nicht nur um das Posten geht, kann man annehmen, dass ein Erleben, vielleicht sogar ein Abenteuer gesucht wird, jedenfalls eine Erfahrung des eigenleiblichen Spürens (Schmitz, 2007). Aber „das Gefühl[,] da zu sein, stellt sich nicht mit dem Ereignis des Ankommens ein, sondern erst nach einem gewissen Zurücktreten, einem Abwarten, bis die Szene [und die Atmosphäre] sich öffnet und die Dinge auf einen zutreten“ (Böhme, 2017, 132; Einfügung durch Autor; vgl. Petzold, 1993e). Dies erfordert die Umstellung vom zugreifenden und konstatierenden Blick hin zur empfangenden Anschauung (Jullien, 2010). Für eine solche Erfahrung darf die Umgebung nicht nur ein zweidimensionales Bild sein.
Noch deutlicher wird das Erfordernis leiblicher Anwesenheit im Bereich der Kommunikation, wenn diese nicht mehr nur auditiv und visuell ablaufen soll. Hier geht es um eine Aktualisierung gemeinsamer leiblicher Anwesenheit (Böhme, 2017). In der Unmittelbarkeit des Sich-in-Augenschein-Nehmens, der freundschaftlichen Berührungen, des unverfälschten Hörens einer Stimme, des Sich-zu-erkennen-Gebens (Bauer, 2012; Henry, 2018) usw. wird jede Form der Subversivität, die die elektronischen Medien ermöglichen, in konkrete leibliche Kommunikation verwandelt. Noch bevor das erste Wort gesprochen ist, wird man bereits vom Gegenüber wahrgenommen, steht man schon in Beziehung, hat man sich bereits zu verantworten. Dass diese Herausforderungen für den postmodernen Menschen oft schon zu viel sind, man sich lieber hinter Bildschirme zurückzieht, spricht für die Entfremdung von leiblicher Präsenz. Selbst ein lebendiges Schweigen in leiblicher Anwesenheit mutiert so zum vakuumierten Warten auf die Antwort nach dem Absenden einer WhatsApp-Nachricht.