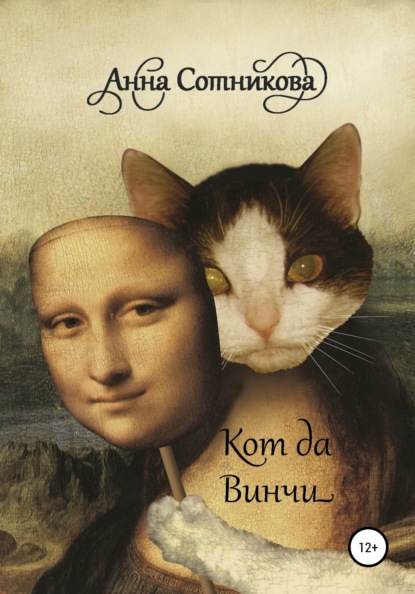Lied vom stillen Sommernachtstraum

- -
- 100%
- +
Die Morgendämmerung beginnt mittlerweile kurz nach fünf. Im Februar war das immer mein Startsignal, zurzeit kann ich mich nicht dazu motivieren, mit dem ersten Tageslicht auch aufzubrechen, dabei könnte ich so ordentlich Strecke machen. Die vier Surfer vom Abend tauchen sieben Uhr wieder auf, Zeit für mich zusammenzupacken und aufzubrechen. Auf die Düne rauf und wieder runter zum Fahrradweg, auf dem man nur äußerst selten eine Menschenseele antrifft. Der Lauf durch den Pinienwald ist eine Tortur … überall fiese Bremsen, die einem ständig beißen wollen. Andauernd schlage ich um mich, eine Pause ist nicht drin, nicht einmal für fünf Sekunden, weil sonst schlagartig ein Dutzend dieser Blutsauger auf dir hocken. Und verdammt, wenn sie einem wo auch immer beißen, ist das deutlich unangenehmer als bei Mücken. Und was mich so richtig nervt, diese Viecher kriegt man nur schwer totzuschlagen, oft muss man zwei- oder dreimal auf sich selbst einschlagen, um das Vieh auf der Haut zum Schweigen zu bringen. Manchmal schlägt man auch vorbei und trifft nur sich selbst. Hundert, zweihundert, vielleicht sogar dreihundert Schläge bekommt man hier pro Stunde ab, so muss sich das Leben eines Boxers anfühlen. Ich habe mir überlegt, ob ich trotz der Wärme beim Laufen lange Klamotten anziehe, aber ich habe ja gar keine Chance (Zeit!) mich umzuziehen. Wenn ich jedoch meinem Lebensmotto treu bleiben und hinter allem etwas Positives sehen möchte, gelingt das auch hier: Man läuft und läuft und läuft … so ist es nicht schwer, über vierzig Kilometer am Tag zu laufen. Das Gefühl auf der Flucht zu sein ist die beste Motivation, die man haben kann. In Lacanau-Océan treffe ich dann endlich mal auf ein paar Menschen; ein Urlauber aus Mönchengladbach füllt meine Wasserflaschen auf. Auch in diesem Ort sind wieder viele Surfer unterwegs, dieser Küstenstreifen muss ein richtiges Surferparadies sein. Dass hier guter Wind herrscht, kann man an den hohen Dünen erkennen. Vom kleinen Urlaubsort geht es wieder in den Pinienwald hinein und zurück zu meinen Freunden. Menschen sind keine zu sehen und die Kilometerangaben der Wegweiser auf dem Radweg sind schon sehr demotivierend … da sind es auf einmal 16 Kilometer bis zum nächsten kleinen Ort. Da Pausen nicht drin sind, laufe ich auch diese 16 Kilometer durch, denke an meine Kleine, muss dabei lächeln und bin dadurch abgelenkt. Das Meer ist nicht zu sehen, etwa fünfhundert bis tausend Meter entfernt. Autos sind hier weiterhin nicht zu hören, auch nicht aus weiter Ferne, welch eine Seltenheit! In dieser Stille laufe ich meinen viertausendsten Kilometer, nicht mal zum Jubiläum ist eine Pause drin. Da ich außer Laufen nichts weiter zu tun habe, entwickle ich nebenbei eine neue Mordtechnik: Ich schlag auf das Vieh, roll es anschließend zwischen Daumen und Zeigefinger wie einen Popel zusammen, schnipse die Kugel nach unten, trete drauf und schiebe Sand über das noch immer zuckende Etwas drüber. So sollte man mit allen Schmarotzern umgehen, mich eingeschlossen. Immerhin verlange ich meinem Körper heute einiges ab, denn ab Hourtin-Plage geht es barfuß auf Sand weiter, da der Radweg nun drei Kilometer von der Küste entfernt verläuft. Direkt am Strand sind nur vereinzelt Blutsauger unterwegs, den starken Wind vertragen sie anscheinend nicht, weshalb sie den Schutz des Waldes suchen. Zwanzig Kilometer auf Sand sind wie vierzig Kilometer auf Asphalt, bei einem vollkommen blauen Himmel lässt sich dabei die Einsamkeit aber leichter ertragen. Dafür fehlt der Schatten des Waldes, die pausenlose Sonne kostet zusätzliche Körner. Nach einigen Kilometern tauchen endlich wieder viele Bunker auf, die meisten davon stehen jedoch unter Wasser. Der Strand hier trägt den Namen Le Pin Sec. An einem Bunker, der trocken liegt, überdacht ist und einen schmalen offenen Eingang hat, lungern ein paar Jugendliche und sonnen sich. Ich setze mich etwas abseits von ihnen hin, rauche und verfolge wie die Sonne dem Horizont immer näherkommt – das Stück Sky and Sand von den Kalkbrenners passt ganz gut dazu, hat eine euphorisierende Wirkung auf mich. Die Jugendlichen verschwinden währenddessen, so kann ich unbemerkt den Bunker in Augenschein nehmen. Ich kann mich nicht dazu bringen, in den Bunker richtig hineinzukriechen, einschließlich mich hinter die halb geöffnete Stahltüre zu trauen, denn der modrige Geruch ist doch sehr unangenehm, außerdem ist es stockduster und man sieht wirklich rein gar nichts, da bringt auch mein Handy-Display als Taschenlampe nichts. Also bleibe ich im schmalen, überdachten Eingangsbereich an der frischen Luft, wie maßgeschneidert für meine Matte, jedoch leider mit Aussicht zur Düne und nicht zum Meer. Als perfekter Windschutz ist dieser Schlafplatz aber nicht zu unterschätzen. Außerdem kann ich beruhigt hier liegen und muss nicht – jedes Mal wenn ich aufwache – zum Himmel schauen, um nach Sternen zu suchen. Wer weiß wie viele Kilometer der nächste überdachte Schlafplatz entfernt wäre. Den Sonnenuntergang verbringe ich natürlich mit Blick aufs Meer, es ist mild, Musik läuft noch immer, eine weitere Zigarette, irgendwie schön, ich fühle mich gut. Wahrscheinlich kann ich den Moment auch mehr genießen, weil ich bereits für die Nacht meinen Schlafplatz, der mir eine trockene und warme Nacht verspricht, gefunden habe. Wenig später liege ich in meinem Schlafsack, blicke der Nacht ins Maul, während sie gerade die Düne verschluckt. Dass es hinter mir noch tiefer in den Bunker geht und ich keine Ahnung habe, was genau dort ist, bringt etwas Nervenkitzel – also genau für mich gemacht!
Am Morgen am Strand zu laufen bringt trotz aller Anstrengung Freude. Nur du und der Ozean, die Luft ist fantastisch, die Sonne scheint. Aller paar hundert Meter sind bis zu einhundert Zentimeter lange Fischkadaver zu begutachten, irgendwie spannend. Im kleinen Badeort Montalivet-les-Bains laufen mir nackte Menschen entgegen, FKK, ich grüße alle Leute mit einem lockeren „Bonjour“. Die Bunker hier werden immer mehr vom Atlantik verschluckt. Meine Ernährung an diesem Tag setzt sich nur aus Bonbons zusammen, weil mir die Preise in den kleinen Supermärkten zu teuer sind, genauer: dreimal so hoch wie üblich. Ein paar Läden öffnen für die Touristen, aus einem Laden ist eine Endlosschleife Somebody That I Used to Know zu hören, während ich gerade in meinem Tagebuch schreibe. Ich brauche Wasser und frage bei einem Kellner nach, der gerade Gäste im Freisitz bedient. Das kalte Wasser ist an diesem heißen Tag eine Wonne. Schließlich geht es auf Radwegen abseits des Meeres weiter; zwei holländische Radler halten neben mir an. Kurzer Plausch, die beiden umrunden einmal Frankreich … mir wird ein Stück Baguette spendiert, dass ich – als ich wieder allein bin – sofort beim Laufen verputze, ich habe Mordshunger. Im Wald und überhaupt bleibe ich der einzige Wanderer, klar, die Entfernungen zwischen den Orten sind auch gewaltig. Auch nach Soulac-sur-Mer sind es weitere 17 Kilometer.
In diesem kleinen Ort muss ich leider Abschied vom Jakobsweg nehmen, dieser Jakobsweg war wahrscheinlich mein Letzter. Ich gönne mir eine Tagebuchpause hinter der Wallfahrtskirche Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres (was für ein Name!). Es ist schon später Nachmittag und ich brauche nun doch wenigstens ein paar Kekse … ab in den Supermarkt, wo Lana del Rey zum ersten Mal seit Rota wieder Video Games „für mich“ singt. Draußen gibt ein Mann seinem Baby einen Schmatzer, mir kommen die Tränen. Von Soulac Richtung Norden ist der Radweg auch deutlich befahrener, es ist Freitagnachmittag, viele Familien sind unterwegs. Je weiter der Tag voranschreitet, desto ruhiger wird es wieder. Einer der letzten Radfahrer des Tages kommt mir entgegen, hält neben mir und fragt mich, ob ich einen guten Schlafplatz während der letzten Kilometer gesehen habe. Schwierig. Philipp (25) aus Erfurt campt eigentlich nicht wild, aber auch nicht auf Campingplätzen. Stattdessen sucht er sich meistens einheimische Familien, die ihm für eine Nacht Obdach gewähren, entweder im Haus oder in ihrem Garten, wo er sein Zelt aufbauen darf. Das klappe bisher in Frankreich prima, was mich sehr überrascht. Die Franzosen seien sehr gastfreundlich, berichtet Philipp, meist wird er sogar zu den Mahlzeiten eingeladen. In Frankreich ist es wichtig, dass man auf die Leute zugeht und es dabei immer in ihrer Sprache versucht. Offensichtlich hat Philipp vom Schulfranzösisch noch nicht soviel vergessen wie ich. Da ist er ganz klar im Vorteil, bisher kann ich jedoch auch nicht klagen, schließlich lebe ich noch. Philipp empfiehlt mir, es demnächst auch mal zu versuchen, nur Mut, man hat ja dabei nichts zu verlieren. Vor allem bei Bauern sind die Erfolgschancen groß. Von seiner Offenheit Menschen gegenüber kann ich noch viel lernen, nicht umsonst war er es, der neben mir stehen blieb und dadurch erst diese interessante Begegnung ermöglichte. Mitten auf dem Radweg plaudern wir über dies und das, erfahren dabei, dass der andere genauso am Tag zuvor die Viertausend-Kilometer-Marke geknackt hat, Philipp auf dem Rad, ich zu Fuß. Einhundert Kilometer am Tag radeln, dass ich nicht ohne, möglicherweise würde ich das nicht so gut meistern, wie vierzig Kilometer am Tag zu laufen. Seine Rundreise startete er in der thüringischen Heimat, fuhr weiter über Nordrhein-Westfalen nach Belgien, anschließend bis nach Brest (Bretagne) und immer in der Nähe zur Küste hier runter. In Bordeaux war er schon, ihm hat es dort sehr gefallen … schade drum. Als nächstes soll mit der Freundin, die bald zu ihm stößt, nach Spanien und Portugal geradelt werden. Gutes Stichwort, ich werde endlich mein Kartenmaterial los, jetzt habe ich ein reines Gewissen und ein Kilogramm weniger Gepäck. Selbst solch ein Fakt, dass das Gepäck nun dauerhaft etwas leichter ist, bringt neue Zuversicht. Es war verdammt schlau, die Reise mit 25 Kilogramm Gepäck zu beginnen, denn dadurch werde ich nicht vergessen, was ich imstande bin zu leisten, es gibt also keinen Grund, bei 20 Kilogramm zu jammern. Spontan hat Philipp die Idee, dass wir die kommende Nacht gemeinsam im Zelt verbringen könnten, er hat ein paar hundert Meter zuvor einen Picknickplatz gesehen, hinter dem man im Wald das Zelt aufbauen könnte. Wir laufen gemeinsam dorthin, setzen uns als erstes an einen Tisch, wo mich Philipp zum Abendessen einlädt, denn mein Proviant ist mal wieder aufgebraucht. Wir sind allein, von den unzähligen Mücken mal abgesehen. Wir vertilgen einen ganzen Laib Brot; Philipp schmiert sich Avocado auf die Brotscheiben, streut Salz drauf … ich probiere, interessanter Geschmack … Wir essen vegetarisch, zum Brot gibt es außerdem Banane, Gurke und Honig. Als Dessert gibt es ein Kuchengebäck, von dem wir auch kein Stück übriglassen. Was für eine Mahlzeit! Dazu die tolle Stimmung, das angenehme Gespräch. Philipp hat sein Lehramtsstudium weitestgehend hinter sich gebracht und ist nun zu dieser beeindruckenden Fahrradtour aufgebrochen. Er erzählt von einer Frau, die einen Fahrradschaden hatte, er ihr schließlich half und sie ihn unbedingt dafür bezahlen wollte. Er lehnte immer wieder ab, aber sie steckte das Geld ihm heimlich zu. Als er es bemerkte, wäre er ihr am liebsten hinterher gerast, um es ihr zurückzugeben. Widerwillig nahm er den Zehner mit und will nun das Geld so schnell wie möglich loswerden … und da hat er auch schon den Einfall, dass es ja eine gute Sache wäre, wenn er mich mit den zehn Euro sponsert. Im Gegensatz zu Philipp ist es mir nicht möglich, das Angebot abzulehnen … im Gegenteil, ich freue mich riesig über dieses Blutgeld … wieder etwas Aufschub. Jedoch stimme ich mit ihm überein, dass es irgendwie übel ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo Dankbarkeit anscheinend ganz automatisch mit Geld ausgedrückt wird. Als gäbe es nichts anderes …
30 Meter in den Wald hinein finden wir einen recht ebenen Platz für das Zelt. Philipp baut das große Zelt in einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit auf, meine Hilfe wird nicht benötigt. Philipp war clever, hat dieses 450 Euro teure Zelt auf einer vorherigen Reise gesponsert bekommen, musste dafür nur einen Testbericht schreiben. Warum komme ich nicht auf solche Ideen? Wahrscheinlich weil mich selbst diese kleine Verantwortung überfordern würde! Wir packen unsere Rucksäcke ins Zelt und laufen die 500 Meter zum langen Strand. Wir sind allein, schmeißen uns die Sachen vom Leib und gehen ins Wasser – also ich schleiche, Philipp stürmt hinein und wirft sich todesmutig in die erste größere Welle. So hart bin ich nicht, mir ist das Wasser eindeutig zu kalt, selbst die Fußknöchel schmerzen vor Kälte. Nur langsam laufe ich hinein, nicht mehr als eine Katzenwäsche, denn zu allem Überfluss habe ich auch noch vergessen, die Brille abzunehmen. Geschwommen und getaucht wird also nicht, aber immerhin war ich nun endlich seit meiner Gambia-Reise mal wieder im Atlantik. Dort war das Wasser aber auch viel wärmer, selbst im Januar. Danach hocke ich mich im Schneidersitz auf den Sand, schreibe im Tagebuch, während Philipp Fotos vom Sonnenuntergang über dem Meer knipst … es müssen über hundert Bilder sein, die er liegend und stehend zu einem einzigen Fotomotiv macht, auch von mir, wie ich schreibe und die Sonne gerade vor mir am Horizont untergeht. Draußen in der Gironde-Mündung kann man in einigen Kilometern Entfernung den 400 Jahre alten Leuchtturm von Cordouan sehen, der da ganz allein auf einer kleinen Insel steht … hat was. Die Spitze der Halbinsel Médoc, zwischen Atlantik und dem Mündungsarm der Gironde gelegen, ist nicht mehr fern. Dort (Pointe de Grave) wird mich die Fähre auf die andere Seite der Gironde übersetzen. Die Stimmung ist toll, Philipp setzt sich zu mir, wir genießen leise den Moment. Wenn man mit einem anderen Menschen einen Sonnenuntergang gemeinsam erlebt, nur diesen einen einzigen, so bleibt dieser Moment unvergesslich.
Mit Philipps Stirnlampe ist es mir im Zelt möglich, noch meinem Tagebuch von diesem Treffen zu berichten. Eine französische Familie rastet 40 Meter weiter, jedoch durch die Bäume kaum zu sehen, und die Erwachsenen fluchen lautstark über die ungeheuerlich vielen Mücken … was sind wir froh, hier drinnen geschützt zu sein. Und müssen etwas lachen, wie schrecklich laut die beiden schimpfen, das hat etwas von einem Comedy-Sketch. Schließlich geben sie es auf und fahren ab … nun haben wir unsere Ruhe, keine Autos zu hören, ich knipse das Licht aus. Philipp fragt mich, ob meine Reise religiöse Gründe hat. Für ihn ist der katholische Glauben ein Teil seiner Identität. Bei mir ist das anders, keine Religion, aber ohne „Glauben“ würde es nicht gehen. Ich berichte von meinen Beobachtungen, die ich an mir selber während dieser Reise bereits gemacht habe. Dass ich Trost darin finde, in Kirchen zu gehen, wo ich in meinem „normalen“ Leben nie etwas mit Kirchen anfangen konnte, allein der Drang in eine Kirche hineinzugehen ist völlig neu für mich. Philipp hört mir gespannt zu … es vergehen ein bis zwei Stunden, ehe die Vernunft siegt und wir beschließen, endlich unseren wichtigen Schlaf zu holen, schließlich steht ein weiterer anstrengender Tag bevor, für Philipp, für mich … das ist meine erste Zeltnacht auf dieser Reise. Und es wird mit Sicherheit auch die bisher heißeste Nacht werden! Also was die Temperaturen betrifft …
Halb sieben stehen wir auf. Die vielen Mücken nerven beim Zusammenpacken. Philipp gibt mir sein letztes Geld (30 Euro), er kann sich im Laufe des Tages an einem Bankautomaten Geld holen, sagt er. Ich notiere seine Kontodaten und versichere, dass Geld so schnell wie möglich zu überweisen. Philipp ist deswegen nicht nervös, zweifelt nicht an meiner Ehrlichkeit. Ich bin richtig erleichtert, für die nächsten Wochen bin ich also abgesichert, die Vorfreude auf die kommenden Etappen ist wieder deutlich gestiegen. Bevor wir in entgegengesetzte Richtungen aufbrechen, gönnen wir uns noch ein Frühstück unterhalb der Düne, wo sich die Mückenbiester nicht blicken lassen. Philipp schmeißt den Gaskocher an, ich spendiere das Wasser zum Kaffee, den wir gemeinsam aus seinem Pfadfinder-Becher trinken. Aus einer Schüssel löffeln wir warmen Haferbrei, den wir mit zwei Bananen und einem Apfel noch aufgepeppt haben. Eines dieser seltenen Frühstücke dieser Reise, das diesen Namen auch verdient hat. Philipp ist auf dem Land groß geworden, wurde katholisch erzogen, besaß nie einen TV, ist in keinen sozialen Netzwerken im Internet zu finden. Das ist weise. Er schreibt lieber Postkarten an die Familie und an Freunde. Eine tägliche SMS an die Freundin darf auch nicht fehlen, damit sie sich keine Sorgen macht. Gegen halb neun stehen wir schließlich an einer Pistengabelung, der Zeitpunkt des Abschieds ist gekommen. Ich werde melancholisch, gestehe Philipp, dass ich gern manchmal jemand hätte, der auf mich wartet oder der zusammen mit mir die Welt erobern möchte. Er hat da seine Freundin, ist vielleicht dadurch sogar motivierter als ich. Aber da ist nun mal nichts zu ändern: Ich habe niemand, niemand steht hinter mir, ich bin allein … es ist okay. Wir umarmen uns, wünschen dem anderen eine gute Reise und schon bin ich wieder allein unterwegs. So ist das Leben, Alleinsein gehört dazu.
Zum Fähranleger sind es noch zwei Kilometer. Eine lange Fahrzeugschlange hat sich gebildet. Ich habe es einfacher, laufe einfach durch, kaufe mir mein Ticket und springe an Bord. Suche mir einen Sitzplatz im Freien, es wird viel Deutsch gesprochen. Gutes Timing, die Fähre fährt wenig später ab. Es geht bei schlechter Sicht über den fünfzehn Kilometer breiten Mündungstrichter der Gironde ins vierte Département, Charente-Maritime, mit seiner Hauptstadt La Rochelle. Der erste Ort ist jedoch Royan (18.000 Einwohner), das 1945 bei britischen Luftangriffen zerstört und modern neu aufgebaut wurde. Keine schöne Stadt, viel Beton, selbst die große Kirche Notre-Dame wurde aus Beton gebaut. Ich laufe am großen Jachthafen vorbei und bin insgesamt knapp zwei Stunden in der Stadt unterwegs. Es ist Samstag, an den Marktbuden reihen sich die Menschen, mir etwas zu stressig. Bummeln kann ich nur außerhalb von Ortschaften. Auffallend ist aber, dass sehr viele Franzosen Beutel mit langen, unverpackten Baguettes durch die Gegend tragen … meist sind nur eins, zwei Baguettes im Beutel, nichts anderes. Es ist also ein absolut zutreffendes Klischee. Mir sind die Dinger aber zu teuer, ich muss mich von einer Packung Chips ernähren. Ich komme an einem Kiosk vorbei, erfahre dabei erst jetzt, nach knapp zwei Wochen in Frankreich, dass Sarkozy als Staatspräsident durch Hollande abgelöst wurde, das geschah in den Tagen, als ich vom spanischen ins französische Baskenland gelaufen bin. Unterwegs interessiert dich so etwas aber auch nicht, was spielt das schon für eine Rolle, wer französischer Präsident ist? Klar, ohne Sarkozy wird es nun noch etwas öder in der europäischen Politik. Das ist dann aber auch schon alles.
Zur Mittagszeit verlasse ich Royan, laufe dabei auf den Fußwegen entlang der flachen Felsenküste. Viele Strände hier, der starke Wind bläst mir meinen Hut vom Kopf. Die nächsten Orte reihen sich übergangslos aneinander. In Frankreich muss ich in der Regel Umwege in Kauf nehmen, wenn ich eine der großen Supermarktketten suche, um günstig einzukaufen … das geht in Frankreich nur bei Super U und Co. In Saint-Palais-sur-Mer habe ich Glück, ein Super U ist ausgeschildert, das ist meine erste günstige Einkaufsmöglichkeit seit Tagen. Problem in Frankreich: es gibt selten Entfernungsangaben, da kann der Supermarkt 500 Meter oder auch 5 Kilometer entfernt sein. So laufe ich also immer den Schildern nach, einmal links, dann wieder rechts, immer weiter, ich komme immer mehr aus dem Ort raus … „première à gauche“ steht schließlich geschrieben … okay, also die nächste Querstraße nach links, Sackgasse, nervig … irgendwann habe ich es dann doch geschafft, schnappe mir einen Korb (Anfängerfehler!) und zahle den in mir schlummernden Heißhunger Tribut. Der Korb ist voll, das mir übergebene „Blutgeld“ von Philipp ist schon wieder weg. Solche Heißhunger-Attacken sind jedoch auch entschuldbar, Philipp konnte meinen Hang zu Naschkram (vor allem in Form von Pausenbelohnungen) gut nachvollziehen. Auch er hat schon mal eine Packung mit acht Hörncheneis gekauft und alle hintereinander verdrückt. Dachte schon, dass außer mir sonst niemand auf so eine Idee kommt. Mit vier Kilogramm zusätzlichem Gewicht geht es weiter, da ich nicht alles im Rucksack verstaut bekomme, muss ich eine Plastiktüte mit diversen Keksverpackungen an den Rucksack hängen, das sieht vielleicht mal bescheuert aus! Ich muss mal wieder über mich selbst den Kopf schütteln. Ich lebe nach derselben Devise wie die meisten Menschen: „Was man hat, das hat man.“ Selbst ein Vagabund denkt in dieser Hinsicht nicht anders. Auf einem Picknickplatz lange ich kräftig zu: 500 Gramm Selleriesalat zum langen Baguette (in den großen Supermärkten finanzierbar), außerdem Wurst und Käse und 1,5 Liter billige Cola. Völlig vollgefressen schleiche ich weiter, immerhin ist das Wetter perfekt (Sonne-Wolken-Mix, 17 Grad Celsius). Man merkt jedoch sofort, ob man ein paar Kilo mehr im Rucksack hat. Nach zwei Kilometern zurück zum Meer brauche ich die nächste Pause. Ich studiere mein Kartenmaterial, damit in der Zwischenzeit mein Magen wieder mit sich und seinem schweren Leben klarkommt. Die große Übelkeit ist schließlich weg und ich kann auf einem küstennahen Radweg durch den Pinienwald in den Erholungsort La Palmyre laufen. Am Straßenrand liegt eine kleine Schlange, sie rührt sich nicht, aber es sind auch keine Verletzungen zu erkennen – irgendwie faszinierend, also Tiere aus nächster Nähe zu sehen, die man sonst praktisch nie zu Gesicht bekommt. Ich überlege kurz, ob ich sie noch etwas näher betrachten soll, finde aber nicht den Mut dazu … vor Schlangen habe ich Respekt, wie man so schön sagt, in Wahrheit habe ich natürlich einfach nur Schiss. Sie sind mir schlichtweg suspekt. Außerdem bilde ich mir ein, dass jede Schlange, der ich begegne, giftig ist. Wahrscheinlich würde ich auch eine Blindschleiche für eine giftige Schlange halten, dabei würde ich sogar gleich doppelt irren. Diese Schlange hier ist aber vielleicht wirklich giftig, denn nebenan befindet sich der Zoo, der angeblich meistbesuchte Zoo Frankreichs … La Palmyre schlägt Paris, das Leben bietet immer wieder große Überraschungen! Mich machen Zoos jedoch traurig. Genauso wie Hochzeitskolonnen.
So langsam aber sicher lassen die Sohlen meiner Sobrados nach. Ich mache mir Sorgen, obwohl noch zwei weitere Paar Schuhe an meinem Rucksack baumeln. Außerhalb der Ortschaften bleibt es ruhig, kein Straßenlärm, zum Samstag einige Leute auf ihren Fahrrädern unterwegs. Aus „bonjour“ wird nach einigen Stunden „bonsoir“ und schließlich stehe ich am großen, roten Leuchtturm Le Phare de la Coubre, etwas abseits des Fahrradweges. Ein paar wenige Familien sind noch auf der Düne oder am Strand unterwegs. Nur 25 Meter vom Leuchtturm entfernt steht ein zwei mal zwei Meter kleines Häuschen. Keine Fensterscheiben, keine Türen, aber intakte Wände und noch wichtiger: ein intaktes Dach. Es steht völlig verloren auf der Düne, niemand läuft in nächster Nähe daran vorbei. Ich kann gar nicht anders als hier zu bleiben, um die Nacht direkt neben dem Leuchtturm zu verbringen. Ich wollte zwar noch zehn Kilometer laufen, aber ich versuche nach wie vor die Geschenke des Weges anzunehmen und mich an ihnen zu orientieren. Ich ziehe also in das Häuschen ein, werfe den Müll nach draußen, streiche den trockenen Sandboden eben … ist noch nicht kuschelig und weich genug … ich schnappe mir ein in der Nähe liegendes Brett, schaufle noch einen Zentner Sand von draußen durchs Fenster hinein ins Innere. Wieder glattgestrichen, Matte so ausgerollt, dass ich im Liegen durch den schmalen Fensterspalt genau auf das Leuchtfeuer blicke. Perfekt. Auch die Tatsache, dass einmal mehr an einem Schlafplatz kein Zivilisationslärm zu hören ist. Man hört das 100 Meter entfernte Meer, die Vögel und den Wind. Ich bin dankbar für einen weiteren schönen Schlafplatz. Da die Sonne soeben am untergehen ist, verlasse ich meine Hütte für einen Moment und steige die Düne zum höchsten Punkt hinauf. Höre Musik, blicke zum Meer hinaus, die Sonne hinter einer dünnen Wolkenschicht am Horizont, esse zu Abend, trinke ein Bier, rauche eine Che, knipse Fotos, der 26. Mai findet einen triumphalen Ausklang.
Die Nacht ist fantastisch ruhig und angenehm warm. Immer wieder wache ich auf und sehe dabei das sich im Kreis drehende Leuchtfeuer – es ist einer meiner liebsten Schlafplätze. Halb sieben stehe ich auf, blauer Himmel; keine Menschen, keine Mücken … es gab da eine Zeit, da war für mich beides ein und dasselbe. Die ersten zwei Stunden geht es auf Radweg im Wald Forêt de la Coubre gut voran. Ich blicke rüber zur größten französischen Atlantikinsel Île d’Oléron. Ein Fuchs kreuzt meinen Weg. Die Stimmung ist gut. Erst im Badeort Ronce-les-Bains wird es wieder zivilisiert, mit entsprechenden negativen Begleiterscheinungen, allen voran Lärm. In der Mittagssonne und ohne den Schatten der Bäume ist es zu heiß, um stundenlang durchzulaufen. Eine Pause führt mich in die Touristen-Information, um mich nach dem Weg nach Rochefort und La Rochelle zu erkundigen. Ich erfahre, dass es vorerst nur auf Landstraßen weitergeht, die Stimmung bekommt einen Knacks. Hinter dem Ort nehme ich die einzige Brücke über den breiten Fluss Seudre und laufe auf der Straße zum Schloss Château de la Gataudière. Ich setze mich auf eine Mauer vor dem Eingang, esse Kekse, wobei ich viel mehr Bock auf ein kühles Bier hätte. Manchmal kommt ein PKW oder ein Wohnwagen vorbei, stoppt auf der Straße vor dem Eingang, Fenster wird heruntergelassen, ein Foto geknipst und die Fahrt fortgesetzt. Da ich mitten im Bild sitze und mir meine Kekse reinschlinge, steigt auch der ein oder andere aus, geht an mir vorbei, knipst ein Foto, steigt wieder ein und schon sind sie wieder weg. Es gilt keine Zeit zu verlieren, schon gar nicht im Urlaub. Nach einer Stunde geht es auch für mich weiter. Ich frage einen jungen Kerl, der gerade mit seinem Auto ins Schloss fahren will, ob ich auf dieser Straße richtig bin. Er hat keine Ahnung, ist noch nie die Straße in die Richtung gefahren, in die ich vorhabe zu laufen. Ich soll kurz warten, er geht zu einem Seiteneingang hinein, kommt nach etwa zehn Minuten wieder. Er hat gefragt und die da drinnen meinen, dass ich schon ganz richtig bin. Eine Einladung des Schlossherrn zu einem Festschmaus bekomme ich nicht. Solang ich meine Kekse habe, ist das auch nicht weiter tragisch, wenngleich ich gegen ein großes Stück Fleisch nichts einzuwenden hätte.