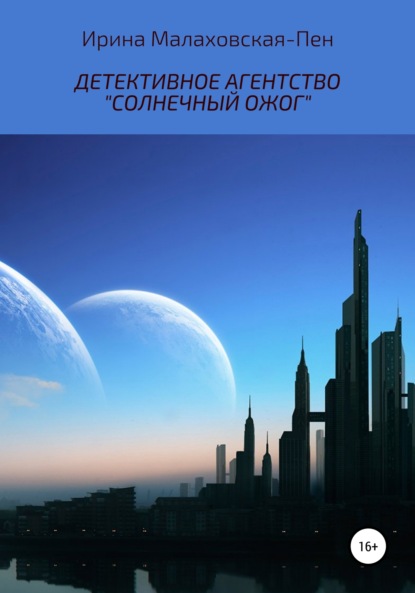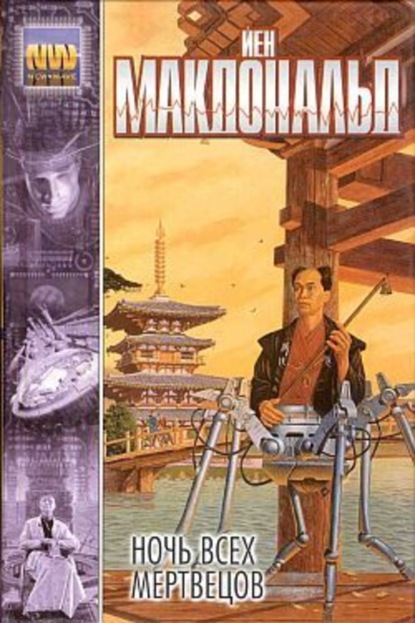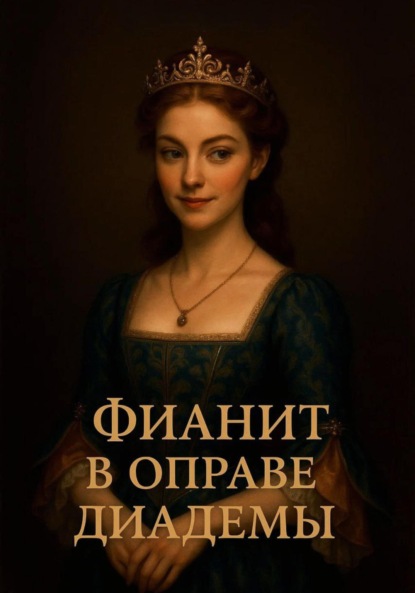- -
- 100%
- +
Na – und immer habe ich auch nicht bloß gezeichnet. Manchmal wurde es auch so spät über ein Buch: Dickens – – und Zola: Germinal, Nana, Fruchtbarkeit – und was ich sonst alles bekam.
Aber auch später, als ich nicht mehr in die Werkstatt ging, saß ich morgens oft bis vier auf, am Reißbrett mit dem Stift oder stand vor der Staffelei. Na ja – wenn man was schaffen will! – Und ich rühmte mich zu Gaul:
›Du, jetzt geht's schon bis um viere‹!«

8. Zille vor seiner Staffelei.
Hinter der Staffelei Senta Söneland.
Nach einer Photographie.
Über Zilles wirklich ernste und gewissenhafte Einstellung zur Kunst mögen seine folgenden Äußerungen unterrichten und aufklären:
»Es gab so viele, die sich vor eine Sache hinstellten oder hinsetzten und sie mühselig abmalten. Das Volk lässt sich das nicht immer gefallen. Und dann wechselt doch auch das Bild rasch. Auf der Straße – und auch sonst: Licht und Farbe.
Ich machte mir bloß Notizen. Und sagte: ›Das müßt ihr euch ins Auge klemmen – und denn zu Hause verarbeiten! ...‹
Wer das nicht kann, der kommt nicht zu einer fertigen Sache.«
*
»Wie das so ist: erst hat man keine richtige Kritik für seine eigenen Sachen. Und so machte ich denn die Körper immer zu lang und die Köpfe zu klein. Bis mir eines schönen Tages der Bildhauer Krauß sagte:
›Mensch, Ihre Figuren haben ja alle zuviel Kopflängen!‹ Und das stimmte!
Da sah ich mich vor. Und was kam nu!?
Als Hyan mal meine Zeichnungen sah, meinte er:
›Na, Ihre Puppen haben wohl alle eens uff'n Kopp gekriegt!‹
Und das stimmte auch!
Na – nun suchte ich eben das Richtige.«
*
»Liebermann fragte mich mal, warum ich keine Selbstbildnisse male.
Ich antwortete ihm:
›Wenn ich mich früh im Spiegel gesehen habe, wenn ich mich gekämmt habe, habe ich genug von meinem Gesicht!‹ –«
*
»Liebermann fragte mich auch mal: ›Vakoofen Sie? Sie müssen doch mächtig Jeld machen!!‹
›Nich wie Sie bei de Reichen‹, antwortete ich ihm. ›Ich verkoofe bloß an kleene Leute. Die können nich Dausende zahlen: Denen muss ick die Freude schon billiger machen!‹
›Zille, det is schön von Ihnen!‹
Ich schwieg ein Weilchen, überlegte und sagte: ›Ach, Herr Professor, die Leinwand und die Ölfarbe achte ich viel zu hoch. Und denn: es malen schon zu viel Leute in Öl. Ich kritzle lieber auf Papier!‹
›Na, denn kleben Se doch Ihre Zeichnungen uff Pappe und schmieren Lack drüber. Dann kriegen Se mehr Jeld vor!‹ riet mir der berühmte Maler.
›Ich bleibe aber lieber bei meinem Kritzeln!‹ schloss Zille.«
*
»Das ist alles nur mit Gewalt gemacht!« behauptet Zille von seinen Werken. »Nur mit Gewalt!
Weil ich es gewollt habe. Weil ich mich immerzu gezwungen, immerzu geübt habe! Weil ich jedes kleine Ding beobachtete und abzeichnete. Jeden alten Latschen. Jeden krumm getretenen Stiebel. Jede alte Gosse. Jede Küchenecke. Jeden Straßenwinkel.«2 Und wenn man ihm erwidert: Aber auch die Küchenecke, der Stiebel und die Gosse sind doch von Ihnen so gezeichnet, wie es eben nur ein Meister kann!
Dann sagt er, mit einem nach innen flimmernden Zwinkern seiner hellen Augen, halb bescheiden, halb ängstlich sich belauschend, wie wenn er sich vor einer geheimnisvollen Kraft in seinem Innern fürchte:
»Nee, nee – das ist mit Gewalt gemacht! ...
Das habe ich alles nur mit Gewalt erzielt. Nur mit Fleiß! Und immer wieder Gewalt!
Sonst schafft man das nicht!
Das ist nicht Begabung.
Das ist nur Wollen.
Ich wollte eben auch was für mich machen.
Ich wollte nicht immer in der Werkstatt bloß an einer Sache ein bisschen rum arbeiten. Wie etwa so'n Arbeiter, der bloß sein ganzes Leben lang Türklinken macht – vielleicht bloß die Gußnaht abkratzen – oder den Gusskopp abkneifen.
Nee –
Da fragten mich die Herren von der Photographischen Gesellschaft, warum ich denn jeden Morgen schon zeichne – so 'n bisschen nach der Natur – und abends auch noch oft bis in die Nacht. Das hätte ich doch nicht nötig. Ich hätte doch mein Brot.
Ja, ich wollte doch auch was für mich machen.
Was Ganzes wollte ich machen.
Ich wollte was machen, aus mir heraus.
So, wie ich die Welt und die Menschen sah.
Ich sah sie doch ganz anders, als die andern.
Und das musste ich eben machen ...«
*
»Alle möglichen und unmöglichen Kunstjünger – und solche, die sich dafür halten, schicken einem Proben oder rücken einem sogar selbst auf die Bude. Oder die lieben Eltern oder Onkels kommen und bringen Proben.
Ja, was soll man dazu sagen?
Soll man die Verantwortung auf sich laden, dass da wieder so 'n Kunstproletarier erzogen wird? Ich sage meist:
›Werdet Schofför; die leben wenigstens nicht lange – die haben aber Brot‹ ...
Weiß man, wie solch Mensch sich entwickelt?
Manch einer macht als Kind so viel Versprechungen – macht die schönsten Bilder. Überhaupt, wenn Vater selbst Künstler ist oder in der Familie allerlei Liebhaberei getrieben wird. Dazu kommt dann solche kindliche Ursprünglichkeit – und das Genie ist fertig.
›Unser Peter braucht doch kaum was zu lernen – ach, der braucht gar nicht mehr zu lernen. Sehen Sie nur, was der kann!‹

9. Die Jungfernbrücke im Schnee zeichnete Zille, nachdem er, nachts aus einer Kaschemme heimkehrend, sie im frischen Schnee gesehen. Er benutzte diese Skizze zu einem Rodelbild, und zu der Zeichnung, auf der die noch »immer frisch vom Lande« gekommene Dirne die Männer anspricht.–
Und es ist auch manchmal überraschend, was so'n Junge kann. Ja – und dann, wenn die Pubertät vorbei ist – dann soll er selber Charakter haben – und Fleiß – und Erfindung –
Und denn ist er ein hohles Ei. Ausgepustet ....
Nee – ich nehme die Verantwortung nicht auf mich.
Ich sage immer:
›Gehn Sie man auf die Hochschule und holen Sie sich da Bescheid. Die Leute da sind angestellt und werden dafür bezahlt‹ ...«
*
In seinen früheren Jahren ist Zille von manchen Geschäftsleuten rücksichtslos ausgebeutet worden. Seine Zeichnungen wurden, ohne dass er gefragt oder dafür bezahlt wurde, in Massen zum Nachdruck verkauft. Auch erschienen viele Abbildungen von ihm, zu deren Reproduktion er keine Genehmigung erteilt hatte, die von den Verlegern gegen seinen Willen veröffentlicht worden waren. Zuerst hat er wohl manches ruhig geschehen lassen: »Man verliert sonst seine Beziehungen.« Dann hat er gemeinsam mit Kollegen Nachdruckskontrolle geübt, seine Zeit im Dienste der Kollegen geopfert. Jetzt steht er auf dem Standpunkt, von dem er erzählt:
»Der Kunsthändler .... bot mir so recht niedliche Preise für meine Zeichnungen. Am liebsten hätte er den ganzen Schwung so auf Ramsch gekauft. Da sagte ich zu ihm:
›Gewiss doch – ich werde meine Zeichnungen pfundweise verkaufen!‹
Da merkte er denn, was los war und ging. –«
*
Selbstbewusst erzählt er, wie Liebermann immer für ihn eintrat, wie er ihn in die Akademie brachte (siehe Kapitel: »Wenn man berühmt ist«) und wie er auch bei andern Gelegenheiten Zilles Können anerkannte und bewertete: Ein großer Verlag stiftete einen Preis für den besten Illustrationszeichner. Selbstverständlich wollte er – schon um der Reklame wegen – seinen Hauszeichner ausgezeichnet sehen. Aber Liebermann, der neben andern als Schiedsrichter gebeten war, bestimmte Zille als Preisträger. Das gab dann einen langen Streit und Verhandlungen zwischen Liebermann und dem Verlag.
Schließlich einigten sie sich auf Zille und den Hauszeichner.
Der Verlag stiftete eben zwei Preise ....
*
Zu einer berühmten Sängerin sagte Zille nach Schluss des Konzertes:
»Wie glücklich sind Siel Wenn Ihre Arbeit vorbei is, denn is se wech . . . Unsa Dreck bleibt immer!«
*
Einen bekannten, modernen Maler, der alles nach dem Modell zeichnet und malt, belehrte Zille:
»Sie müssen das ins Auge klemm'n un denn nachher zu Hause ausschütten. Wenn Sie das nich können, denn is 'ne Photographie besser.«
Überhaupt steht Zille der jüngsten Kunst – sehr kritisch gegenüber. So sagte er öfter:
»Die soll'n man erst so'n Stiebel malen, wie'n der Anton (Werner) jemalt hat!«
Diese Äußerung ist bezeichnend für seine Kunstauffassung. Ihm ist kein Gegenstand zu geringwertig. Er muss nur künstlerisch durchgearbeitet sein.
Er bleibt dabei, dass »Kunst« von »Können« kommt.
*
Auch von andern Eindrücken sprach Zille, von solchen aus der Kunst früherer Zeit. Er ließ manchen gelten, der eine Zeitlang übersehen worden war. Sprach achtungsvoll von Paul Meyerheim, vergaß nie Hosemann und erläuterte mit der Eindringlichkeit des Schaffenden die Unterschiede zwischen dem Pessimismus von Wilhelm Busch und seiner eigenen, aufbegehrenden, auf Besserung dringenden Weltanschauung.
Und wenn er gefragt wurde, ob das Volk ihm denn für das liebevolle Hinweisen auf seine Leiden und Nöte gedankt habe, fragte er mutwillig:
»Soll es mir verhauen? ... Nee – dazu is't nich gekommen. Aber so'n bißken Liebe merkt man doch, wenn man sich ums Volk kümmert –«
*
Mit gutem Humor sieht er auf sein früheres Leben zurück und lacht über Erlebnisse und Angriffe mannigfacher Art:
»Meine erste eigene Wohnung war im Osten Berlins im Keller; nun sitze ich schon im Berliner Westen, vier Treppen hoch, bin also auch ›gestiegen‹. Einige Radierungen sind ins Kupferstichkabinett gelangt und eine Anzahl Zeichnungen und Skizzen in die Nationalgalerie. Jetzt, 1924, bin ich sogar Mitglied der Akademie geworden. Dazu schreibe ich das, was das völkische Blatt, der ›Fridericus‹ sagt: ›Der Berliner Abort- und Schwangerschaftszeichner Heinrich Zille ist zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt und als solcher vom Minister bestätigt worden. – Verhülle, o Muse, dein Haupt.«
Z.
*
Wenn er auch nicht mehr ganz so handelt, wie er im Motto seines Lebens und Schaffens angegeben hat – wenn er auch längst den Schluck in der Destille und das Kille-Kille abgeschworen hat: mit dem Ergebnis seiner frohen Arbeit kann er gewiß zufrieden sein.
Zwar zweifelt er manchmal und meint:
»Das kommt ja doch alles in den großen Müllkasten der Zeit!«

10. Verhülle, o Muse, dein Haupt!
Skizzenblatt, zum 1. Mal veröffentlicht.
Aber er hat auf seine Zeit gewirkt, hat beste Zeitkunst geschaffen, hat Augen und Herzen geöffnet. Und da er das mit wahrhaft klassischem Können und mit ernstestem Willen tat, wird er nicht im Müllkasten der Zeit verschwinden, sondern Zille, der Künstler unseres Volkes bleiben.
Zille in der Liebe des Volkes
Kein heutiger Künstler kann sich rühmen, so wie Zille vom Volke geliebt und gekannt zu sein. Das Volk hat, trotzdem er es in den humoristischen Zeichnungen für die Zeitschriften oft ein wenig komisch und von oben herab darstellen musste, immer seine große Liebe hindurch empfunden – und hat sie ihm auch reichlich vergolten. Er selbst konnte denn auch auf die Frage eines Schriftstellers erwidern:
»Ach ja – man merkt schon, dass man immer fürs Volk gearbeitet hat – so'n bißken Liebe merkt man schon. –«
Im weitesten und gemütvollsten Sinne des Wortes war Heinrich Zille eben ein Heimatskünstler. Nicht zum geringsten schmeichelte er sich in die Liebe des Volkes ein durch das Mitgefühl für die Kümmernisse und für die Freuden, das aus allen seinen Blättern sprach. Nicht zum wenigsten machte ihn beliebt die Darstellung der Berliner Kinder. (Siehe Kapitel: »Zille-Kinder« und die Kinderstudien im Abschnitt: »Studien und Akte«.) Wer Kinder so wie Zille ablauschen und durch seinen Zeichenstift festhalten kann, wird immer beim Volke die allerwärmste Gegenliebe erleben.
Er ging immer mit dem Zeichenstift in der Hand den Weg des Volkes. Nicht nur in die Kaschemmen und auf die Rummelplätze. Als um 1905 die sommerliche Auswanderung der Berliner in die Freibäder an den Spree- und Havelufern eine Wendung in der ganzen Lebensart der Hauptstädter brachte, ward Zille der Maler des Freibads. Aus einer Unzahl von Zeichnungen und Skizzen, in denen er die Lust der Berliner an Luft und Sonne betonte, sei hier wenigstens sein Blatt »Zurück zur Natur«, Bild 13, wiedergegeben. Auch in einigen andern Kapiteln (»Zille-Fräuleins« und »Zille-Witze«) sind mehrere Freibadbilder zu finden.
Heinrich Zille fand auch den richtigen Weg, dem Volk die großen Kriegserlebnisse mit Humor zu würzen.

11. Een kleener Berliner Dickkopp.
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Seine Bilderreihe »Vadding in Frankreich – Vadding im Osten« brachte fast zweihundert heitere Erlebnisse eines Landsturmmannes und seines Freundes »Korl« während des Weltkriegs. Nie kamen auf diesen Blättern blutige Ereignisse vor. Zille wusste sie stets zu umgehen und dem in allen Lebenslagen, selbst im Granattrichter noch aufleuchtenden Humor des Volkes gerecht zu werden.
Den schönsten Grund zur Liebe, mit der ihn das Volk umgibt, legte er aber durch die Schilderungen des Volkslebens und durch die Darstellung der Stadtgegenden und der Häuser und Winkel, in denen das Volk wohnte und wohnt. Er brachte naturgetreue Wiedergaben aus dem Scheunenviertel, aus dem baufälligen »Alt-Berlin«, aus Hinterhäusern und Höfen, wie sie in Neukölln wie am Wedding, in Moabit wie in Schöneberg, eben in allen Volksgegenden sich finden. (Siehe »Studien« und »Milljöh«.)
Er brachte gewissermaßen die Landschaft, in der das Volk lebt.
Das Volk fand sich und seine Umgebung durch die Arbeit eines überaus gutherzigen Künstlers auf den Blättern von Heinrich Zille wieder. Und das vergalt es dem Künstler.
Kaum eine Ausstellung wurde so besucht, wie die Zille-Ausstellung zu seinem siebzigsten Geburtstag im Märkischen Museum. Der Bau an der Waisenbrücke, sonst kaum beachtet, hatte seine großen Tage. Des gewaltigen Andranges wegen musste er oft geschlossen werden. Monatelang konnte man vor dem Eingang die Besucher in langen Schlangen anstehen finden – als gäbe es dort wichtige Lebensmittel. In vielen Familien sind Zeichnungen gesammelt oder wenigstens einzeln an die Wand genagelt worden. Und bei fast allen Gewerbetreibenden und in unzähligen Arbeiter- und Angestellten-Haushaltungen wird irgendein Zillebuch wie ein kleines Heiligtum aufbewahrt und von Zeit zu Zeit vorgeholt, um die Herzen zu erquicken und zu erfrischen.
Wie er selbst zum Volke steht, drückte er einmal in einer kurzen, sehr treffenden Zeitungsplauderei aus:
»Immer hab' ich mit den kleinen Leuten gelebt, mit denen ich aufgewachsen, die für mich die Großen waren: – Volk – die Armen. Die den Besitz und die Wohlhabenheit weniger müssen erhalten, vermehren und sich selbst mit Brosamen sollen abfinden. Ich versuchte mit Bild und Wort die Vergessenen zu bannen, so nach und nach kam ich in die Zeitungen, illustrierten Zeitschriften, in die Witzblätter und wurde so der ›Arme-Leute-Maler‹ – leider Witzblätter – es tut weh, wenn man den Ernst als Witz verkaufen muss.

12. »Det is mein Auto janz alleene!«
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Der Verschönerungsrat, der Barbier, der mich betreute, hielt viel Zeitschriften zur Unterhaltung seiner Kunden, aber auch zu seiner eigenen Belehrung. Er legte mir schmunzelnd immer die neuesten Journale mit Zille-Bildern vor und sagte: ›Großartig!‹ Er kannte mich aber nicht.
Ich fragte mal, wie sich das Publikum, seine Kunden, über die Bilder aussprechen. ›Großartig! Sie könn' jarnich erwarten, jeder will die Zeitung oder das neue Buch haben – aber es sin ooch Jegner dabei, die da sagen: Berlin würde dadurch beleidigt, verschandelt! Da hab' ick ihn' jesagt: ›Meine Herren – det verstehn Se wohl nicht – det is eben Zille sein Milljöh – und aus sein Milljöh kann er eben nich mehr raus!‹ –
Und ich sagte: ›Er will es auch nicht.‹«
Z.
*
Zur Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres wurde eine große Übersicht über seine Werke von der Stadt Berlin im Märkischen Museum veranstaltet. Große Eröffnungsfeier. Der Oberbürgermeister – Stadträte – Stadtväter – mancherlei wichtige Personen aus der Staats- und Stadtverwaltung.
Der Oberbürgermeister hält eine gründliche Rede auf Zille und sein Werk. Würdigt sein Wirken. Durch seine Arbeit sei das Berliner Volk in allen seinen Nöten und in seinem humorvollen Wesen erst so richtig in die Kunst eingeführt worden. Ihm sei es zu verdanken, wenn das Berliner Volk nun auch ebenbürtig sei in der großen Kunst. Durch sein Medium habe er es verklärt und habe auch seine scheinbaren Schattenseiten überwunden und auch die Elendesten dem Herzen der andern Schichten näher gebracht. Zille aber, der sich nicht wohl fühlte, dachte:
»Die Brust schmerzt, als wenn sie mich sprengen wollte.«
Und als auch der Direktor des Museums ihm bei anderer Gelegenheit Ähnliches sagte, da bedankte sich Heinrich Zille und wies mit einer Geste auf die Zeichnungen hin, auf denen das Berliner Volk in seiner ganzen ungeschminkten Art erscheint:
»Das gilt ja nur dem Volk. Sie wollen in mir nur das Volk streicheln. ...«
Die Feiern machte er vielleicht nicht ganz ungern mit. Aber bei allem Wohlgefühl, das er über seine Popularität empfand, war es ihm oft im Kreise der ihn umringenden Gratulanten und Standespersonen höchst ungemütlich. Ja, bei der öffentlichen Feier seines Geburtstages, inmitten von mehr als hundert hohen Beamten und andern Prominenten, plagte ihn sein Alter und sein Altersleiden, die Zuckerkrankheit. Und bei den langen Reden dachte er: Wenn's doch zu Ende wäre!

13. Zurück zur Natur.
Aus: »Rund ums Freibad«, Verlag Dr. Selle-Eysler A.-G. Bilder aus den Freibädern.
*
Am schlimmsten wurde Zille von seinen Verehrern bedrängt, als er durch die Feier seines siebzigsten Geburtstags in der Öffentlichkeit, in allen Zeitungen, in vielen Reden und bei allen möglichen Gelegenheiten genannt wurde. Er nahm alle die ihm überreich gespendeten Gaben gern an. Sein langer Arbeitstisch war mit Feinkostkörben und Blumentöpfen und Sträußen gefüllt. Nur über die Blumen war er nicht ganz begeistert. Am wenigsten über die weißen, großblumigen Chrysanthemen, von denen ihm mehrere gebracht worden waren. Er sah sie über seine Brillengläser hinweglugend an und meinte leise abwehrend:
»Die haben was Totes an sich, wie weißes Papier. Ohne Farbe ... Das ist ja, wie wenn sie mich schon beerdigen wollen!«
*
Und eine junge Dame, die gar zu gern doch ein Zille-Autogramm haben wollte und mit einem großen eingehüllten Blumentopf sich durch die Tür hineingezwängt hatte in Zilles Arbeitszimmer, reichte schüchtern und wortlos dem Meister ihren Blumentopfgruß hin, den er schon mit stillem Grausen in die Hände nahm:
Richtig – wieder eine weiße Chrysantheme!
Er stellte sie zu den übrigen – sah mit gerunzelter Stirn zu der angstvoll Harrenden hin – und ging dann doch auf sie zu, ihre Hand zwischen seine Hände nehmend:
»Na – Kindchen – Sie wollen gewiß auch meine Unterschrift haben? ... Und schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ...«
*
Aber er erlebte nicht nur die Schattenseiten des Berühmtseins. Er weiß auch von den heiteren Erlebnissen zu berichten, die ihm begegneten:
»Einmal habe ich mich doch gefreut. Da kam es raus, wie bekannt ich bin. Ich bekam eine Postkarte, auf der nichts als ein Kahn3 auf der Adressenseite gezeichnet war.

14. Vadding in Frankreich. Weihnacht 1914.
»Wenn ick man blot wüßt, wat ›Stille Nacht, heilige Nacht‹ uf französisch heet! Ick möcht de Lütt mal een dütsches Wihnachtslied vorsingen.«
Ulk 1914.
*
Der Postbote gab sie mir:
›Det können Sie doch bloß sein!‹
*
»Neulich musste ich mir'n Auto nehmen, um nach Hause zu fahren. Und als ich nun meine Straße und Hausnummer sagte, nickte der Schofför und sah mir so komisch prüfend an, dass mir ordentlich bange wurde.
Und als wir dann durch den Tiergarten kamen, da stoppte er'n bißchen.
Nanu, denke ich, was soll das werden?
Da dreht er sich um und fragt lächelnd:
›Sie sind doch Zille, der Maler Zille?‹
Ich musste nun ›Ja‹ sagen.
›Na, ick habe Sie doch jleich erkannt – nach den Bildern in der Zeitung. Haben Sie't eilig?‹
›Das gerade nicht‹, antwortete ich. ›Aber ich muss fahren, weil meine Beine mich nicht mehr so weit tragen.‹
›Woll'n Sie nich noch'n bißken spazieren fahren? Ick stelle de Uhr ab. Sie kommen doch jewiß nich mehr ville an de frische Luft! .. Un for Zille'n hab' ick immer'n bißken Zeit!‹
Und er fuhr mich raus bis Spandau und dann wieder nach Hause – So richtig durch die schöne Luft ...«
*
»Ein anderer Schofför hatte mich auch mal nach Hause gefahren. Als ich nach der Taxe sah, war die Uhr nicht eingestellt.
Ich fragte: ›Ja, was habe ich Ihnen denn für die Fahrt zu zahlen?‹
›Nischt. Herr Zille, nischt!‹ sagte er lächelnd.
›Was denn?‹
›Na – Sie sind doch Meester Zille! Ick habe doch zu Hause alle Bücher von Ihnen. Und da müssen Sie mir schon mal das Vergnügen machen ...‹
Was sollte ich tun? Ich konnte ihm nur die Hand schütteln.«
*
»Als die Vorwahlen zur Wahl des ersten deutschen Reichspräsidenten waren (und die Wahl fiel auf Fritz Ebert), saß ich mit am Wahltisch, in einer kleinen Kneipe, als Beisitzer. Gegen 11 Uhr Vormittag kam ein vergnügtes Volk, Masken vom Maskenball – hatten aber keine Ausweise und wurden durch die Verkleidung auch nicht erkannt. ›Na, aber Herr Direktor,‹ sagten die Mädels, ›wir sind doch alles Zillekinder!‹«
*
Sehr hübsche Erlebnisse erzählt Zille von Aufwärterinnen und anderen weiblichen Wesen, die seine Kunst verehrten:

15. Vadding in Frankreich. Vierzehn Tage Urlaub.
»Du Korl, ick glöw, de Unnerstand von dien Patenkind is naß!«
Ulk 1915.
»Eine Aufwärterin fragte mich, ob ich denn nun wirklich Professor sei?
›Nee,‹ sagte ich, ›das gibt's doch jetzt nicht mehr in der Republik, dass einer einen Titel kriegt, der nicht auch das Amt ausübt. Ich lehre doch nicht. Also kann ich doch auch nicht Professor sein.
Ja früher, da kriegte jeder Steißtrommler, jeder Gymnasiallehrer den Professor!‹
›Aber in de Akademie sind Se doch, Herr Zille! Det weeß ick doch. Een Schwager von mir is doch ooch da! Der freut sich immer so über Ihre Bilder!‹
Ich sah sie erstaunt an: ›Kennt er sie denn?‹
»Ja, er kennt sie alle.‹
›Ein Schwager von Ihnen? Wer ist denn das? Was ist er denn? Ist er Dichter?‹
›Nee‹ –
›Macht er laut? (d. h. ist er Musiker?)‹
›Na – er is doch Heizer in de Akademie!‹«
*
»Da habe ich in dem Zimmer nebenan ganze Packen Studien-Blätter und Mappen. Die wollte ich eigentlich mal alle in den Ofen schieben. Was soll der ganze Kram in der Welt, wenn ich nicht mehr bin? ... Das hörte auch meine Aufwartefrau und bat: