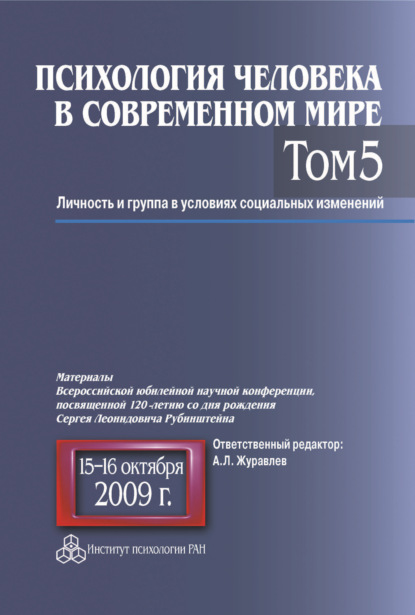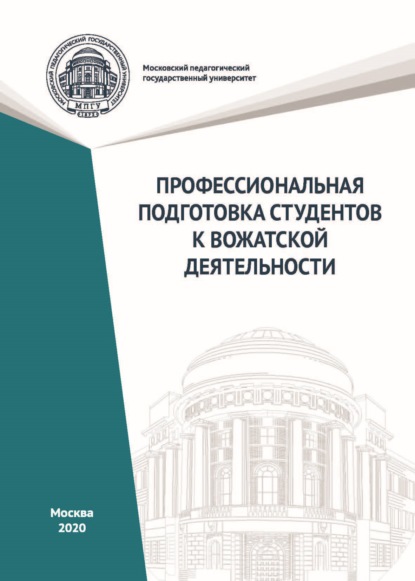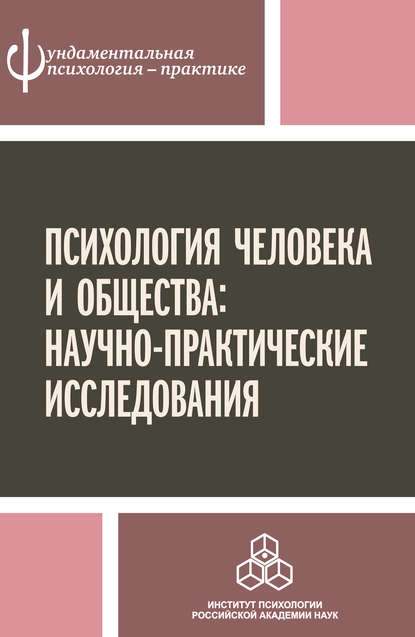Seewölfe Paket 15

- -
- 100%
- +
„Ja! Alles in bester Ordnung! Wir mimen also weiterhin die braven englischen Kauffahrer?“
„Jetzt gerade! Alles Weitere hängt von unserem Geschick ab!“
„Meinst du, die Schnapphähne treiben sich bei diesem Wetter vor der Küste herum?“
„Das nicht, aber bestimmt haben sie ihre Spitzel und Posten überall sitzen!“ rief der Seewolf. „Wir suchen jedenfalls Schutz vor dem erst richtig heraufziehenden Sturm und verholen in eine Bucht. Denk daran: Wir bangen um unsere Ladung und verlieren lieber Zeit, als daß wir unter diesen schlechten Bedingungen den Kanal überqueren!“
Ben grinste und schrie: „Wohin sind wir denn unterwegs, falls mich mal jemand fragt?“
„Wir waren in Afrika und bringen unsere Fracht nach Plymouth!“
„Edelhölzer oder Sklaven?“
„Wie?“
„Ich frage, was wir geladen haben?“
„Katzengold und Dünnbier!“ brüllte Hasard ihm ins Ohr, und sie lachten beide.
Hartnäckig wie schwerfällige Riesentiere boxten sich die beiden Dreimaster direkt auf die Küste zu. Die Gefahr, auf Klippen oder Untiefen gedrückt zu werden, bestand kaum, da ablandiger Wind herrschte. Hasard ging mit der „Hornet“ als erster so dicht wie möglich unter Land und ließ nach einer geeigneten Bucht Ausschau halten.
Wenig später erhielt er von Dan den entsprechenden Hinweis: „Bucht Steuerbord voraus! Höchstens eine halbe Meile entfernt!“
„Verstanden!“ schrie der Seewolf zum Vormars hoch, dann gab er den Befehl, den nur schwach zu erkennenden Einschnitt zwischen den Uferfelsen, der die Einfahrt darstellte, anzusteuern.
Terry brauchte kein entsprechendes Signal zu empfangen, er ging sofort auf das Manöver der „Hornet“ ein und folgte ihr in ihrem Kielwasser. So liefen beide Schiffe kurze Zeit später in die von Dan entdeckte Bucht ein, die geräumig genug war, um ihnen genug Platz zum Manövrieren zu lassen.
Der Köder war ausgelegt, der Gegner brauchte nur noch anzubeißen.
8.
Wie vorauszusehen gewesen war, nahmen Windstärke und Seegang noch zu. Bald tobte vor der Einfahrt der Bucht der heftigste Sturm, und der Seewolf und Easten Terry wurden somit mehr und mehr ihrer Rolle gerecht. In der Tat hätte nur ein Verrückter bei diesem Wetter die Überfahrt nach England gewagt, nicht aber zwei vorsichtige, auf die Sicherheit ihrer Mannschaft, ihres Schiffes und ihrer Ladung bedachte Kapitäne, die im Auftrag von Handelsgesellschaften die Meere befuhren.
In der Bucht war das Wasser zwar auch bewegt, doch das Schlingern und Stampfen der mittlerweile vor Anker liegenden Schiffe hielt sich in Grenzen. Hasard überprüfte die „Hornet“ auf etwaige Schäden oder Lecks, konnte aber nichts dergleichen finden. Bislang hatte die Galeone allen Erfordernissen entsprochen.
Bald würde sich vielleicht zeigen, was sie als Kriegsschiff taugte.
Auch die „Fidelity“ hatte bei der kurzen Fahrt durch den Kanal keinerlei Schaden genommen, Terry ließ eine entsprechende Nachricht zu Hasard hinübersignalisieren.
Sowohl der Seewolf und seine Crew als auch Terry und dessen Mannschaft waren inzwischen ausreichend mit ihren Schiffen vertraut. „Hornet“ und „Fidelity“ – „Hornisse“ und „Treue“ schienen wirklich die passenden Namen für diese soliden und dennoch wendigen Segler zu sein, die mit allen Finessen der Schiffsbaukunst ausgerüstet worden waren.
Sie waren beide erst zwei Jahre alt und etwa von der Qualität und Beschaffenheit wie die „Isabella VIII.“, die im Kanal der Pharaonen ihr unrühmliches Ende gefunden hatte.
An den Siebzehnpfündern und Drehbassen ließ sich auch kein Makel entdecken, im Gegenteil, Al Conroy als der Waffenexperte der Seewölfe war begeistert von diesen Stücken.
Während seines Rundganges warf Hasard auch einen Blick ins Vorschiff und fragte den Kutscher und Mac Pellew, die eben wieder die Feuer unter den Kesseln anheizten: „Habt ihr eine Ahnung, wo Ferris steckt?“
„Aye, Sir“, antwortete der Kutscher. „Er sitzt nebenan und bastelt.“
Hasard verließ die Kombüse und trat zu Ferris, der in einem Raum neben dem Logis mit leeren Flaschen und Schwarzpulver hantierte. Eben war er dabei, gehacktes Blei und Glas in eine Flasche zu füllen.
Der Seewolf lachte. „Höllenflaschen? Ausgezeichnet, Ferris, die können wir vielleicht schon bald sehr gut gebrauchen.“
„Das hab ich mir auch gedacht“, meinte der rothaarige Riese grinsend. „Man weiß ja nie, zu was die Dinger gut sind, oder?“
Auch Dan O’Flynn, der mit Hasards Genehmigung den Vormars verlassen hatte, betätigte sich als Handwerker und fertigte aus der abgesägten Spitze einer Pike, an der er eifrig herumfeilte, eine haarnadelspitze Nahkampfwaffe an.
So hatte jeder seine Beschäftigung und Aufgabe und vertrieb sich auf diese Weise die Wartezeit. Würde der Gegner sich zeigen, oder war Hasards Handeln sinnlos? War man überhaupt auf sie aufmerksam geworden? Die Küste ringsum, so schien es jedenfalls, war menschenleer und abweisend, niemand schien sich in ihrer Nähe aufzuhalten.
Doch dieser Eindruck konnte gewaltig täuschen. Hasard ließ sich in dem Punkt nicht beirren, er hatte beim Ankern vor fremden Küsten schon die erstaunlichsten Überraschungen erlebt.
Ein hochbeiniger Falbe lief mit flatternder Mähne durch die windgepeitschte Morgenluft, sein Reiter hielt sich dicht über seinen Hals gebeugt. Ein langgestrecktes, geducktes Gebäude aus Stein, das nur hundert Yards vom Ufer des Atlantiks entfernt nahe der Ortschaft Lannion stand, war sein Ziel. Ehe er dort eintraf, öffnete der Himmel seine Schleusen und ließ einen Regenguß auf ihn niederprasseln, der ihn bis auf die Haut durchnäßte.
Der Mann trieb den Falben unter das weit überhängende Dach des Gemäuers, saß ab und band die Zügel fluchend an einem eisernen Ring fest. Er nieste zweimal heftig, dann betrat er das Haus durch die Bohlentür, die in ihren angerosteten Angeln quietschte.
Sofort wurde er von einem kleinen, mageren Mann in Empfang genommen, der ihm ein Messer an die Gurgel hielt.
„Keinen Schritt weiter, Freundchen“, zischte der Kleine. „Oder du bist ein toter Mann.“
„Nur keine Aufregung, Ferret“, sagte der Reiter heiser. „Ich bin’s, Vangard. Erkennst du mich nicht?“
Ferret ließ das Messer sinken. „Weißt du was? Du bist ein pfiffiges Kerlchen, Vangard, aber um ein Haar wärest du drangewesen. Hast du die Losung vergessen?“
„Oh, tut mir leid. Herbstrose – das ist doch das richtige Wort, oder?“
„Das solltest du wissen“, ertönte eine dunkle Stimme aus dem Halbdunkel des Raumes. „Eine solche Unachtsamkeit könnte dich bei nächster Gelegenheit das Leben kosten. Wieso platzt du hier so einfach herein?“
Vangard, ein derber, untersetzter Mann mit grobem Gesicht, trat auf den klobigen Tisch in der Mitte des Raumes zu. Erst jetzt erblickte er die Gestalten, die sich darum versammelt hatten.
„Ich bringe Neuigkeiten, Grammont“, erklärte er. „Neuigkeiten, die dich interessieren werden. Sonst hätte ich mich nicht durchregnen lassen, sondern wäre in meiner Hütte geblieben.“
„Schürt das Feuer“, befahl Grammont seinen Männern. „Los, Vangard, setz dich zu uns, wir wollen dich bewirten, wie es sich gehört. Hast du Schiffe gesichtet?“
„Ja.“ Vangard nahm zwischen zwei Männern Platz. Der eine trug drei Pistolen im Gurt, der andere hatte einen buschigen Schnauzbart. Sie hießen Jean Bauduc und Pierre Servan, soviel wußte Vangard, aber sonst war ihm nicht viel über diese beiden bekannt.
Der Mann, der sich jetzt erhob und an den Kamin trat, um für Feuer zu sorgen, hieß Jules Arzot. Ein dicker Mensch mit einem mächtigen Bauch und einem wulstigen Hals, kugelrundem Kopf und hervorspringenden Augen. Eigentlich wirkte er eher wie eine Witzfigur, doch Vangard war sicher, daß man auch ihn nicht unterschätzen durfte.
Yves Grammont jedoch, der Anführer dieser Bande von Galgenstricken, war mit Abstand die auffallendste Persönlichkeit von allen. Ein Pirat, wie man ihn sich vorstellte. Groß und wuchtig gebaut, vollbärtig, mit einer Augenbinde und einem Kopftuch, ein Kerl, der einen das Fürchten lehrte. Sein weißes Hemd stand weit offen, buschiges Brusthaar quoll daraus hervor. Er entblößte seine weißen Zähne und grinste Vangard an.
„Nun?“ fragte er. „Willst du ein Glas Wein mit uns trinken?“
„Gern“, erwiderte Vangard, dann hustete er. „Verfluchtes Wetter. Dort draußen holt man sich noch den Tod.“
Grammont grinste breiter. „Wärme dich und sieh zu, daß du trocken wirst. Ich bin besorgt um dich, mein Freund, denn schließlich brauchen wir dich noch.“
Arzot richtete sich von dem Kamin auf, die Flammen flackerten hoch auf und trieben Hitze in den Raum. Gespenstisch tanzte der rötliche Lichtschein über die Gesichter und Gestalten der um den Tisch versammelten Männer. Vangard trank den Wein, den Grammont ihm einschenkte. Er beobachtete die Männer über den Rand seines Bechers und dachte: Die möchte ich nicht zu Feinden haben.
Yves Grammont hatte den Engländern vor knapp einem Jahr einen erbitterten Kleinkrieg zu liefern begonnen. Seitdem hatte er bestimmt mehr als zwanzig ihrer Schiffe versenkt und sicherlich auch viel erbeutet. Warum aber nur die Engländer? Vangard vermochte es nicht zu sagen. Was immer die näheren Beweggründe für Grammonts Zielsetzung waren, er hatte nie danach gefragt. Wer zuviel fragte, lebte gefährlich.
Vangard war nur einer von den vielen Kundschaftern, die Grammont längs der Küste der Bretagne beschäftigte. Er bezahlte für Informationen sehr gut, aber er verlangte absolutes Stillschweigen. Wer diese Regel brach, mußte mit einer Bestrafung rechnen, oder, mit anderen Worten, er verschwand eines Tages und wurde nie mehr gesehen.
Ein Mann wie Vangard hütete sich, Grammont in irgendeiner Weise zu hintergehen. Die Piraten an die Bourbonen verraten? Die Engländer warnen? Nein, für Vangard war das nichts. Er wollte leben und weiterhin mit seiner schäbigen Schaluppe zum Fischfang vor Sillon de Talbert auslaufen, wenn er davon auch mehr schlecht als recht lebte.
Das, was Grammont ihm zahlte, genügte ihm, um sein Dasein ein wenig angenehmer zu gestalten. Außerdem genoß er das Wohlwollen dieser Schnapphähne und Galgenstricke, sie würden ihm nie etwas antun. Was wollte er mehr?
Grammont, so hatte es sich unter den Informanten rasch herumgesprochen, hielt sich seit dem vergangenen Abend in dem alten Steinhaus bei Lannion auf, von dem es offiziell hieß, daß es seit zwei oder drei Jahren leerstehe. Wegen des zunehmend schlechten Wetters hatte der Piratenführer es vorgezogen, mit seinem kleinen Schiffsverband in einer Bucht zu ankern und das Ausweichversteck aufzusuchen, bis sich der Sturm ausgetobt hatte.
Vangard hatte mitgeholfen, das alte Haus etwas wohnlich zu gestalten und mit den erforderlichen Vorräten zu versehen, die die Bande brauchte, wenn sie hier einmal nächtigte oder gezwungen war, sich zu verkriechen. Vangard wußte im übrigen von seinen Freunden im Umland von Lannion und Sillon de Talbert, daß Grammont noch mehr kleine Schlupfwinkel entlang der gesamten bretonischen Küste unterhielt, um immer so beweglich wie möglich zu sein und nie Mangel an Nahrung, Trinkwasser und Munition für seine Geschütze zu haben.
Hinzu gesellte sich das erprobte, gut funktionierende Nachrichtensystem, das mit zu den Erfolgen beigetragen hatte, die Grammont während dieser vergangenen Monate zu verzeichnen gehabt hatte.
Kein englisches Schiff, das sich der Küste näherte, konnte der Aufmerksamkeit der Kundschafter entgehen – auch bei Schlechtwetter nicht, wo alle anderen Fischer, Deichbauern, Schafhirten und Strauchritter es doch sonst vorzogen, irgendwo unterzuschlüpfen und die Nase lieber nicht in Wind und Regen zu halten.
Vangard trank seinen Becher Wein leer, Grammont schenkte nach.
„Rede jetzt“, sagte er dann. „Wie viele Schiffe hast du gesehen?“
„Zwei. Englische Kauffahrer.“
„Wie kannst du wissen, daß es Kauffahrer sind?“ erkundigte sich der Anführer der Piraten mißtrauisch.
„Ich habe mich ganz dicht an das Ufer der Bucht rangeschlichen“, erläuterte Vangard so ruhig wie möglich. „Es gibt dort genug Buschwerk, keiner hat mich entdeckt.“
„Welche Bucht ist es?“
„Diejenige, die zwei Meilen westlich von Sillon de Talbert liegt. Zum Ankern ist sie ideal, die Kapitäne dieser zwei Dreimast-Galeonen haben unerhörtes Glück gehabt, daß sie sie gefunden haben.“
„Weiter“, drängte Grammont.
„Das Licht war ausreichend, ich habe genug erkannt“, fuhr Vangard, nun eifriger, fort. „Es sind schöne und ziemlich neue Schiffe, aber sie haben kaum Waffen an Bord. Ich habe keine Stückpforten gesehen.“
„Die Geschütze könnten auf den Hauptdecks stehen.“
„Das ist möglich, aber sehr viele sind es bestimmt nicht.“
„Bist du sicher, Vangard?“
„Ich teile dir das mit, was ich beobachtet habe.“
Grammont trank selbst seinen Becher leer, setzte ihn mit einem Knall auf der Tischplatte ab und wischte sich mit der Hand über den Mund. Sein Grinsen war verschwunden. „Hoffen wir, daß du deine Augen weit genug aufgesperrt hast. Wie groß sind diese Prachtkähne?“
„Jeder etwa dreihundert Tonnen, schätze ich.“
„Was haben sie deiner Meinung nach geladen?“
„Das weiß ich nicht“, erwiderte Vangard. „Ich kann nur Vermutungen anstellen, aber die helfen dir auch nicht weiter, Grammont.“
„Richtig. Jetzt zu den Mannschaften.“
„Etwa zwanzig Mann pro Schiff. Nicht mehr, bestimmt nicht. An Bord der einen Galeone habe ich einen Schwarzen gesehen, vielleicht kommen sie ja aus Afrika.“
„Möglich, oder aber er gehört zu der Crew“, brummte Grammont. „Hast du die Namen der Schiffe gelesen?“
„Nur den einen. Der Segler, der dem Ufer am nächsten liegt, heißt ‚Hornet‘.“
„Was bedeutet das, Grammont?“ wollte Ferret wissen.
„Hornisse.“
Die Kerle lachten, doch Yves Grammont lachte nicht mit. Er sah Vangard an und sagte: „Diesen Namen habe ich noch nie gehört, und der Kahn ist mir noch nirgends vor die Rohre gesegelt.“
„Ich sagte doch, beide Galeonen sehen sehr neu aus. Es ist bestimmt nicht lange her, daß sie vom Stapel gelaufen sind.“
Nachdenklich fuhr sich Grammont mit der Hand über den Vollbart. „Es wird doch wohl keine Falle sein, Vangard? Hast du keine anderen Schiffe entdeckt?“
Vangard bemühte sich, seiner Stimme einen eindringlichen, überzeugenden Klang zu verleihen. „Ich habe mich an deine Ratschläge gehalten und die Umgebung abgeforscht, ehe ich hergeritten bin. Es gibt keine anderen Schiffe.“
„Auf was warten wir dann noch?“ fragte Jean Bauduc. Er war der Kapitän der „Petite Fleur“, die wie die „Antoine“ und die „Coquille“ zu dem Verband der Piratenschiffe gehörte, der von der Galeone „Louise“ geführt wurde. Bauduc war groß und schwarzhaarig und hatte ein glattes Gesicht mit dunklen Augen, das von einem typisch südländischen Teint geprägt war. Sein Bauchansatz zeugte von den großen Mengen Wein und Bier, die er zu trinken pflegte. Sein äußeres Kennzeichen war der riesige Waffengurt, den er quer über der Brust trug und in dem drei Pistolen steckten.
Vangard blickte sich im Raum um. Die Kerle grinsten alle nur, keiner antwortete, daher wandte er sich Bauduc zu und sagte: „Auf besseres Wetter, denke ich doch. Oder?“
„Nein“, sagte Yves Grammont. „Wir laufen sofort aus.“
„Bei diesem Sturm?“ Vangard war verblüfft, das hatte er denn nun doch nicht erwartet.
„Bei diesem Sturm“, bestätigte Grammont. „Hör zu, Vangard, unsere Schiffe sind nicht so wacklig und baufällig wie deine verfluchte Schaluppe, sie halten sich etwas besser über Wasser.“
Wieder lachten die Piraten, und diesmal stimmte Grammont laut mit ein. Als er sich genügend über seinen Witz amüsiert hatte, beugte er sich vor und fragte: „Was Verlangst du für diesen Hinweis, Vangard?“
„Das übliche. Ist das zuviel?“
„Das weißt du selber besser als ich. Wenn es dir zuviel erscheint, gebe ich dir weniger. Ein Mann muß genau wissen, was seine Worte wert sind.“
Vangard nahm hastig wieder einen Schluck Wein. Zur Hölle, wollte Grammont ihn dieses Mal hereinlegen? Was sollten diese Anspielungen?
Grammont griff unters Hemd und förderte einen prall gefüllten Lederbeutel zutage. Er öffnete ihn, entnahm ihm zwei Golddukaten und legte sie vor Vangard auf den Tisch.
„Da, nimm hin“, sagte er barsch. „Du hast sie dir verdient, und du wirst noch mehr davon einsacken, wenn du weiterhin so aufmerksam die Küste und die Buchten beobachtest. Es verirren sich nicht selten Schiffe hierher. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es jetzt schon das dritte Mal, daß du uns einen brauchbaren Hinweis lieferst.“
„Ja.“ Vangard steckte die Münzen weg, aber es gelang ihm kaum, den Blick von dem Lederbeutel zu nehmen. Wie viele Gold- und Silbermünzen mochte Grammont wohl schon bei seinen Beutezügen an sich gebracht haben? Wo versteckte er seine Schätze?
Es war besser, nicht weiter darüber nachzudenken. Das, was Grammont ihm zahlte, mußte ihm genügen. Selbst wenn er herausgefunden hätte, wo die Schätze der Bande lagen, wäre es glatter Selbstmord gewesen, sie zu vereinnahmen. Allein der Versuch war tödlich.
Doch hätte es sich nicht eher gelohnt, spanische Silberschiffe zu überfallen, die aus der Neuen Welt herübersegelten, ihr Heimatland anliefen und dabei durch die Biskaya mußten? Wäre das nicht viel gewinnbringender gewesen?
Nun, Grammont mußte ja wissen, was er tat. Er hatte sich auf englische Schiffe „spezialisiert“, und das hatte bestimmt seine guten Gründe. Ein Armenhaus war England auch nicht mehr. Vielleicht hatten die Schiffe, die er versenkt hatte, Gold, Silber, Diamanten und Elfenbein an Bord gehabt. Und die Waffen? Auch die konnte man in klingende Münzen verwandeln.
Vangard konnte ja nicht ahnen, daß die Unternehmungen von Yves Grammont aus der Kasse spanischer Spione finanziert wurden.
Yves Grammont erhob sich und schob seinen Becher von sich fort. „Dein Auftrag ist hier zu Ende, Vangard, kehre jetzt von mir aus zu deiner Hütte zurück. Keiner wird dich dort behelligen. Den Weg zur Bucht kennen wir ja, wir brauchen dich nicht mehr.“
„Gut, Grammont. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.“
„Ja, das hoffe ich auch.“
„Adieu, Vangard“, sagte Pierre Servan lächelnd. Er war der Kapitän der „Antoine“ – groß, grauhaarig, schnauzbärtig und selten barhäuptig. Auch jetzt trug er seinen breitkrempigen Hut. „Oder soll ich lieber auf Wiedersehen sagen?“ fragte er.
„Auf Wiedersehen, das ist mir lieber“, erwiderte Vangard grinsend. Dabei schob er die Hand in die Hosentasche und klimperte mit den Dukaten. Dann wandte er sich ab, verließ das Steinhaus, kletterte im Schutze des Daches in den Sattel des Falben und ritt davon.
9.
Der Hufschlag war noch nicht verklungen, da verließen die Piraten das Haus bereits durch die andere Tür, die sich zur See hin öffnete. Grammont trieb seine Männer zur Eile an. Arzot hatte das Feuer im Kamin löschen müssen, Ferret hatte rasch die Waffen zusammengesammelt, die in einer Ecke des Raumes gelehnt hatten, Musketen und Tromblons, die er jetzt im Dahinschreiten verteilte.
Diese „Hornet“ und die zweite Galeone, die in der Bucht von Sillon de Talbert ankerten und fast auf sie zu warten schienen, waren für Yves Grammont und seine Kerle ein gefundenes Fressen. Für jedes Schiff, das er versenkte, kassierte der bärtige Anführer eine erkleckliche Summe Geld, egal, ob dieses Schiff nun Reichtümer an Bord hatte oder nicht.
Die Waffen, die er seinen Prisen außerdem zu entnehmen pflegte, ließen sich hervorragend verkaufen. Er hatte seine festen Abnehmer dafür: Sie gingen durch die Hände der Spanier und wurden von diesen nach Rennes verkauft, an die Bourbonen. Somit unterstützte man nach Kräften Heinrich von Bourbon, der demnächst der neue König werden sollte, wenn alles nach Plan verlief.
Nur etwa fünfhundert Yards weit brauchten die Piraten zu laufen, dann hatten sie die Bucht erreicht, in der ihre Schiffe vor Anker lagen. Sie hatten Glück, es regnete im Augenblick nicht mehr, ihre Waffen wurden nicht naß. Trocken brachten sie sie an Bord der Schiffe und verstauten sie hier sofort in den Lasten, so daß sie jederzeit einsatzfähig waren.
Grammont hatte als erster eins der bereitliegenden Beiboote geentert. Jetzt ließ er sich von seinen Männern zu seinem Flaggschiff, der Dreimast-Galeone „Louise“ bringen.
Auch die anderen Kerle machten ihre Boote flott, stiegen hinein und pullten zu den anderen Schiffen – zur „Petite Fleur“, der zweiten Galeone des Verbandes, und zu den beiden Karavellen „Antoine“ und „Coquille“. Sie wurden von den Ankerwachen erwartet und begrüßt, die Jakobsleitern waren bereits ausgebracht. Sie brauchten nur erstiegen und eingeholt zu werden.
Grammont suchte unverzüglich das Achterdeck der „Louise“ auf, gab die erforderlichen Befehle und sah dann seinen Leuten zu – Arzot, Ferret und den anderen –, die sich hastig auf ihre Posten begaben, das Gangspill zu drehen begannen und die Segel aus dem Gei lösten.
Auf den drei anderen Schiffen wurden die gleichen Vorkehrungen getroffen, und bald darauf lagen alle vier Schiffe zum Auslaufen bereit. Knatternd bauschte sich ihr Zeug vor dem rauhen, vom öden Küstenland herüberpfeifenden Südwind.
Die „Louise“ setzte sich an die Spitze und geleitete ihr Gefolge aus der Einfahrt auf die offene See hinaus, wo sie die schwarzen, schäumenden Wogen empfingen. Der Tanz begann, die Schiffe stiegen die Wellen hoch und tauchten in Täler hinunter, als wollten sie darin untergehen, und oft holten sie so weit nach Backbord über, daß sie querzuschlagen drohten.
Doch sie hielten sich in der schweren See und gingen mit schneller, rauschender Fahrt auf Ostkurs, in Richtung Sillon de Talbert.
Die „Louise“ war etwas mehr als zweihundertfünfzig Tonnen groß und mit vierzehn Kanonen des 17-Pfünder-Kalibers bestückt. Die „Petite Fleur“, ebenfalls ein Dreimaster, war um ungefähr fünfzig Tonnen kleiner als Grammonts Schiff und verfügte nur über zwölf Geschütze.
Die „Antoine“ und die „Coquille“ waren lateinergetakelte Zweimaster mit je acht Kanonen.
Pierre Servan hatte wie üblich das Kommando über die „Antoine“ übernommen, Jean Bauduc führte die „Petite Fleur“. Der Kapitän der „Coquille“ war ein Mann namens Saint-Jacques. Dieser Saint-Jacques war einer der härtesten und unberechenbarsten Kerle aus Grammonts Meute. Seine Physiognomie war geprägt durch eine große, leicht gekrümmte Nase, tiefliegende Augen und einen verkniffenen Mund. Er hatte lichtes brünettes Haar und einen Bartansatz, der Vergleiche mit einem Stoppelacker zuließ.
Jedes Schiff war mit über einem Dutzend Piraten bemannt, so daß sich eine Übermacht von fünfzig und mehr Kerlen der Ankerbucht der „Hornet“ und der „Fidelity“ näherte. Zwar hatten sie mit insgesamt zweiundvierzig Kanonen keine bessere Armierung als Hasard und Easton Terry, doch sie hatten die doppelte Anzahl an Schiffen und damit die besseren Angriffsmöglichkeiten und die größere Beweglichkeit.
Und noch etwas hatte Grammont: das Überraschungsmoment war, wie er fest annahm, auf seiner Seite. Im Schutze der Felsen, die die Einfahrt der Bucht säumten, würde er sich anpirschen. Die Sicht war denkbar schlecht, es war so dunkel wie am Abend. Die Wetterverhältnisse waren seine Verbündeten – die Engländer würden ihn und seine Leute erst bemerken, wenn sie bereits mitten unter ihnen waren.
Die Engländer saßen in der Falle.
Rasch näherten sich die vier Piratensegler der Bucht, die Distanz betrug nur noch drei Meilen und schrumpfte schnell zusammen. Das Unheil bahnte sich an, der große Überfall würde noch am Vormittag stattfinden. Die Dinge nahmen ihren Lauf und ließen sich nicht mehr aufhalten. Wie würde das Gefecht enden?
Der Regen peitschte wieder ihre Gestalten, doch sie hatten entsprechend vorgesorgt und sich dick vermummt. Dan O’Flynn und Bill kauerten auf der einen Seite der Einfahrt zwischen den Felsen und hielten zur See hin die Augen offen.
Drüben, an der Ostseite, hatten sich Mulligan und Bingham versteckt. Alle vier sollten sie dem Seewolf und Easton Terry sofort melden, wenn sich auch nur ein harmlos wirkender Fischerkahn auf der See zeigte.
„Glaubst du, daß die Hunde heute noch aufkreuzen?“ fragte Bill.
„Darauf läßt sich schwer antworten“, erwiderte Dan. „Bislang haben wir ja keinen Menschen gesehen. Falls die Franzmänner hier irgendwo ihre Posten sitzen haben, sind diese schon sehr auf der Hut. Wir haben das Gebüsch am Ufer der Bucht abgekämmt und niemanden gefunden. Das will aber nichts heißen. Man kann sich dort sehr gut verstecken, und wir kennen uns schließlich hier nicht so aus wie daheim in Cornwall.“