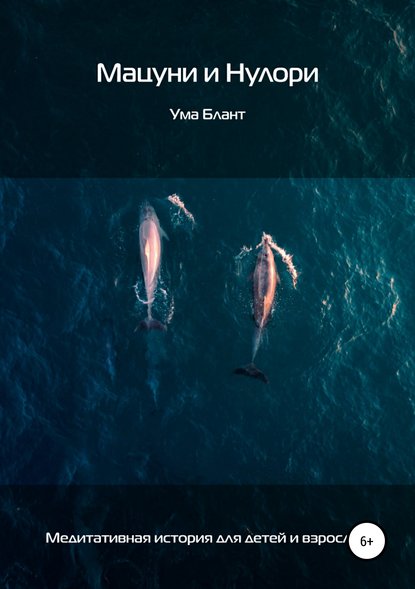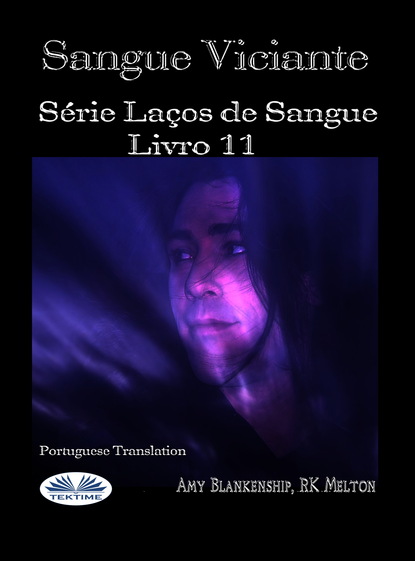Seewölfe Paket 18

- -
- 100%
- +
Nur Little Ross oben an der Querbalustrade sah das anders. Denn seine Dolores wurde von Luke Morgan herumgeschwenkt – der kleine Luke Morgan und das stattliche, große Flaggschiff! Darum betete Little Ross wieder, und Dan O’Flynn, der neben ihn getreten war, klopfte ihm tröstend auf die Schulter.
Old O’Flynn tauchte neben ihnen auf, sehr erschüttert über das, was sich seinen Blicken auf der Kuhl darbot.
„Was ist da denn los?“ brüllte er seinem Sohn ins Ohr – er mußte brüllen, denn der Lärm war ohrenbetäubend.
„Ringelpietz mit Anfassen!“ brüllte Dan zurück. „Jupp-heidie und jupp-heida! Wir feiern die ‚Isabella‘!“
„Habt ihr was getrunken?“ schrie der Alte giftig.
„Keinen Schluck!“
„Dann seid ihr alle übergeschnappt!“
„Na und? Ist doch mal fein!“ schrie Dan O’Flynn lachend. Und er brüllte seinem Alten ins Ohr, jetzt hätten sie eine leibhaftige Isabella auf der „Isabella“, nämlich jene hübsche Lady, mit der Hasard auf der Kuhl herumtanze.
Da krakeelte auch Old O’Flynn los. Viel fehlte nicht, und er hätte sich in das Getümmel auf der Kuhl gestürzt. Dan erwischte ihn gerade noch am Kragen und hielt ihn zurück.
„Isabella von Kastilien“ hieß eine spanische 200-Tonnen-Galeone, die von Hasard und seiner damaligen Stammcrew – das war 1576 gewesen – auf der Reede von Cadiz in einem verwegenen Raid gekapert und mit einer Ladung von dreißig Tonnen Silberbarren nach England gesegelt worden war. Seitdem hatten die Seewölfe aus Tradition ihre Schiffe „Isabella“ genannt – unter Verzicht auf die Landschaftsbezeichnung, die ja für ein englisches Schiff reichlich absurd gewesen wäre. „Isabella“ – das ging noch an. Ganz abgesehen davon hatten sie die Dons mit diesem Namen oft genug auf den Leim führen können.
Als sich jetzt, während einer Atempause, Hasard bei der Lady Isabella erkundigte, woher sie in Spanien stamme, da war’s doch tatsächlich Kastilien, was die Seewölfe erneut in eine Toberei ausbrechen ließ.
Natürlich empfing die Lady Isabella aus Kastilien die gewünschten Dinge: zwei Mehlfässer, ein Hartholzbrett zum Teig auswalzen und sogar ein Nudelholz.
Die fröhliche Stimmung an Bord hielt an. Tatsächlich meldete gegen Mittag der Ausguck im Großmars – Jack Finnegan hatte ihn übernommen – Steuerbord voraus die beiden Schnapstonnen – die nördliche rot, die südliche grün angestrichen. Die Heiterkeit nahm kein Ende.
Hasard ließ anluven, um genügend Abstand zum Ansteuern der Zufahrt zur Bucht zu haben. Als die beiden Tonnen querab an Steuerbord der „Isabella“ lagen, ließ Hasard halsen, und sie segelten über Backbordbug raumschots auf die Einfahrt zwischen den beiden Tonnen zu. Focksegel und Großsegel wurden geborgen. Der Besan genügte und erleichterte in der Bucht dann das Aufdrehen in den Wind, wenn der Anker fallen sollte.
Die beiden Tonnen auf den Spitzen der nördlichen und der südlichen Sandbank waren mit Steinen gefüllt, so daß sie auch von Sturm und Seegang nicht umgeworfen werden konnten. Zusätzlich waren sie von einem Steinring umgeben. Da hatte sich Joseph Jelly offenbar mächtig abgeplagt.
Die „Isabella“ glitt in eine idyllische Bucht, drehte in den Wind, und der Anker fiel. Er faßte sofort. Bisher stimmte alles, was Little Ross über die Sarasota Bay berichtet und angegeben hatte.
Den letzten Beweis erbrachte Joseph Jelly selbst.
„Er ist es“, sagte Little Ross zufrieden. „Kapitän Fogg hat ihn mir so beschrieben.“
Hasard wunderte sich über nichts mehr, zumal der Gnom, der aus der Hütte inmitten einer Lichtung des Stranddickichts getreten war, eine Schnapsflasche schwenkte und zur „Isabella“ etwas hinüberschrie, was als Aufforderung zu deuten war.
„Französisch“, sagte Little Ross neben Hasard. „Aber er spricht auch Spanisch.“
Der Gnom trug ziemlich große Schnallenschuhe, Strümpfe und Kniehose von undefinierbarer Farbe, eine verblichene Uniformjacke, deren linker Ärmel ausgerissen war, und eine Art Dreispitz auf dem verfilzten Kopf. Offenbar hatte er es mit der Gicht zu tun, denn er war krummrückig und ging am Stock, das heißt, jetzt hüpfte er zum Strand und ähnelte eher einem Kobold. Jedenfalls schien er sich mächtig zu freuen, Besuch zu haben. Und als er die Ladys entdeckte, die mal wieder am Kichern waren, stellte er die Schnapsflasche in den Sand, zog den Dreispitz mit Grandezza und zelebrierte Kratzfüße. Dabei grinste er zum Gotterbarmen.
„Na denn“, sagte Hasard ein bißchen erschüttert, „da habt ihr wirklich einen feinen Kavalier zum Compadre!“
Little Ross strahlte. „Nicht wahr? Und dann mit so guten Manieren. Über den fehlenden Ärmel mußt du hinwegsehen, Sir.“
„Hm. Den kann ihm ja Dolores wieder annähen“, meinte Hasard. „Und die Haare müßt ihr ihm auch mal waschen und schneiden.“ Er hob beide Hände an den Mund und rief zum Strand hinüber: „Ist es gestattet, an Land zu kommen, Mister Jelly?“ Er rief es auf französisch, und statt „Mister“ sagte er natürlich „Monsieur“, was der Gnom entzückt registrierte.
Und er rief zurück, daß er sich freuen würde, „mon capitaine“ einen „schnick“ – ein Schnäpschen – kredenzen zu dürfen.
Wenn’s sein muß, dachte Hasard, rief aber zu dem Gnom hinüber, daß er sich sehr geehrt fühle. Insgeheim beschloß er, Carberry diesen „Schnick“ zuerst trinken zu lassen. Der Profos hatte einen eisernen Magen und eine ausgepichte Kehle, und er hatte oft genug bewiesen, über was für ein Stehvermögen er verfügte, wenn die anderen bereits unter dem Tisch lagen und schnarchten.
Hasard wandte sich zu Ben Brighton um und sagte grinsend: „Dann wollen wir mal, Ben. Was meinst du, sollen wir beide Jollen aussetzen?“
Ben Brighton, bedächtig wie eh und je, ließ den Blick über die Kuhl wandern und nickte.
„Hat sich ’ne ganze Menge angesammelt, was an Land geschafft werden muß“, sagte er sachlich. „Da geht’s schneller, wenn wir beide Jollen nehmen.“
„In Ordnung, Ben. Verrückte Geschichte, wie?“
„Total verrückt“, brummte Ben Brighton und nickte mit dem Kopf zu der Lady Isabella hin, die zwischen den anderen Ladys bei den beiden Booten stand. „Ein feines Frauenzimmer, Sir. Richtig knackig überall – und unschuldiger als die anderen.“
„Ben!“ sagte Hasard mahnend und drohte mit dem Finger.
„Ich mein ja nur“, murmelte Ben Brighton und sagte noch leiser: „Wär was für die Schlangen-Insel.“
Hasard horchte auf. „Für dich, wie?“
„Aye, Sir.“ Ben seufzte ein zweites Mal. „Aber ich weiß schon, daß ein solcher Wunsch unmöglich ist. Entweder übernehmen wir alle – oder keine. Wenn einer von uns dieses Recht für sich in Anspruch nimmt, dann gilt das auch für die anderen. Nur ist das ein unlösbares Problem, weil wir Männer in der Überzahl sind. Aber irgendwann werden wir dieses Problem lösen müssen – auf der Schlangen-Insel. Da sind zu wenige Frauen für zu viele Männer. Und um die wenigen Frauen – könnte ich mir vorstellen – gibt’s irgendwann Krach zwischen den Männern. Hast du das schon mal bedacht, Sir?“
„Ja“, sagte Hasard verbissen.
„Und?“ fragte Ben Brighton.
„Nichts ‚und‘.“ Hasard blickte dem Mann, der ihm in all den Jahren zum Freund geworden war, fast hilflos in die Augen. „Was soll ich tun, Ben? Nach England segeln und an die fünfzig oder hundert Jungfrauen fragen, ob sie bereit wären, in die Neue Welt zu segeln, wo entsprechende Männer, die für sie unbekannt sind, nur auf sie warteten? Wie stellst du dir das vor?“
„Etwa so, wie du sagtest“, erwiderte Ben Brighton in seiner ruhigen Art. „Warum nicht?“ Er lächelte ein bißchen. „Wir können Falmouth anlaufen und Umschau halten. Oder Plymouth! Da würde uns sicher unser guter alter Nathaniel Plymson weiterhelfen können …“
„Mit Jungfrauen, wie?“ unterbrach ihn Hasard.
Ben Brighton schüttelte den Kopf und blickte wieder zu der Lady Isabella. „Das muß nicht sein. Wir sind ja auch keine Jungmänner mehr, nicht? Ich würde das nicht so eng sehen. Vielleicht wäre mir eine Frau, die kein Blümchen-rühr-mich-nicht-an mehr ist, sogar lieber, kein Flittchen, bewahre! Aber ein Frauenzimmer, das die Männer kennengelernt hat und auch zu unterscheiden weiß, ob ihr jetzt ein richtiger Kerl begegnet ist – oder ein Hallodri. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor.“
Hasard nickte nachdenklich. „Fragt sich, wieviel Zeit uns dafür noch bleibt.“ Er hob den Kopf. „Die Zeit, Ben! Sie läuft uns unter den Fingern weg! Schau dir meine beiden Jungen an! Und wenn wir die Ladys an Land gesetzt haben, karren wir weiter, um nach dem Stamm Tamaos zu suchen, der sich vielleicht – vielleicht! – dazu überreden läßt, bei der Schlangen-Insel eine andere Insel zu besiedeln, urbar zu machen und zu beackern, damit wir alle davon leben können – in Freiheit! Aber die Zeit läuft uns dabei weg.“
„Da sind deine Söhne, die das fortsetzen können“, sagte Ben Brighton gelassen. „Und vielleicht die Söhne und Töchter der Arwenacks. Da spielt Zeit keine Rolle. Nur müssen wir’s schaffen, unsere Aufgabe an unsere Kinder weiterzugeben – sonst ist unser Haus auf Sand gebaut.“
„Danke, Ben.“ Hasard hatte sich aufgereckt, und sein Gesicht war kantiger geworden. Er wandte sich zur Kuhl um, und seine Stimme schnitt scharf zwischen das Gemurmel dort: „Ed, laß die beiden Jollen aussetzen! Willig-willig! Wir haben noch eine andere Aufgabe, wenn ich daran erinnern darf. Bitte die Ladys in die kleine Jolle. Alles andere in die große!“
„Aye, Sir!“
Und der Profos zeigte mal wieder, aus welcher Ecke bei ihm der Wind wehte – nämlich von allen Seiten.
5.
Dieser Joseph Jelly war ein schrulliger, aber liebenswerter alter Kauz, und er stimmte sofort begeistert zu, als ihm Little Ross seinen verrückten Plan mit der Schenke auseinandersetzte. Noch mehr geriet er aus dem Häuschen, als er sah, welche Schätze aus der großen Jolle entladen wurden. Die Krone waren dann die drei Fässer mit dem erlesenen spanischen Rotwein. Daß diese drei Fässer von den Arwenacks nicht gerollt, sondern vorsichtig getragen wurden, verriet dem entzückten Gnom, daß hier Kenner am Werk waren, die darauf achteten, daß ein so edler Wein nicht durcheinandergeschüttelt wurde.
„Süperb, süperb!“ rief er ein ums andere Mal. „Kavaliere von Lebensart! Küß die Hand, Madame! Hatten Sie eine gute Reise?“ Er ging dazu über, die Ladys mit Handküssen zu beglücken und ihnen Komplimente zu sagen.
Es wurde wieder recht heiter. Die ergötzliche Freude des Gnoms übertrug sich auf die sechs Ladys und ihre drei Begleiter, und Hasard gewann den Eindruck, daß hier doch gute Ansätze für eine harmonische Gemeinschaft vorhanden waren, auch wenn es sich um Personen handelte, wie sie extremer nicht sein konnten: sechs ursprünglich sehr leichtfertige Frauenzimmer, zwei Neger, die Sklaven gewesen waren, ein Witzbold von Bootsmann und ein origineller Gnom. Bis auf Little Ross waren sie eigentlich alle irgendwie Außenseiter. Jetzt brauchten sie das nicht mehr zu sein. Sie konnten sich auf sich selbst besinnen und einen eigenen Lebensstil entwickeln, ohne jemandem untertan sein zu müssen.
Und dann kredenzte der Gnom seinen Begrüßungsschluck, den er im ersten Eifer über die Neuigkeiten und Pläne Little Ross’ völlig vergessen hatte. Er goß das Zeug, das wie Dünnmilch aussah, in kleine Bambusbecher, die er selbst hergestellt hatte.
Als die Becher verteilt waren, hob er seinen, krähte: „Willkommen bei Joseph Jelly!“ und kippte sich den Schnaps hinter die Binde.
Carberry, von Hasard an Bord bereits informiert, zog sofort grinsend nach, und als der Schnaps weg war, da war auch sein Grinsen weg. Er stand sekundenlang still und stumm und wie gelähmt und schien nach innen zu starren. Dann quollen seine Augen hervor, sein Gesicht färbte sich dunkelrot, er hob das Kinn, das die Arwenacks schon oft mit einem Hauklotz verglichen hatten – jetzt zitterte es bedrohlich –, und ein langes „Uaahhh!“ entrang sich seiner Kehle. Als nächstes wurde er von einem Husten erschüttert, wobei er sich zusammenkrümmte.
Hasard sprang ihm sofort bei und klopfte ihm den Rücken ab, denn jetzt litt der arme Carberry unter Atemschwierigkeiten und mußte mit Armbewegungen wiederbelebt werden. Natürlich nutzte Hasard die Gunst des Augenblicks und kippte seinen Schnaps unauffällig in den Sand.
„Hölle!“ ächzte Carberry, als die Explosion in seinem Inneren abebbte. „Ist der Kerl denn wahnsinnig?“ Er schüttelte sich, begann aber plötzlich zu grinsen – und sein Blick wurde etwas schielend.
„Fehlt dir was, Ed?“ fragte Hasard besorgt.
„Mir? W-was soll mir f-f-fehlen, S-sir?“ Carberry rülpste ungeniert. „N-noch n-n-nie so w-wohl ge-ge-fühlt, S-sir – hupps! Ha-hab nur ei-einen ge-ge-ge … hupps – … zwitschert.“ Er schielte noch beachtlicher, grinste noch dämlicher und schwankte, als stehe er im Sturm an Deck der „Isabella“. „Mä-mächtiger S-seegang b-bei die-diesem N-ne-bel“, murmelte er kopfschüttelnd.
„Sir, er ist volltrunken“, sagte der Kutscher indigniert. „Dieses Zeug muß die Wirkung eines ganzen Schnapsfasses haben. Ich rate dringend ab, daß wir davon trinken.“
„Verdammt, Kutscher“, knurrte Hasard und hielt seinen Profos fest, der jetzt unbedingt zu den Ladys wollte. „Wir können diesen Gnom doch nicht beleidigen und seinen Begrüßungsschluck ablehnen!“
„Brauchen wir auch nicht, Sir“, sagte der Kutscher. „Wir können das Zeug ja verdünnen – mit Saft oder Wasser. Wir sagen ihm einfach, daß wir so starken Schnaps nicht mehr gewohnt seien.“
„Gute Idee – Ed, sei friedlich …“
„Mö-möchte Bel-bella Isa k-k-küssen“, erklärte der Profos und zerrte an Hasard mit der Kraft eines Ackergauls, der bereits den heimischen Futtertrog in den Nüstern hat. Außerdem wurde er störrisch.
Hasard verfluchte sich. Da hatte er seinem Profos was schönes eingebrockt. Jawohl, es war seine Schuld, daß Ed jetzt voll wie eine Haubitze war und „Bella Isa“ küssen wollte.
„Ben!“ rief Hasard. „Sag dem Gnom, daß wir seinen Schnaps verdünnt trinken möchten. Er soll uns nicht böse sein, aber er sieht ja bei Ed die Wirkung, und der kann weiß Gott was vertragen.“
„Aye, Sir!“
„Wi-will zu Isa!“ krakeelte der Profos. „L-laß mi-mich los, du-du Fu-fuzzy-wuzzi!“ Offenbar erkannte er seinen Kapitän nicht mehr.
„Ja doch, gleich, Ed“, sagte Hasard hastig, „aber erst mußt du baden!“
„Wie-wieso?“
„Vorm Küssen ist das besser, Ed!“
„W-will nicht baden!“ brüllte der Profos. „W-will Bella kü-küssen …“
Big Old Shane und Ferris Tucker sprangen Hasard zu Hilfe, und zu dritt bugsierten sie den bezechten Profos ins Wasser, wo sich eine Art Schlacht entwickelte, weil Carberry partout nicht einsah, warum er baden sollte. Natürlich wurden Hasard, Old Shane und Ferris Tucker selbst klatschnaß. Außerdem empfing Ferris Tucker die Faust Carberrys aufs linke Auge, das sich sofort verfärbte und zuschwoll.
Als sie den Profos zum fünften Male untertauchten, wurde der plötzlich friedlich und zappelte nicht mehr. Als sie ihn schleunigst hochrissen, schnarchte er.
„Mann, Mann!“ Ferris Tucker stöhnte und betastete sein linkes Auge. „Dieser Affenarsch. Hätte der nicht früher einschlafen können?“
Old Shane grinste, warf sich den Profos über die Schulter und stampfte an Land. Ferris und Hasard wateten hinterher. Die Meute an Land war am Feixen.
Isabella, von Carberry „Bella Isa“ genannt, eilte herbei und legte Carberry, den Old Shane im Sand gebettet hatte, einen feuchten Umschlag um den Kopf. Carberry bedankte sich mit einem noch lauteren Schnarchen. Den feuchten Umschlag hatte der Kutscher angeordnet. Sonst fliegt ihm, wenn er aufwacht, der Schädel davon, hatte er erklärt.
Inzwischen war der Schnaps gewaltig verdünnt worden, zumal ihn Ben Brighton in größere und höhere Becher hatte umfüllen lassen, zusammen mit einer Flüssigkeit, die Joseph Jelly als Limonensaft bezeichnete und den Seewölfen vom Mittelmeer her bekannt war.
Der Kutscher hatte sich verwundert erkundigt, ob diese Citrusbäume denn hier anzutreffen seien. Er habe jedenfalls an der Küste von Florida noch keine gesehen. Daraufhin hatte der Gnom gekichert und erklärt, normalerweise gäbe es diese Bäume hier nicht. Aber er habe vor vielen Jahren von einem französischen Handelssegler Stecklinge erhalten und hier angepflanzt. Und siehe da – sie gediehen prächtig.
Wie dem auch sei – die Mannen und die Ladys fanden den gemischten Trunk herrlich erfrischend, und Hasard bedankte sich mit blumigen Worten für den vorzüglichen „Schnick“.
Little Ross empfahl er für künftige Gäste – mit Hinweis auf den schnarchenden Carberry –, denen diesen Mischtrank anzubieten.
„Ihr kriegt sonst garantiert Ärger“, sagte er warnend.
„Aber Joseph Jelly hat seinen Schnaps ohne sichtbare Wirkung heruntergekippt“, meinte Little Ross.
„Der ist ihn gewohnt“, sagte Hasard. „So was soll’s ja geben.“
Inzwischen hatte Joseph Jelly den Ladys seine Hütte gezeigt und großzügig erklärt, sie könnten dort einziehen und sich häuslich niederlassen. Natürlich werde er nicht bei ihnen schlafen, denn er sei ein Mann von Ehre, der die Formen zu wahren wisse.
„Wir werden noch mehr Hütten bauen“, sagte Joseph Jelly und gurgelte einen aus seiner Schnapsflasche, „feine Hütten mit Blick auf die Bucht. Auch eine Badestelle werden wir einrichten, damit sich die Damen erfrischen können.“ Er deutete mit seinem Krückstock zu einem Trampelpfad hinter der Hütte, der in das Schilfdickicht führte. „Dort seid ihr in drei Minuten an einem kleinen Süßwassersee, der von einer Quelle gespeist wird. Ich werde euch das alles zeigen – Joseph Jellys Reich, das ihr erben werdet, wenn mein letztes Stündlein geschlagen hat.“
„Nicht doch, Joseph“, sagte Ilaria warmherzig. „Dieses Stündlein ist noch viele Jahre entfernt. Weißt du denn, wie alt du bist?“
Joseph Jelly kicherte. „Bei fünfzig habe ich aufgehört zu zählen. Man vergißt die Zeit, wenn man hier lebt. Sie wird unwichtig. Na ja, manchmal fühle ich mich etwas allein. Aber jetzt seid ihr ja da.“
Hasard war zu ihnen getreten und fragte: „Sind hier nie Indianer aufgetaucht, Monsieur Jelly?“
Der Gnom schüttelte den Kopf. „Selten. Sie meiden das Große Wasser, wie sie es nennen. Vielleicht haben sie auch eine Scheu vor den Stürmen, von denen die See aufgepeitscht wird. Nein, sie sind keine Seefahrer und daher auch keine Menschen, die an der Küste leben wollen. Dafür kennen sie sich um so besser drinnen im Land in den sumpfigen Urwäldern aus. Ich habe nie Ärger mit ihnen gehabt.“ Er kicherte wieder. „Sie denken, ich sei selbst einer. Aber ich bin keiner! Ich bin Franzose reinsten Geblüts, jawohl! Mein Vater war der Graf de Jelly, das kannst du mir glauben, Sir. Kennst du ihn zufällig?“
Hasard bedauerte, den Grafen de Jelly leider nicht zu kennen, und fügte artig hinzu, daß es ihn aber ganz besonders freue, wenigstens den Sohn des Grafen kennengelernt zu haben. Dabei war allzu deutlich, daß Joseph Jelly ein Kreole war, der aber eben ein „Franzose reinsten Geblüts“ sein wollte. Da schien er einen kleinen Tick zu haben. Immerhin bemühte er sich mit einem geradezu fanatischen Eifer, den Kavalier mit den vollendeten Formen zu spielen. Der Teufel mochte wissen, von wem er den Handkuß, den Kratzfuß oder das Ziehen des Hutes gelernt hatte. Zusätzlich war das, was er über die unwichtige Zeit gesagt hatte, fast philosophisch.
Vorsichtig fragte Hasard: „Segeln viele Spanier hier vorbei, Monsieur de Jelly?“ Er setzte das „de“ bewußt vor den Namen.
Der Gnom erstrahlte. Er hatte es registriert. Dann zog er Hasard von der Hütte weg. „Die Damen brauchen das nicht zu hören“, wisperte er.
Als sie außer Hörweite der Hütte waren, die jetzt von den Ladys mit Gekicher und Gegacker in Besitz genommen wurde, sagte Joseph Jelly: „Es werden immer mehr Spanier, die hier vorbeisegeln, Sir. Leider, denn sie nehmen keine Rücksicht auf die Indianer. Seit der Bastard de Soto hier vorbeizog und mordete und niederbrannte, hat sich nichts geändert. Ich hasse diese Hundesöhne, muß mich aber mit ihnen arrangieren. Manchmal fahre ich mit meinem Boot nach Tampa hinauf, um dort einzukaufen, was ich so brauche. Es ist ja nicht viel. Ich bin jedesmal froh, wieder hierher zurückzukehren. Die Erde ist groß genug, Sir, und wir alle haben Platz auf ihr. Aber sie spielen sich auf, als gehöre ihnen alles. Und wo andere vor ihnen waren, da werden sie vertrieben oder ausgerottet.“ Die dunklen, alten Augen starrten zu Hasard hoch. „Du weißt das, Sir?“
„Ja, ich weiß es“, erwiderte Hasard, „und ich weiß, daß das alles den Keim des künftigen Unfriedens birgt.“ Und erbittert sagte er: „Sie sind alle verrückt nach den Schätzen, die in der Neuen Welt gefunden wurden. Ich bin Engländer. Auch in meinem Land sind Menschen, die an diesen Schätzen teilhaben wollen, aus rein egoistischen Gründen. Sie wollen sich die eigenen Taschen vollstopfen. An die Armen, an das Volk, denken sie nicht. Ja, ich weiß das alles“, er spuckte in den Sand, „als Freibeuter Ihrer Majestät der Königin von England, ausgestattet mit einem Kaperbrief, der mich ermächtigt, die Dons auszuplündern, wo und wann ich sie treffe. Ich, Philip Hasard Killigrew, von Ihrer Majestät zum Ritter geschlagen, plündere die Spanier aus, die wiederum ihrerseits kräftig dabei sind, in der Neuen Welt zu plündern und ihre Beute nach Spanien zu bringen. Und dort? Dort wird nicht das Volk glücklicher, sondern da werden gewisse Hände einiger weniger immer schmutziger, aber ihre Privatkassen füllen sich dabei. Ich bezweifele heute sogar, daß der König seinen Beuteanteil erhält. Dieser Mann hat längst nicht mehr die Macht, seine Beamten zu kontrollieren. Ich bin überzeugt, daß sie ihn betrügen. Bereits der Kapitän, der mit der Schatzfracht in seiner Galeone von hier nach Spanien zurücksegelt, betrügt seinen König und zweigt von der Beute etwas für sich ab. Aber bleiben wir bei mir, der ich ja auch plündere.“ Hasard fluchte vor sich hin. „Soll ich meine Beute vielleicht an irgendeine Küste der Neuen Welt zurückbringen, dort deponieren und den Eingeborenen sagen – irgendwelchen Eingeborenen –, das gehöre von Rechts wegen ihnen? Ein Unding! Mann, ich weiß auch bald nicht mehr, für was ich meine Haut zu Markte trage – nein, ich bin unwichtig: meine Männer riskieren jedes Mal ihr Leben, wenn wir an die Spanier geraten – oder an die Schnapphähne, die sich in der Karibik wie Aasfresser versammelt haben. Da frage ich mich wirklich: wozu das alles?“
Dieser alte Gnom hatte aufmerksam zugehört. Jetzt grinste er so ein Bißchen aus den Augenwinkeln heraus.
„Sir“, sagte er. „Was Gutes hast du schon getan. Du hast mir diese Huren gebracht!“
Hasard schnappte nach Luft.
„Nur sind es keine Huren“, fuhr der Gnom fort, „keine von ihnen, auch wenn sie dieses Gewerbe mal ausgeübt haben. Ich habe sie mir genau angeschaut, eine wie die andere. Das sind Weiber, die nichts weiter als einen ordentlichen, anständigen Kerl brauchen. Jawohl, nichts weiter. Und das sage ich dir! Ich werde höllisch aufpassen, welchen Kerl sie sich über kurz oder lang angeln. Da kannst du dich auf den alten Jelly verlassen. Zwei werde ich sowieso morgen oder übermorgen bereits trauen: Little Ross und dieses Schlachtroß, das Dolores heißt. Die passen zueinander wie der Korken auf die Flasche. Gut. Mal sehen, was die beiden Schwarzen so herzeigen. Im Moment scheinen sie noch verstört zu sein. Aber sie sind aus gutem Holz geschnitzt – aus schwarzem Holz, wobei ich auf die Farbe einen Scheiß gebe, Sir. Hierauf kommt’s an!“ Und er klopfte auf die Herzstelle. „Aber weiter: wenn es mir gelingt, für die drei anderen Damen das Gegenstück zu finden, dann werden wir hier eines Tages sechs Familien haben.“ Jetzt grinste der alte Halunke ganz offen. „Meinst du, die bleiben unfruchtbar? Nein, sie werden Kinderchen zeugen, alle sechs Paare. Und so wächst diese kleine Gemeinschaft – und ich werde der Urgroßvater sein, der allen den Marsch blasen wird, wenn sie Unrechtes tun. Also wird an dieser Stelle dieser Erde – in Sarasota – ein Völkchen leben, das in sich gesund ist. Verstehst du, was ich meine?“
„Ja“, erwiderte Hasard verhalten, obwohl er überrascht war, daß diesem Gnom etwas Ähnliches vorschwebte wie ihm selbst mit der Schlangen-Insel und Coral Island, jene Insel, wohin vielleicht Tamaos Stamm der Timucuas übersiedeln würde, um dort unabhängig und autonom ein neues Leben zu beginnen.
Der alte Jelly blickte ihn aufmerksam an. „Du bist skeptisch, wie?“
Hasard zwang sich zu einem Lächeln und schüttelte den Kopf.