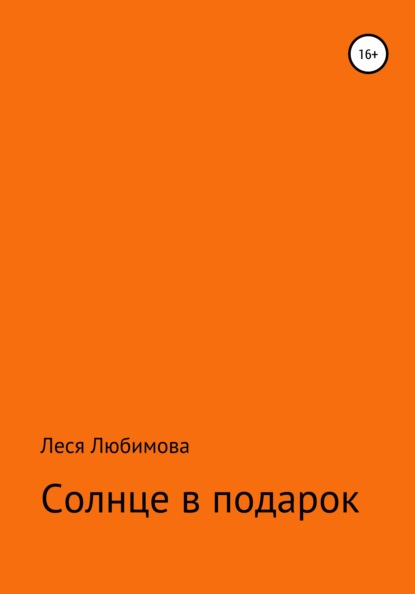Seewölfe Paket 18

- -
- 100%
- +
Breitbeinig stand Don José Isidoro auf dem Achterdeck der „Santa Teresa“ und fluchte über den verdammten Südwind, der alles daran setzte, ihn auf die Nase zu werfen. Und das im doppelten Sinn des Wortes.
Was die Wetterküche zusammenbraute, verschaffte den Britenbastarden und den indianischen Hundesöhnen immer mehr Vorteile.
„Diese Halunken haben keine Lichter gesetzt!“ schrie der Erste Offizier gegen das Orgeln des Windes an. Er hielt sich an der vorderen Schmuckbalustrade des Achterkastells fest.
„So dämlich sind sie nicht, um uns den Gefallen zu tun!“ brüllte Isidoro zurück.
Manchmal ging ihm die Engstirnigkeit seiner Offiziere auf den Nerv. Der Erste tat geradeso, als habe der Gegner versäumt, eine vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen. War es nicht diese Unbeweglichkeit des Denkens gewesen, die zum Scheitern der spanischen Armada im Ärmelkanal geführt hatte? Isidoro hielt sich für einen der wenigen, die daraus gelernt hatten. Doch bei der augenblicklichen Lage schien ihm auch das nicht viel zu nutzen.
Die „San Donato“ war bereits von der Dunkelheit verschluckt worden. Und von der „Isabella“ zeichneten sich nur noch die Segel als schemenhafte helle Flecken ab. Isidoro sah ein, daß er den Gedanken an eine baldige Konfrontation abschreiben mußte.
Auf den Decks der „Santa Teresa“ waren die Männer in aller Eile dabei, Manntaue zu spannen und die Luken und Schotten zu verschalken. Die Gefechtsbereitschaft wurde zur Lächerlichkeit degradiert. Schon jetzt bestand Gefahr, daß die Geschützladungen von überkommenden Seen feucht wurden. Immer höher wehten Gischtschwaden über die Kuhl. Wenn es das Pech wollte, konnten die Männer bald die eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen.
Nur einen Vorteil gab es noch, von dem Don José Isidoro hoffte, daß er entscheidend sein würde: Er kannte jeden Winkel in diesem Bereich des nördlichen Golfs von Mexiko. Demgegenüber mußten die Britenbastarde natürlich ins Hintertreffen geraten. Und von dem Verräterpack an Bord der „San Donato“ war nicht anzunehmen, daß es über besondere Kenntnisse verfügte. Nicht im entferntesten ahnte Isidoro, daß er sich in diesem Punkt täuschte.
Auch der Ausguck der „Santa Teresa“ hatte Errol Island gesichtet, noch bevor die Dunkelheit hereingebrochen war. Und Don José Isidoro hatte gleichfalls Order gegeben, auf Nordkurs zu gehen.
Mittlerweile mußten die Chandeleur-Inseln schon so nahe sein, daß man hinspucken konnte. Isidoro spürte und witterte es geradezu. Er lächelte grimmig, während er sich mit dem Rücken gegen den heulenden Wind stemmte.
Nein, ihm konnte in diesem Küstenbereich keiner etwas vorexerzieren. Wenn einer Untiefen und sonstige Gefahrenbereiche kannte, dann war er es. Daran änderte auch die Dunkelheit nicht viel. Man brauchte eben dieses besondere Gefühl, das ein Mann nur in jahrzehntelangen Erfahrungen entwickeln konnte.
Kapitän Isidoro war stolz darauf, daß er genau dies von sich behaupten konnte. Seine Einschätzung der Lage war vortrefflich, das stand für ihn fest. Alles in allem konnte er davon ausgehen, daß er wahrscheinlich nicht einmal mehr große Mühe aufwenden mußte. Wenn der Sturm erst richtig loslegte, dann brummten die Britenbastarde und die Timucua-Hundesöhne auf das nächstbeste Riff vor den Chandeleurs. Bei Tagesbeginn, nach Abflauen des Sturms, brauchte man dann nur noch die Überlebenden aufzufischen – falls es welche gab.
„Rudergänger!“ rief Isidoro schneidend.
„Si, Señor Capitán?“ Der Mann war nur als Schatten zu erkennen. Kein Ruderhaus schützte ihn vor den Unbilden der Witterung.
„Zwei Strich Backbord“, befahl Isidoro.
„Zwei Strich Backbord“, wiederholte der Rudergänger, und, etwas später: „Kurs liegt an, Señor Capitán.“
Ein weiterer Schatten keuchte von der Schmuckbalustrade heran. Der Erste Offizier rückte den Kinnriemen seines Federhuts fest. Der Wind zerrte mit aller Macht daran und bog die breiten Krempen nach oben.
„Manntaue sind gespannt, Señor Capitán, Luken und Schotten verschalkt.“
„Wurde auch Zeit“, entgegnete Isidoro knurrend.
„Darf ich mir eine Frage erlauben, Capitán?“
„Heraus damit.“
„Sind Sie überzeugt, daß wir auf dem richtigen Kurs liegen? Ich meine, wenn wir davon ausgehen, daß die Engländer und auch die Timucua sich kaum auskennen dürften, ist es dann nicht unsinnig, ihnen noch weiter zu folgen? Vielleicht laufen wir gemeinsam mit ihnen auf ein Riff, oder wir werden auf Legerwall gedrückt.“
Einen Moment hielt Isidoro die Luft an.
„Was faseln Sie, Mann!“ brüllte er dann. „Was glauben Sie, warum ich die Kurskorrektur befohlen habe! Wollen Sie etwa behaupten, daß mir ein Fehler unterläuft? Ausgerechnet mir?“
„Nein, Señor Capitán, ich dachte nur – ich meine …“
„Sie sollen nicht denken und nicht meinen, Sie sollen …“
Ein ohrenbetäubendes Krachen schnitt ihm die Worte von den Lippen. Im nächsten Sekundenbruchteil folgte ein Bersten und Mahlen, das den Schiffsleib durchlief, als wollte es ihn in tausend Stücke reißen.
Don José Isidoro spürte es bis in die letzte Faser seiner Nerven, denn er war mit diesem Schiff verwachsen. Jeden unbekannten Laut und jede unvorhergesehene Bewegung in den Verbänden hatte er stets sofort gespürt, als handelte es sich um eine Veränderung seines eigenen Körpers.
Dies aber, was jetzt geschah, war wie ein grausamer und tödlicher Schlag.
Don José empfand den Schmerz, als sei er selbst getroffen worden. Aber ihm blieb keine Zeit, den Schmerz hinauszubrüllen.
Ein jäher Ruck ging durch die Galeone.
Isidoro verlor den Halt, kippte vornüber und ruderte vergeblich mit den Armen. Er prallte gegen seinen Ersten Offizier, der rücklings stürzte. Gemeinsam schlugen sie auf die Planken.
Auf der Kuhl und auf der Back entstand Geschrei. Die Männer verloren den Halt, verhedderten sich in den Manntauen. Einige von ihnen schlitterten unter den Tauen über die feuchten Planken, prallten gegen Geschützlafetten oder Nagelbänke und zogen sich schmerzhafte Prellungen zu.
Der Südwind heulte und fauchte und versetzte den Segeln wilde Prankenhiebe, als wolle er die „Santa Teresa“ über den Bug in den Grund bohren. Doch die Galeone saß bereits hoffnungslos fest. Eine kurze Bewegung um die Längsachse folgte, begleitet von einem splitternden Geräusch, das dem Kapitän abermals durch Mark und Bein ging. Das Tuch begann zu knattern und zu schlagen, und im nächsten Moment zerriß das Fockmarssegel mit einem explosionsartigen Knall. Rings um den Schiffsleib kochte die See mit weißem Schaum.
Mit einem wilden Fluch stieß Isidoro den Ersten Offizier von sich weg. Dann rappelte er sich mühsam auf, taumelte und fand schließlich sein Gleichgewicht.
Die Galeone saß unverrückbar fest, wie von den Fäusten eines Giganten gestoppt. Auf dem Hauptdeck herrschte immer noch Zustand. Die Männer brüllten und versuchten, auf die Beine zu gelangen, wobei sie sich immer wieder gegenseitig behinderten.
Wie zum Hohn riß die Wolkendecke für einen Moment auf. Eine dunkle Wand wurde erkennbar, zum Greifen nahe nördlich voraus.
Eine der Inselküsten!
Ohnmächtig vor Wut sah Isidoro die Schaumkränze, die das brodelnde Wasser überall um die vorgelagerten Riffs bildete. Und die „Santa Teresa“ saß mittendrin. Blindlings, wie die blutigsten Anfänger, waren sie aufgebrummt!
„Hölle und Teufel!“ brüllte Isidoro. „Das kann doch nicht wahr sein! Wie konnte das bloß passieren? Welcher verdammte Narr …“
Der Erste Offizier schraubte sich vor ihm in die Höhe.
„Bevor Sie sich weiter auslassen, Capitán“, schrie er, „erinnern Sie sich gefälligst daran, wer die Kursänderung befohlen hat!“
Don José Isidoro schluckte und preßte die Zähne aufeinander, daß es knirschte. Normalerweise hätte er seinen Untergebenen für diese Unverfrorenheit gemaßregelt. Aber er verdaute es, denn sein eigener Fehler wurde ihm siedend heiß bewußt.
„Wir müssen die Segel bergen“, sagte er, laut genug, daß es im heulenden Wind eben noch zu verstehen war. „Sonst wird uns gleich das gesamte Tuch zerfetzt.“
„Dazu wird keine Zeit bleiben“, entgegnete der Erste mit grimmigem Spott, „hören Sie mal genau hin.“
Isidoro brauchte sich nicht sonderlich anzustrengen, um herauszufinden, was der Erste meinte. Eher war es eine furchtbare Ahnung, die sich jetzt bestätigte. Jeder Seefahrer, der lange genug auf Schiffsplanken gestanden hatte, kannte dieses Geräusch. Und stets verband es sich mit bösen Erinnerungen. Erinnerungen auch an Freunde und Gefährten, die den nassen Tod gefunden hatten.
Trotz der tosenden Fluten rings um die „Santa Teresa“ war es deutlich zu vernehmen. Ein Gurgeln, schwach noch. Aber Don José Isidoro hörte bereits diese bösartige Gefräßigkeit heraus, mit der es immer rascher um sich greifen würde. Der Klang pflanzte sich durch die unteren Decksräume fort, die wie ein Resonanzkörper wirkten.
Kapitän Isidoro erwachte aus einer momentanen Erstarrung.
„Auf was warten Sie noch?“ brüllte er. „Schicken Sie die Leute an die Pumpen! Alle verfügbaren Kräfte! Oder wollen Sie abwarten, bis wir mit Mann und Maus absaufen?“
Der Erste Offizier versteifte seine Haltung.
„Nein, Capitán“, entgegnete er schnarrend, „die Frage stellt sich für mich nicht, denn Sie sind der Kapitän, und niemand anders trifft hier an Bord die Entscheidungen.“ Er wandte sich mit einer energischen Kehrtwendung ab, ohne seinem Vorgesetzten Zeit für eine Entgegnung zu geben.
Sekunden später hörte Isidoro die Befehlsstimme seines Ersten durch das Heulen des Windes. Sturmlaternen wurden angezündet, und die Lage stellte sich noch schlimmer dar, als man das in der Dunkelheit hätte ahnen können.
Don José Isidoro hatte dieses niederschmetternde Gefühl, daß eine unsichtbare Macht versuchte, ihm den Boden unter den Füßen wegzureißen. Wie tückische Teufelszähne ragten die Riffs aus der brodelnden Wasseroberfläche. Und es gab keine Frage: Bei einem mit voller Kraft entfesselten Sturm wäre die „Santa Teresa“ sofort zerschellt. Dennoch entstand für Isidoro nicht der Eindruck, Glück im Unglück zu haben.
Zuviel war schiefgegangen.
Die verfluchten Britenbastarde und ihre indianischen Verbündeten waren entwischt. An eine weitere Verfolgung war nicht zu denken. Aus und vorbei. Jetzt galt es nur noch, die eigene Haut zu retten.
Die Hoffnung, daß die Gegner vielleicht von einem ähnlichen Schicksal ereilt wurden, blieb für Don José Isidoro weniger als ein schwacher Trost.
5.
Der Seewolf war sich darüber im klaren: Neben der Dunkelheit und dem heraufziehenden Sturm war es vor allem eine gehörige Portion Glück, die sie an diesem Abend vor einem Gefecht bewahrte.
Denn jetzt, da sie sich bereits der Einfahrt zum Lake Pontchartrain näherten, brauchten sie mit den Verfolgern nicht mehr zu rechnen. Auf der „Isabella“ und auch auf der „San Donato“ wurden alle Hände gebraucht, um zu verhindern, daß die Schiffe auf Legerwall gedrückt wurden. Nicht anders konnte es den Spaniern auf der „Santa Teresa“ ergehen, im Gewirr der Inseln mußten sie vollauf damit beschäftigt sein, ihre eigenen Schwierigkeiten zu bewältigen.
Der Südwind gebärdete sich mittlerweile wie wild. Die See schien zu kochen, und Gischtschwaden wurden über die Decks gepeitscht. Längst hatten die Männer auf beiden Schiffen die Segelfläche verringert. Hasard und Ben Brighton mußten höllisch aufpassen, die Tuchfühlung mit der „San Donato“ nicht zu verlieren, die Sturmsegel waren in der Dunkelheit nicht mehr als helle Flecken, verblassenden Irrlichtern gleich.
Pete Ballie, der als Gefechtsrudergänger seinen Platz beibehalten hatte, hielt das Steuerruder mit seinen Fäusten, die so groß waren wie Ankerklüsen und durch nichts erschüttert werden konnten.
Durch die Manntaue gesichert, harrten die Arwenacks auf den Decks aus. Auch auf dem Quarterdeck und dem Achterdeck waren inzwischen Taue gespannt worden. Die Gefechtsbereitschaft war aufgehoben, die Kohlebecken, die jetzt nur noch gefährlich werden konnten, waren gelöscht.
Gemeinsam mit dem Kutscher und Mac Pellew befanden sich die Zwillinge bei Tamao und Asiaga in der Krankenkammer. Auch dort wurde jede Hand gebraucht. Es galt, die Fieberkranken durch Stricke auf ihren Lagern zu sichern und ihnen Mut zu machen. Denn keiner von ihnen hatte jemals die Hölle eines Sturmes auf See erlebt.
Nur für Augenblicke riß die Wolkendecke von Zeit zu Zeit auf. Dann waren die düsteren Küstenabschnitte zu sehen, denen die „Isabella“ und die „San Donato“ bedrohlich nahe waren. Was Marcos und die Indianer leisteten, verdiente Anerkennung. Der Spanier erwies sich als ein hervorragender Lotse, und gemeinsam mit seinen Freunden schafften es die Timucua, die Galeone auf Kurs zu halten.
Nach Hasards Schätzungen befanden sie sich bereits zwischen Ship Island und der Isle au Pitre, also in der Einfahrt zum Lake Pontchartrain.
„Das wird zu riskant!“ brüllte Ben Brighton gegen das Heulen des Südwinds an.
Bens Sorge war mehr als berechtigt, soviel stand fest.
„Hast du einen besseren Vorschlag?“ antwortete Hasard in der gleichen Lautstärke.
„Wir stehen doch direkt vor dem Lake Borgne, wenn ich die Karte richtig im Kopf habe. Nur eine halbe Seemeile, und wir hätten einen sicheren Ankerplatz. Vielleicht ist dieser Marcos zu sehr von sich überzeugt.“
„Wie willst du ihn anpreien?“ rief Hasard. Es war in der Tat unmöglich. Das Heulen des Winds erschwerte die Verständigung schon auf wenige Yards. Überdies erschien es mehr als gefährlich, den Indianern jetzt noch einen Kurswechsel abzuverlangen.
Ben Brighton winkte ab. Er wußte, daß es keinen Sinn hatte. Sie konnten nur beten, daß sie es schafften, bevor der Sturm mit aller Gewalt losbrach.
Auch Hasard hätte dazu geneigt, im Lake Borgne einen Ankerplatz zu suchen. Dieser See war dem Lake Pontchartrain östlich vorgelagert, grenzte also unmittelbar an den Chandeleur Sound. Aber Marcos verfügte über die besseren Ortskenntnisse. Er mußte wissen, was er tat. Durchaus möglich, daß der Lake Pontchartrain den besseren Schutz vor einem Sturm bot.
Während der nächsten Viertelstunde schwoll das Tosen der Naturgewalten deutlich an. Auf beiden Schiffen wurde weiteres Tuch geborgen, und Hasard sah, daß Marcos mit äußerster Vorsicht auf nördlichem Kurs lavierte.
Abermals riß die Wolkendecke auf, nur für die Länge eines Atemzugs.
Die endlose, sturmgepeitschte Weite einer Wasserfläche wurde erkennbar. Doch an Steuerbord erstreckte sich schützendes Ufer. Der beginnende Sturm zerrte an hohen Baumkronen und wühlte sich durch das Unterholz.
Rechtzeitig, bevor es wieder fast stockfinster wurde, sahen Hasard und Ben, wie die „San Donato“ auf Kurs Ostnordost ging. Hart krängte die Galeone nach Backbord, und der „Isabella“ erging es nicht anders, als der Seewolf den neuen Kurs anlegen ließ.
Doch wenige Minuten später war es geschafft.
Marcos steuerte das Halbrund einer Bucht an, in der beide Schiffe in ausreichendem Abstand ankern konnten. Sofort nachdem der Anker geworfen worden war, gab Hasard Befehl, die Geschütze zu entladen. Überkommende Seen würden die Ladungen verderben und man würde zuviel Zeit verlieren, wenn eine erneute Gefechtsbereitschaft notwendig wurde.
Während Al Conroys Männer noch an der Arbeit waren, bargen die übrigen Arwenacks das restliche Tuch. Dann beeilten sie sich höllisch, in den Wanten abzuentern. Denn was da an ihrer Kleidung zerrte und an ihnen rüttelte, war beileibe kein laues Lüftchen mehr.
Auch auf der „San Donato“ waren mittlerweile sämtliche Segel aufgetucht.
Der Südwind schwoll an. Rasend schnell entfesselte er sich zum Sturm, der mit urwelthaftem Gebrüll über Land und See fegte. Auf den beiden Schiffen begaben sich die Männer in Sicherheit. Abgebrochene Zweige wirbelten vom Ufer her über die Decks. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis der Sturm dort drüben die ersten Bäume entwurzelte.
Im untersten Stauraum der „Santa Teresa“ war nichts zu spüren von jenem kalten Atem, mit dem der Sturmwind über die oberen Decks der Galeone fegte. Stickige Hitze umgab die Männer und legte sich wie mit zentnerschweren Lasten auf ihren Brustkorb. Die Ölfunzeln verstreuten trübe Helligkeit, und ihr beißender Rauch verursachte Hustenreiz.
Schon bis zu den Knien standen sie im Wasser.
Aber schlimmer noch als das alles belasteten die ständigen Geräusche. Jedes einzelne traf sie bis ins Mark und zerrte peinigend an ihren Nerven. Da war dieses Gurgeln, verursacht vom hereinströmenden Wasser. Dann das monotone Geräusch der Pumpen, die doch nichts zu bewirken schienen. Mit dem Keuchen und leisen Fluchen der Männer vermischte sich ein Knarren, das von allen Seiten auf sie eindrang und ihnen einen Schauer über die nackten Oberkörper jagte.
Sie fühlten sich abgeschnitten von der Außenwelt, in der der mörderische Sturm tobte. Und sie spürten, wie das Schiff auf jeden Stoß der Naturgewalten reagierte, wie es ächzte und stöhnte und doch den zerstörerischen Kräften hoffnungslos preisgegeben war.
Längst hatten sie den Versuch aufgegeben, das Leck abzudichten. Es befand sich etwa mittschiffs, in unmittelbarer Nähe des Kielschweins. Die scharfen Zähne des Riffs hatten die Planken aufgerissen, als handelte es sich um leicht verwundbare menschliche Haut. Möglicherweise gab es noch mehr Lecks, von denen sie bislang noch nichts wußten.
Mehr als dreißig Männer waren es, die keuchend im Halbdunkel des Stauraums schufteten. Alle hinderlichen Kleidungsstücke hatten sie abgelegt. Sie trugen nur noch ihre Hosen. Der Schweiß rann ihnen in Strömen über die Haut.
Jenes Ächzen und Stöhnen, das den Schiffsrumpf durchlief, wurde von Minute zu Minute stärker. Und dann, plötzlich, dröhnte es zum erstenmal wie ein Donnerschlag durch den Rumpf der Galeone. Alles, selbst die stickige Luft, schien unter der Wucht des Schlages zu vibrieren. Sofort danach verstärkte sich das Ächzen des Schiffskörpers. Es klang wie der Schmerzenslaut eines gequälten Tieres.
„Santa Madre“, flüsterte Seesoldat Felipe Romero, der zur Gruppe des Sargento Pedro Carrillón gehörte. „Was war das, um Gottes willen?“
Auch die anderen hatten mit ihrer Arbeit an der Pumpe innegehalten. Sie befanden sich in unmittelbarer Nähe des Niedergangs, der in die oberen Decksräume führte.
Der Sargento überwand sein Entsetzen als erster. Er hatte mehr Erfahrung als die fünf jüngeren Soldaten, die ihm zugeteilt waren. Wenn er auch kein Seefahrer war, so hatte er doch zahlreiche Einsätze auf See hinter sich, und eine Havarie war nichts Unbekanntes für ihn.
„Jetzt geht es richtig los“, sagte er halblaut, so daß nur seine Gruppe es verstehen konnte. „Das ist der Sturmwind, Männer. Jetzt treibt er die Wellen bald haushoch gegen die Außenbeplankung. Und wir haben das Vergnügen, mitzuerleben, wie sich so etwas unter Deck anhört.“
„Aber …“ Es war Jorge Béjar, der zu sprechen ansetzte.
Ein neuer dumpfer Schlag ließ seine Stimme untergehen. Und abermals verstärkte sich das Ächzen und Knarren des Rumpfes.
„Himmel noch mal!“ schrie Pepe Hurtado, ein weiterer aus der Gruppe des Sargento Carrillón. „Wenn das so weitergeht …“
Pedro Carrillón war mit einem Satz bei ihm und hielt ihm die Faust vor die Nase. Das kniehohe Wasser geriet in heftige Bewegung.
„Willst du wohl still sein, Hurtado? Kein Ton, verstanden?“ Der Sargento senkte die Stimme zum Flüsterton. „Kapiert ihr denn nicht? Wenn ihr euch unauffällig umseht, werdet ihr es begreifen. Auch die anderen Kerle sind zu Tode erschrocken. Noch eine Weile, und hier bricht die schönste Panik aus.“
„Ist es so schlimm?“ hauchte Juan Lloberas, der einen vorsichtigen Blick riskiert hatte. „Ich dachte, wenn wir auf diesem Riff festsitzen, können wir nicht sinken.“
„Einfaltspinsel“, knurrte Domingo Garcia, sein Nebenmann, „soll ich dir sagen, was passiert? Die große, stolze ‚Santa Teresa‘ wird auseinanderbrechen, und dann saufen wir ab. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Habe ich recht, Sargento?“
Carrillón nickte düster.
„Ich fürchte, du hast recht, Garcia. Aber wie auch immer: Wenn das tatsächlich passieren sollte, sind wir die ersten, die dran glauben müssen. Und wer weiß, wie es jetzt oben an Deck aussieht? Vielleicht haben Capitán Isidoro und seine saubere Achterdecksclique längst beschlossen, das Weite zu suchen.“
„Also hauen wir ab!“ zischte Felipe Romero. „Auf was warten wir noch?“
„Es geht nur, wenn wir uns einig sind“, entgegnete der Sargento ernst, „mich würde natürlich die Hauptschuld treffen, weil ich euch als Vorgesetzter dazu angestiftet habe. Aber ihr müßt euch alle darüber im klaren sein, daß es Fahnenflucht ist, was wir begehen. Und ihr wißt, daß darauf die Todesstrafe steht.“
„Die Neue Welt ist riesengroß“, sagte Lloberas mit einem grimmigen Lachen, „da gibt es genügend Ecken und Winkel zum Verkriechen. Und welchen Unterschied macht es“, fügte Lloberas hinzu, „ob wir für die spanische Krone elendiglich ersaufen oder uns heimlich verdrücken?“
„Keinen“, sagte Carrillón, „also sind wir uns einig?“
Die fünf Männer nickten.
„Gut. Dann ziehen wir uns jetzt zurück. Wichtig ist, daß uns keiner folgt. Und auf dem Hauptdeck müssen wir eins der Beiboote in unsere Gewalt bringen.“ Mit verstohlenen Handzeichen bestimmte der Sargento die Reihenfolge.
Domingo Garcia näherte sich dem Niedergang als erster.
Noch waren die übrigen Männer im Stauraum in betroffenes Gemurmel vertieft. Carrillón beobachtete sie unauffällig aus den Augenwinkeln heraus. Er wußte, daß die Panik wie ein Blitz aus heiterem Himmel losbrechen konnte. Auch war es möglich, daß die anderen Kerle zu ähnlichen Überlegungen gelangten wie er selbst.
Garcia war ein schlanker, beweglicher Mann. Nachdem er lautlos den Niedergang erreicht hatte und aufzuentern begann, zog er behutsam die nackten Füße aus dem Wasser, um kein auffälliges Geräusch zu verursachen. Denn ausgerechnet in diesem Moment hatten Sturm und Wellengang eine Atempause eingelegt. Doch Garcia schaffte es, unbemerkt in der Dunkelheit des höherliegenden Vorratsraumes zu verschwinden.
Mit einer knappen Kopfbewegung schickte der Sargento den zweiten Mann auf den Weg, Lloberas. Carrillón gab sich keinen falschen Hoffnungen hin. Garcia war durch den Rest der Gruppe einigermaßen vor unerwünschten Blicken abgeschirmt gewesen. Auch bei Lloberas mochte das noch einigermaßen problemlos ablaufen.
Aber dann mußten die anderen Burschen es spitzkriegen. Es handelte sich ausnahmslos um Decksleute aus der Stammbesatzung der „Santa Teresa“. Carrillón und seine Gruppe waren die einzigen Soldaten, die zur Verstärkung an die Pumpen geschickt worden waren. Ihren Kameraden an Deck hatte man sicherlich angenehmere Aufgaben zugeteilt. Zumindest fühlten sie sich kaum so eingeschlossen und hilflos, wie es hier unten im Stauraum der Fall war. Carrillón wußte, daß er diese Ungerechtigkeit dem Teniente verdankte, der ihn schikanierte, wo er konnte.
Allein das war schon ein Grund, sich heimlich, still und leise abzumelden.
Auch Juan Lloberas schaffte es, ohne bemerkt zu werden.
Dann jedoch, als Jorge Béjar etwas zu tapsig durch das Wasser pflügte, geschah es.
Drüben, bei der Schar der Decksleute, brach das aufgeregte Gemurmel plötzlich ab.
„He, ihr Bilgenratten!“ brüllte einer von ihnen mit rauher Stimme. „So haben wir nicht gewettet!“
Béjar hatte den Niedergang schon erreicht und ließ sich nicht beirren.
Carrillón reagierte geistesgegenwärtig.
„Order vom Teniente!“ rief er energisch. „Wir werden an Deck gebraucht!“
Kaum hatte er ausgesprochen, donnerte erneut eine Woge gegen die Backbordseite der Galeone. Durchdringender und heftiger als zuvor folgte das Ächzen des Rumpfes. Im nächsten Atemzug zerbarst eine Planke mit lautem Knall. Das mußte nahe beim Kielschwein sein, denn mitten zwischen den Decksleuten stieg plötzlich eine weiß schäumende Fontäne auf, die aber wieder zusammenbrach.
Entsetzt wichen die Männer auseinander.
Pedro Carrillón erkannte, daß es einen winzigen Zeitvorsprung gab, solange die Burschen aus der Mannschaft ihr Entsetzen noch nicht überwunden und klare Entschlüsse gefaßt hatten.
Béjar war schon fast oben.