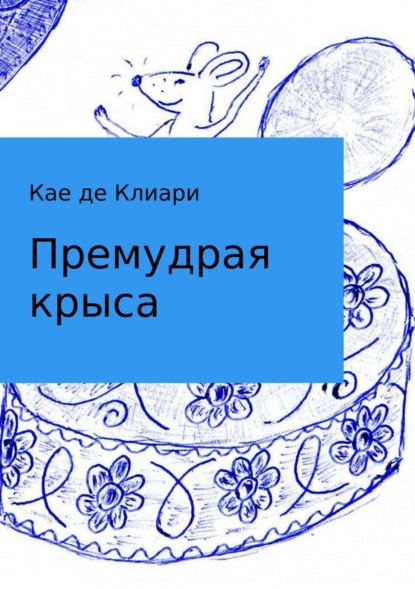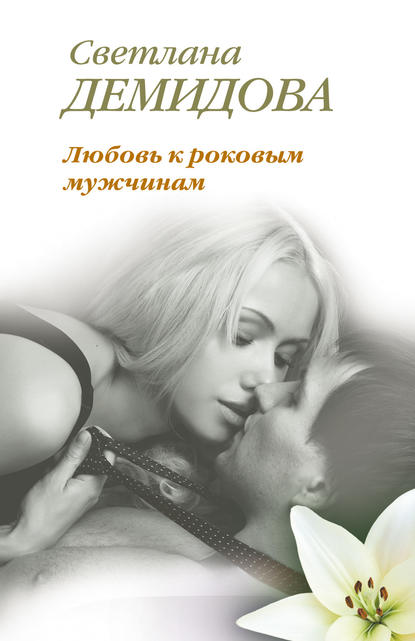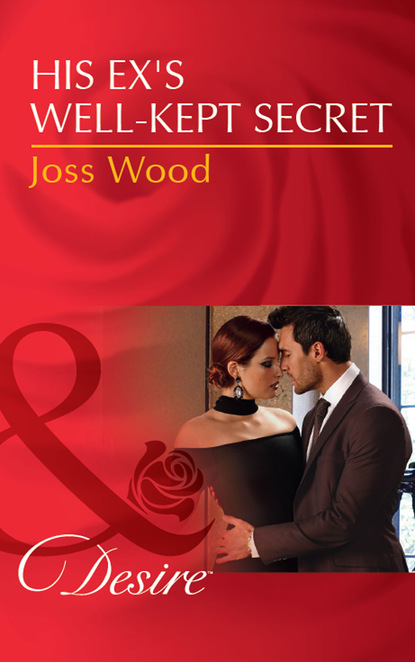Seewölfe Paket 18

- -
- 100%
- +
„Schnell jetzt!“ zischte der Sargento. „Tempo, Tempo, bewegt euch! Nichts wie weg hier!“
Romero und Hurtado brauchten keine zweite Aufforderung. Auch ihnen saß die Angst im Nacken, und sie warfen sich buchstäblich dem Niedergang entgegen. Carrillón folgte ihnen mit kurzem Abstand, indem er sich rückwärts bewegte. Die Ölfunzel, die er während der Pumparbeiten gehalten hatte, behielt er in der Hand.
Die Decksleute rissen sich schneller zusammen, als Carrillón erwartet hatte. Er zuckte zusammen, als ihr jähes Gebrüll aufwallte.
„Die Schweine hauen ab!“ schrie einer.
„Was die können, können wir auch!“ fügte ein anderer mit schriller Stimme hinzu.
„Verdammt noch mal, packen wir sie endlich!“ brüllte ein dritter.
Und sie waren schon in Bewegung, walzten in breiter Front durch das kniehohe Wasser und vergaßen die Pumpen und die hereingurgelnden Fluten.
Carrillón erschrak bis ins Mark, doch gleichzeitig beflügelte ihn der Überlebenswille.
Hastig wandte er sich um. Hurtado hatte den Niedergang erst zur Hälfte erklommen.
„Hier, nimm!“ brüllte Carrillón, und er atmete auf, als der Soldat sofort begriff, die Ölfunzel an sich riß und wie von Furien gehetzt weiter aufenterte.
Breitbeinig verharrte Pedro Carrillón, den muskulösen Oberkörper leicht vorgebeugt. In seinem harten Gesicht stand ein Grinsen von wilder Entschlossenheit. Es verlieh ihm ein Gefühl der Sicherheit, den Niedergang hinter seinem Rücken zu wissen.
Einen Atemzug später waren sie heran, mit Wutgebrüll und erhobenen Fäusten. In ihren verzerrten Gesichtern standen Todesangst und Zorn.
„Sargento!“ schrie einer der Soldaten aus der Luke nach unten. „Verdammt noch mal, auf was warten Sie noch?“
Carrillón schüttelte den Kopf und antwortete nicht. Er hätte nicht entwischen können, das wußte er. Die Meute hätte ihn wie einen reifen Apfel vom Niedergang gepflückt.
Jäh schnellte er vor, ohne erkennbaren Ansatz. Und er griff sich den, der ihm am nächsten war. Seine zupackenden Fäuste waren wie eine große eiserne Klammer. Innerlich triumphierte er schon jetzt. O ja, als Seeleute mochten sie ihm überlegen sein, in ihrem Wissen und in ihrem Können. Aber das Kämpfen war sein Handwerk, zu Lande und zu Wasser hatte er es gelernt wie nichts anderes.
Fast ohne Mühe hob er den Mann hoch und schleuderte ihn gegen die Reihen der Angreifer. Einen winzigen Moment sah er, wie sie ungläubig die Augen aufrissen. Dann wurden sie von ihrem eigenen Gefährten niedergemäht, der ihnen waagerecht entgegensegelte.
Schreie voller Wut und Empörung gellten. Das Wasser spritzte hoch, als sie stürzten und sich ineinander verhedderten.
Pedro Carrillón wirbelte herum. Mit federnden Bewegungen enterte er auf und schaffte es. Oben sah er die erleichterten Mienen seiner Soldaten im blakenden Schein der Ölfunzel.
Er achtete nicht auf sie, packte den Lukenrand, löste die Verankerung und ließ die Luke fallen. Das krachende Geräusch ging im erneuten Heranrollen einer Woge unter.
Carrillón packte eins der Fässer, die mit Pökelfleisch gefüllt waren. Geschickt rollte er es auf die Luke.
„Was gafft ihr!“ herrschte er seine Männer an. „Packt gefälligst zu. Ein Faß allein reicht nicht.“
Entsetzt starrten sie ihn an.
„Heilige Madonna“, stieß Juan Lloberas hervor, „das ist – das ist – Mord!“
Der Sargento zuckte mit keiner Wimper und holte sich bereits das zweite Faß.
„Nennt es, wie ihr wollt“, knurrte er, „jetzt ist sich jeder selbst der Nächste.“
Als er das zweite Faß auf die Luke rollte, war plötzlich heftiges Pochen und Schlagen zu hören. Dann Schreie und Flüche. Die Luke hob sich um zwei Fingerbreit und sank wieder zurück.
Lloberas bekreuzigte sich.
„Dafür werden wir bestraft. Das kann nicht gutgehen. Bis ans Ende unserer Tage werden ihre Seelen uns verfolgen.“
„Hör auf mit dem Gefasel!“ fuhr Carrillón ihn an. „Was glaubst du, was die mit uns anstellen, wenn sie uns erwischen? Die würden uns zu Tode trampeln, totschlagen oder wer weiß noch was – damit sie nur ihre eigene Haut retten.“
Lloberas schüttelte den Kopf und blickte den Sargento ungläubig an, als hätte er auf einmal ein unbekanntes Wesen vor sich.
Romero, Béjar, Hurtado und Garcia hatten sich bereits überwunden, griffen nach den Pökelfleischfässern und rollten drei weitere auf die Luke. Ohne innezuhalten, wuchteten sie zwei zusätzliche Fässer obenauf.
„Das reicht“, sagte Carrillón. Er legte Lloberas die Hand auf die Schulter. „Überleg doch mal, Amigo: Was für einen Unterschied macht es? Die Kerle da unten müssen so oder so schwimmen, wenn der Kahn auseinanderbricht. Ob sie nun im Stauraum warten oder an Deck, ist doch egal.“
„Ich bin Soldat“, sagte Lloberas tonlos, „kein Meuchelmörder.“
„Na gut“, entgegnete Carrillón dröhnend, „dann bleib meinetwegen hier und stirb wie ein Soldat.“
„Nicht doch!“ rief Hurtado höhnisch. „So edelmütig wird er nun auch wieder nicht sein!“
Romero hieb mit der rechten Faust in die linke Handfläche. „Wenn ihr hier eine Weile debattieren wollt, dann sagt es nur!“
Carrillón nickte grimmig.
„Also, los jetzt. Lloberas, du kannst hierbleiben oder mitkommen. Keiner zwingt dich zu irgend etwas.“
Lloberas zögerte noch, doch schließlich schienen ihm die mißbilligenden Blicke seiner Kameraden bewußt zu werden. Er gab sich einen Ruck und zuckte mit den Schultern. Aus dem tiefergelegenen Stauraum waren noch immer Geschrei und Gepolter zu hören.
„Vielleicht bricht das Schiff gar nicht auseinander“, sagte Garcia tröstend, „dann bleiben die Burschen da unten sowieso am Leben.“
Lloberas antwortete nicht darauf, schweigend schloß er sich der Gruppe des Sargento an. Sie waren unbewaffnet, und allein deshalb stand fest, daß es noch eine Menge Hindernisse auf ihrem Weg geben würde.
Unbehelligt erreichten sie das Hauptdeck. Der Sturm traf sie wie eine Riesenfaust. Gischt und überkommende Seen warfen sich wie gierige Raubtiere über sie und hätten sie auf die Planken geschleudert, wenn da nicht die rettenden Manntaue gewesen wären.
Eine Bö riß Hurtado fast von den Füßen, und er verlor die Ölfunzel, als er haltsuchend nach einem der Taue griff. Die kleine Flamme erlosch im ablaufenden Wasser auf den Planken.
„Zusammenbleiben!“ brüllte Carrillón gegen den tobenden Sturm an. „Wir dürfen uns jetzt nicht verlieren, sonst schaffen wir es nicht!“
Die „Santa Teresa“ hatte bereits eine beträchtliche Schlagseite nach Steuerbord. Doch Carrillón betrachtete dies unter den gegebenen Umständen eher als günstig. Ein Beiboot an der Rahnock abzufieren, war im Wüten des Sturms schier unmöglich. Man mußte also eine der beiden Jollen über das Steuerbordschanzkleid wuchten. Und wenn sie das unbemerkt schafften, konnten sie noch von Glück reden.
Capitán Isidoro hatte die Achterdeckslaterne anzünden lassen. Doch keine Menschenseele war zu sehen. Carrillón Vermutete, daß sich die Offiziere in den Achterdecksräumen verkrochen hatten. Er stutzte, als er sich mit seinen Männern zur Kuhlgräting voranarbeitete. Nur noch eins der beiden Beiboote war dort festgezurrt.
Einerlei. Es blieb keine Zeit zum überlegen. Jede Minute war kostbar. Selbst wenn sich Offiziere und auch Decksleute in Sicherheit gebracht hatten, würde doch das Verschwinden der sechs Seesoldaten nicht unbemerkt bleiben.
Sturm und überkommende Seen erschwerten jeden ihrer Handgriffe, als sie das Boot aus den Tauen lösten. Für Carrillón bedeutete dies nur den Trost, daß auch alle anderen an Bord der „Santa Teresa“ gleichermaßen behindert würden, falls sie die Flucht zu vereiteln suchten.
Doch es gelang ihnen, die Jolle über die Manntaue hinweg bis zum Schanzkleid rutschen zu lassen. Und dann genügte ein kraftvoller Ruck, um das Boot in die Fluten zu befördern, die nur wenige Fuß tiefer brodelten. Carrillón hielt die Fangleine der Jolle mit beiden Fäusten und stemmte sich gegen das Schanzkleid.
„Bewegt euch!“ brüllte er.
Romero und Béjar sprangen als erste hinüber, stolperten und klammerten sich an den Duchten der tanzenden Nußschale fest. Hurtado und Lloberas folgten, dann Garcia.
Garcia geriet mit dem Fuß auf das Dollbord. Niemand konnte in der Dunkelheit genau sehen, wie es geschah. Plötzlich gellte sein Schrei. Er ruderte haltsuchend mit den Armen, als er ausglitt. Lloberas warf sich herum und wollte ihn packen, doch seine Hände griffen ins Leere.
Garcias Schrei erstickte schlagartig, als er im weißschäumenden Wasser an der Bordwand der Galeone versank.
Carrillón sprang mit einem mächtigen Satz hinüber in das Beiboot.
„Garcia!“ schrie Lloberas mit sich überschlagender Stimme. „Mein Gott, wir müssen etwas tun, wir können doch nicht zusehen …“
Carrillón versetzte ihm einen Stoß, der ihn auf die vordere Ducht beförderte.
„Pullt, ihr Narren! Da gibt es nichts mehr zu tun. Wir bringen uns nur selbst in Gefahr. Der Mann ist längst in die Tiefe gerissen worden – vielleicht mit dem Kopf gegen die Bordwand geknallt. Nehmt die Riemen und pullt, verdammt noch mal!“
„Das ist ein Gottesurteil!“ heulte Lloberas. „Ein Zeichen, daß auch wir bestraft werden!“
Im nächsten Moment verstummte er, denn an Bord der „Santa Teresa“ wurde Gebrüll laut. Man hatte ihre Flucht bemerkt. Doch zu spät. Mit aller Kraft legten sich Carrillóns Männer in die Riemen und schafften es, Abstand von der Galeone zu gewinnen. Schußwaffen konnten Isidoro und die anderen nicht einsetzen, denn die Nässe verdarb jede Pulverladung.
Carrillón, der auf der Achterducht kauerte und die Ruderpinne mit eiserner Hand hielt, drehte sich nicht um. Er wußte, daß die Dunkelheit sie schützte. Dann, wenig später, übertönte das Heulen des Sturms jeden anderen Laut. Das Gebrüll von der „Santa Teresa“ war nicht mehr zu hören.
Carrillón stieß einen Triumphschrei aus, und die anderen stimmten mit ein. Doch sie wußten auch, daß sie noch lange nicht in Sicherheit waren. Jederzeit konnten sie vom Sturm gepackt und auf eines der Riffe geschleudert werden. Das Boot hob und senkte sich im Wellengang, und sie hatten das Gefühl, daß der Erfolg ihres Pullens gleich Null war. Aber sie waren sich auch darüber klar, daß sie den entfesselten Naturgewalten hoffnungslos ausgeliefert sein würden, sobald ihre Kräfte nachließen.
Sie zuckten zusammen, als es plötzlich einen harten Schlag gegen den Bootsrumpf gab. Einen Moment erstarrten sie vor Schreck, glaubten das Ende nahe und waren versucht, aufzugeben.
„Pullt weiter!“ brüllte Carrillón. „Verdammt noch mal, reißt euch zusammen!“
Sie gehorchten und verdoppelten ihre Anstrengungen. Der Sargento starrte nach außenbords. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, und er erkannte, daß es sich nicht um ein Riff handelte, auf das sie gekracht waren. Etwas Helles trieb vorbei und kreiselte gleich hinter dem Spiegel der Jolle in einem Strudel.
Carrillón sah, daß es sich um Bootsplanken handelte, zersplittert und nur noch lose zusammengehalten. Ihm wurde klar, was mit dem ersten Beiboot der „Santa Teresa“ geschehen war. Die Decksleute hatten versucht, es zu Wasser zu bringen. Dabei war es vom Sturm gepackt worden und zerschellt.
Carrillón preßte die Zähne aufeinander, daß es knirschte. Alles hing davon ab, daß sie durchhielten – und der Teufel mochte wissen, wie lange. Sobald ihre Kräfte erlahmten und sie sich vor Erschöpfung gehenließen, würden sie ein Opfer der tobenden Gewalten werden. Der Sargento duckte sich so tief wie möglich, um den tückischen Böen wenig Angriffsfläche zu bieten. Ob es ihm gelang, die Jolle auf Kurs zu halten, stand in den Sternen. Aber es reichte schon, wenn sie sich nur von der „Santa Teresa“ entfernten. Denn dorthin durften sie niemals und unter keinen Umständen zurückkehren. Es würde ihren sicheren Tod bedeuten – nicht anders, als wenn sie auf die offene See hinausgetrieben wurden.
Immer wieder mußte Carrillón die vier Männer auf den Duchten antreiben. Es war eine höllische Schinderei, das wußte er. Der Sturmwind fauchte und orgelte über sie hinweg, klatschte Gischt wie mit tausend feinen Nadeln in ihre Gesichter und versuchte, mit zunehmend heftigeren Böen das Boot zum Kentern zu bringen.
Der Sargento und seine Männer verloren jegliches Zeitgefühl. In der Dunkelheit und in der Hölle der tosenden Wasser fühlten sie sich so einsam wie nie zuvor in ihrem Leben. Sehr bald beschlich sie ein Gefühl von Mattigkeit und beginnender Gleichgültigkeit, gegen das sie nur noch mühsam ankämpften.
Doch Carrillón war es, der sie mit seinem Gebrüll immer wieder aufschreckte und ihnen das drohende Ende deutlich vor Augen hielt. Jedesmal gelang es ihm, ihre schwindenden Kraftreserven zu mobilisieren. Doch immer kürzer wurden die Abstände, in denen er sie wachrütteln mußte.
Irgendwann in dieser Stunde, die wie eine Ewigkeit war, knirschte der Kiel des Bootes plötzlich auf Grund. Die Männer begriffen nicht sofort und pullten weiter, als säße ihnen nach wie vor der Gehörnte im Nacken. Doch dann, als auch die Riemenblätter den Grund berührten, erwachten sie jäh aus ihrer dumpfen Erschöpfung.
Felipe Romero begriff es als erster und sprang auf.
„Land!“ schrie er mit sich überschlagender Stimme. „Land, Land! Wir haben es geschafft!“
Eine heranrollende Welle hob das Boot höher ans Ufer, und Romero kippte vornüber zwischen seine Kameraden Lloberas und Hurtado. Vor Freude grölend, lösten sich die Männer aus dem Durcheinander.
Auch Carrillón stimmte jetzt mit ein und ließ sich von dem Freudentaumel gefangennehmen. Dann sprangen sie hastig nach außenbords, tauchten mit ihren nackten Füßen ins seichte Uferwasser und beeilten sich, die Jolle an Land zu ziehen, bis sie vor den gierigen Wogen in Sicherheit war.
Carrillón und die vier Soldaten schafften es noch, den Schutz eines mächtigen Felsvorsprungs zu suchen. Dann sanken sie erschöpft nieder. Keiner von ihnen dachte noch daran, zu ergründen, wo sie sich befanden.
6.
Es war zwei Uhr morgens, als der Sturm endlich abflaute.
Auf der „Isabella“ und auch auf der „San Donato“ wurde es lebendig. Niemand hatte im Toben des Sturms auch nur ein Auge zugetan, und jeder war froh, sich jetzt an Deck begeben und die Nase in die frische Luft recken zu können.
Marcos’ Tip hatte sich als goldrichtig erwiesen. Die Wassermassen des Lake Pontchartrain hatten sich rascher beruhigt als die offene See. Überdies war die Bucht in der Tat ein hervorragend geschützter Liegeplatz. Die beiden Schiffe wiegten sich nur noch in den Wellen, die bereits in eine sanfte Dünung übergingen.
Noch waren die „Isabella“ und die „San Donato“ von stockfinsterer Nacht umgeben. Aber die Luft war so klar und rein, daß jeder der Männer es genoß, sie tief in die Lungen zu pumpen. Auch war der wolkenbruchartige Regen vorüber, der in der letzten Phase des Sturmwinds eingesetzt hatte.
Soweit das zu erkennen war, hatte die „Isabella“ das Wüten der Naturgewalten einigermaßen unbeschadet überstanden. Die Qualitätsarbeit, die der alte Hesekiel Ramsgate auf seiner Werft in Plymouth geleistet hatte, bewährte sich immer wieder. Doch den Spuren des Sturms begegneten die Arwenacks auf Schritt und Tritt. Überall auf den Decks lagen Zweige, Äste und Blattwerk verstreut – herübergewirbelt vom nahen Ufer.
Helle Nebelschwaden trieben vom Land her über die Wasseroberfläche. Es schien, als atmete die üppige Vegetation diesen Nebel aus.
Der Seewolf riskierte nicht, die Bordlaternen anzünden zu lassen. Auch auf der Galeone der Timucua blieb es dunkel. Immerhin mußte man damit rechnen, daß sich der Feind in der Nähe befand. Niemand konnte ahnen, welche Kursentscheidungen die Dons getroffen hatten. Daran, daß auch sie die Einfahrt zum Lake Pontchartrain kannten, bestand kein Zweifel.
Gemeinsam mit Ben Brighton begab sich Hasard auf das Achterdeck, wo sich bereits Big Old Shane, Ferris Tucker, Smoky und Old Donegal Daniel O’Flynn in der Nähe der Heckbalustrade versammelt hatten.
„Auf jeden Fall brauchen wir ein besseres Versteck“, sagte Ben Brighton, „wenn sie schlau sind, werden die Spanier den gesamten Uferbereich dieses Sees abklappern. Hier können wir also nicht bleiben.“
„Bis zum Morgengrauen haben wir Zeit“, entgegnete der Seewolf, „vorher können auch die Dons nichts unternehmen.“
Unvermittelt wurde das Gespräch der Männer unterbrochen, noch bevor es richtig begonnen hatte.
„Still!“ rief der alte O’Flynn mit unterdrückter Stimme. „Hört ihr das?“
Hasard und die anderen horchten angestrengt. Der Wortwechsel der Arwenacks auf der Kuhl und auf der Back brach indessen nicht ab, so daß nicht auf Anhieb festzustellen war, was der Alte meinte.
Doch Sekunden später drang es ihnen allen um so deutlicher ins Gehör.
Die Laute schienen aus dem Nichts zu kommen – schaurige Laute, die sich über dem Wasser ins Unendliche fortpflanzten. Klang es anfangs wie das schmerzerfüllte Stöhnen eines unsichtbaren Wesens, ging es bald in ein jämmerliches Klagen über. Dann wieder wechselte es in ein herzzerreißendes Seufzen, und schließlich folgte als Untermalung gar ein leises Singen.
Inzwischen verstummten auch die Gespräche auf der Kuhl und auf der Back.
„Wißt ihr, was das ist?“ flüsterte der alte O’Flynn in die Stille hin. Seine Stimme klang rauh und vibrierend vor Aufregung. „Das sind die ruhelosen Seelen von Verstorbenen. Die Naturgewalten haben sie aufgeschreckt, und jetzt beginnt für sie eine verzweifelte Wanderung voller Irrwege. Ich habe so was schon mal erlebt, das war damals in der Karibik, als …“
„Halt’s Maul, Donegal“, sagte Smoky grob.
Der Decksälteste drückte auf wenig zartfühlende Art aus, was alle anderen ebenso empfanden: Niemand legte Wert auf die immer gleichen Gruselgeschichten Old O’Flynns. Denn zeigte jemand auch nur einen Hauch von Interesse, dann legte er erst richtig los und war nicht mehr zu bremsen.
„Mann“, sagte Ferris Tucker kopfschüttelnd, „ist doch wohl klar, was das ist. Das sind die Kranken auf der ‚San Donato‘. Kaum vorzustellen, was die armen Leute durchgestanden haben. Für sie war der Sturm bestimmt schlimmer als für uns.“
Wie zur Untermalung seiner Worte ertönte ein erneutes schauerliches Stöhnen, durchdringender und weithallender diesmal.
„Einfaltspinsel“, sagte Old O’Flynn gereizt, „nie im Leben sind das die Fieberkranken. Ihr wollt bloß mal wieder nicht wahrhaben, daß es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die wir mit unserem armseligen Menschenverstand nicht kapieren.“
Der Seewolf beschloß, dem beginnenden Gezänk ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Er trat an die Steuerbordverschanzung des Achterdecks und formte mit den Händen einen Trichter vor dem Mund.
„Marcos! Hören Sie mich? Marcos!“
Der Spanier antwortete prompt, und er hatte auch die Stimme des Seewolfs sofort erkannt.
„Ja, ich höre Sie, Señor Killigrew!“
Durch Nebel und Dunkelheit klang Marcos’ Stimme ebenfalls wie aus dem Nichts und vereinte sich mit dem fortdauernden schaurigen Stöhnen und Klagen.
„Was sind das für Geräusche?“ rief Hasard. „Sind das die Kranken auf Ihrem Schiff, Marcos?“
„Wir hören es auch, Señor Killigrew, und wir können es uns nicht erklären. Unsere Kranken sind mucksmäuschenstill.“
„Sind Sie absolut sicher?“
„Es gibt keinen Zweifel, Señor Killigrew. Was sollen wir tun?“
„Vorerst nichts.“
Betroffenes Schweigen breitete sich auf dem Achterdeck der „Isabella“ aus.
Währenddessen schwollen die unheimlichen Geräusche an.
„Hört ihr?“ tönte Old O’Flynns krächzendes Organ voller Triumph. „So geht es Burschen, die immer alles besser wissen. Jetzt schaut ihr schön dumm aus, was?“
Niemand antwortete.
Die klagenden und stöhnenden Stimmen und der seltsame Singsang wurden plötzlich von dumpfen Trommelwirbeln begleitet.
Kurz darauf waren Lichter zu sehen. An verschiedenen Stellen flammten sie auf, allem Anschein nach bewegten sie sich aus dem Nebel heraus auf die beiden ankernden Galeonen zu.
Auch dem alten O’Flynn verschlug es jetzt die Sprache. Die Arwenacks standen regungslos, und es gab keinen unter ihnen, dem nicht mulmig zumute wurde. Was, zum Teufel, braute sich da zusammen?
Selbst Hasard konnte sich eines gewissen Unbehagens nicht erwehren. Einen Gegner, den man sah, konnte man packen. Aber dies hier war alles andere als greifbar.
Etwas Unerklärliches nahm seinen Lauf.
Von Minute zu Minute wurden die sonderbaren Stimmen und die Trommeln lauter. Die Lichtpunkte verstärkten sich. Sie waren durch den Nebel von mattschimmernden kleinen Kreisen umgeben.
Keiner an Bord der „Isabella“ dachte daran, sich zu verkriechen. Aber es gab auch keinen unter den Arwenacks, dem sich nicht die Nackenhaare sträubten. Eine Spur von Aberglaube schlummerte letztlich in jedem von ihnen – und die Neue Welt war schließlich noch nicht vollständig erforscht.
Eine fremde Umgebung, Dunkelheit, Nebel – und dann noch diese unerklärlichen Laute, das war schon eine verdammte Menge, wenn man alles auf einmal verdauen wollte.
Der Seewolf zögerte nicht länger. Vorsorglich gab er Befehl, klar zum Gefecht zu gehen. Die Männer waren froh, etwas tun zu können und den rätselhaften Dingen nicht stumm und duldsam entgegensehen zu müssen.
Auch den Timucua und ihren spanischen Begleitern war der Schreck gehörig in die Knochen gefahren. Hasard verständigte sich mit Marcos, und sie einigten sich darauf, daß die Indianer lediglich die an Bord der „San Donato“ verfügbaren Musketen luden. Mit den Langwaffen konnten sie umgehen, wenn es sein mußte.
Als hätte ihnen die Natur ein Zeichen gegeben, erwachten Pedro Carrillón und seine Soldaten, kaum daß der Sturm abgeflaut war.
Schnatternd vor Kälte rappelten sie sich auf. Es war die Müdigkeit, die sie frieren ließ. Und nach dem kurzen Schlaf spürten sie die mörderische Schinderei noch in allen Knochen.
Der Sargento ließ ihnen nicht viel Zeit zum Lamentieren. Jeweils zu zweit schickte er sie los, Romero und Béjar, Hurtado und Lloberas. Während die Männer auf Erkundung gingen, blieb Carrillón allein beim Boot. Es war das Wichtigste, was sie besaßen. Durch keinen noch so unwägbaren Umstand durften sie diesen Besitz aufs Spiel setzen.
Die vier Soldaten kehrten fast zur selben Zeit zurück. Und es bestätigte sich, was Carrillón vermutet hatte. Es handelte sich um ein winziges felsiges Eiland, auf dem sie gelandet waren. Wenigstens das hatten die Männer trotz der Dunkelheit feststellen können.
„Wir müssen sofort hier weg“, sagte der Sargento kurz und bündig.
Die anderen protestierten.
„Können wir nicht wenigstens noch ein paar Stunden schlafen?“ fragte Romero.
„Es reicht doch, wenn wir uns im Morgengrauen nach einer besseren Gegend umsehen“, fügte Lloberas hinzu.
„Nein, es reicht nicht“, widersprach Carrillón rauh. „Capitán Isidoro und unserem Teniente traue ich alles zu. Die bringen es fertig und zimmern ein Floß zusammen – nur, damit sie uns erwischen können. Außerdem gibt es noch einen anderen Grund, der genauso wichtig ist: Wir finden auf dieser verdammten Felseninsel nichts zu essen und nichts zu trinken. Deshalb können wir uns nicht leisten, hier unnötige Zeit zu verschwenden. Wir brauchen etwas Kräftiges. Verstanden?“
„Und wohin?“ fragte Béjar murrend. „Wie sollen wir uns denn orientieren?“
„Die Wolkendecke reißt auf“, erwiderte der Sargento, „wir richten uns nach den Sternen und versuchen, das Festland zu erreichen.“
„Nach den Sternen?“ entgegnete Hurtado zweifelnd. „Funktioniert das?“
„Zerbrich dir nicht meinen Kopf“, knurrte Carrillón, „es gibt eben gewisse Unterschiede zwischen einem Sargento und einem gemeinen Soldaten.“
Die anderen grinsten, aber das konnte Carrillón in der Dunkelheit nicht sehen. Er trieb sie voran. Da sie nichts bei sich hatten, weder Waffen noch Ausrüstung oder zusätzliche Kleidung, ging ihr Aufbruch im Handumdrehen vonstatten. Keuchend schoben sie die schwere Jolle über den felsigen Untergrund und ließen sie ins Uferwasser gleiten.
Als wollten sie für das wilde Wetter der zurückliegenden Stunden um Vergebung bitten, waren die Fluten jetzt ruhig und sanft. Nur noch eine leichte Brise strich über die Wasseroberfläche und trieb wattige Nebelschwaden vor sich her.