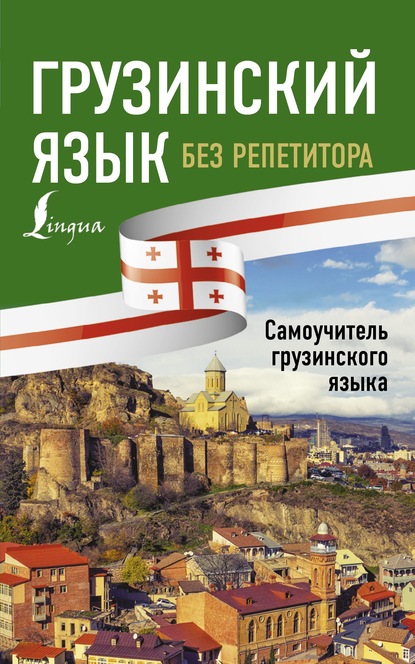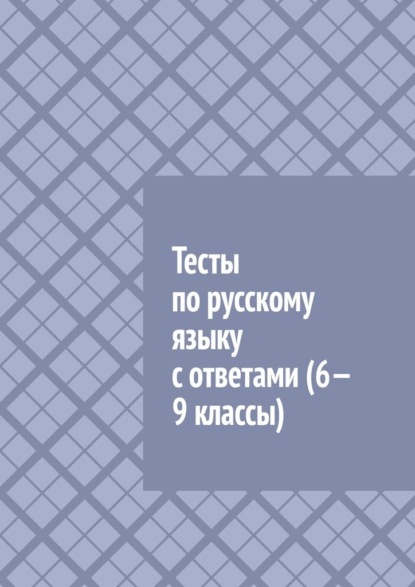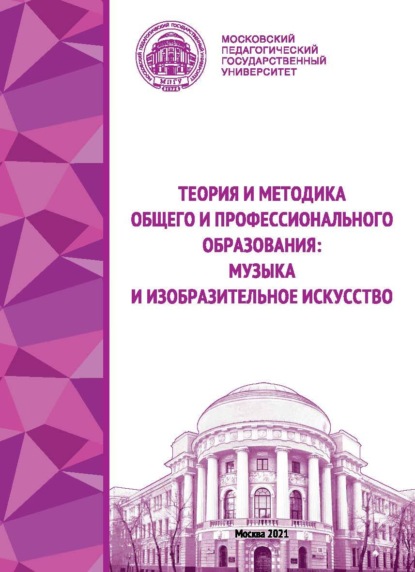Seewölfe Paket 18

- -
- 100%
- +
Die Männer fluchten und zeterten. Denn die ungewohnte Arbeit des Pullens fiel ihnen doppelt schwer, nachdem sie geglaubt hatten, sich von den Strapazen während des Sturms erst einmal ausgiebig erholen zu können.
Aber Carrillón ließ nicht locker. Immer wieder trieb er sie zu höherer Schlagzahl an. Indessen gab er mit keiner Silbe zu, daß ihm die Orientierung mehr Schwierigkeiten bereitete, als er angenommen hatte. Zwar wußte er einiges über den Stand der Gestirne, und er hatte in seiner Laufbahn als Unterführer auch etliche schwierige Aufgaben dieser Art bewältigt. Doch das hatte sich meist zu Lande abgespielt. Als Seesoldat hatte sich Pedro Carrillón naturgemäß auf die navigatorischen Fähigkeiten der jeweiligen Schiffsführung verlassen.
Was ihn irritierte, war vor allem der Nebel, der sich mehr und mehr verdichtete und entsprechend seltener einen Blick zum aufklarenden Nachthimmel erlaubte. Carrillón hatte den Eindruck, daß er die Sterne nach jeder Nebelbank aus einem völlig anderen Blickwinkel sah. Er begriff zwar, daß er einer Sinnestäuschung unterlag. Doch er vermochte nichts gegen das verwirrende Gefühl der Verlorenheit zu tun, das ihn immer dann befiel, wenn sie für scheinbare Ewigkeiten vom Nebel umgeben waren.
Dennoch hielt er die Ruderpinne unbeirrbar, und er war auch überzeugt, daß er den Nordkurs im großen und ganzen einhielt. Wenn die Männer ein oder zwei Stunden länger pullen mußten, so war das eben Pech für sie. Aber er verhalf ihnen letzten Endes zur Freiheit. Das mußten sie mehr zu schätzen wissen als alles andere.
Abermals traf es sie wie aus heiterem Himmel, als der Kiel der Jolle plötzlich auf Grund knirschte.
Carrillón unterdrückte im letzten Moment einen Fluch. Er wußte genau, daß sie das Festland noch nicht erreicht haben konnten. Es konnte sich also nur um eine dieser verdammten Inseln handeln. Aber die anderen brauchten nicht zu wissen, daß er seiner Sache längst nicht mehr sicher war, was den Kurs betraf.
Ohnehin hatten sie kein Verlangen danach, jetzt solche Einzelheiten zu ergründen, die für sie nebensächlich waren. Ermattet sanken sie auf den Duchten in sich zusammen.
„Endlich“, sagte Béjar schnaufend, „lange hätte ich das auch nicht mehr durchgehalten.“
„Schlafen, endlich schlafen.“ Hurtado war es, der es mit träger Stimme hinzufügte.
„Spinnt ihr?“ schrie Carrillón aufgebracht. „Wir sind noch längst nicht am Ziel. Los, los, raus aus dem Kahn und an Land damit! Eine Pause können wir meinetwegen einlegen, aber mehr auch nicht.“
„Heißt das, wir sind noch gar nicht an der Küste?“ rief Romero ärgerlich. „Ich denke …“
„Das Denken sollst du mir überlassen“, unterbrach ihn der Sargento barsch, „bei dem verdammten Nebel findet sich selbst der beste Seefahrer nicht zurecht. Wir haben wieder eine von diesen Inseln erwischt. Bis zur Küste brauchen wir jetzt aber nur noch eine Stunde.“ Er behauptete es, obwohl er weder in dem einen noch in dem anderen Punkt wirklich sicher war.
Widerstrebend verließen die Männer das Boot und zogen es durchs seichte Wasser hinauf an den Strand. Immerhin, so stellten sie fest, hatten sie es diesmal nicht mit einem unwirtlichen Felseneiland zu tun. Der Boden unter ihren Füßen war weicher Sand. Vielleicht gab es weiter landeinwärts Pflanzenwuchs und sogar Tiere. Dann bestand immerhin die Hoffnung, daß man endlich den knurrenden Magen besänftigen konnte.
Keuchend ließen sie sich neben dem Boot in den Sand sinken. Jetzt, da sie zur Ruhe gelangten, spürten sie die Ermattung in allen Knochen. Innerhalb von Minuten waren sie im Begriff, in einen sanften Schlaf hinüberzudämmern. Auch Pedro Carrillón bildete keine Ausnahme.
So begriffen sie nicht sofort, als plötzlich knirschende Schritte und rauhe Stimmen zu hören waren.
Nur wie aus endloser Ferne nahmen sie es wahr. Ihr Bewußtsein, schon vom Schlaf umwölkt, signalisierte die Gefahr nicht.
Erst als ihn ein heftiger Schmerz von der linken Körperseite her durchzuckte, fuhr Carrillón hoch. Er schrie auf, blinzelte und versuchte krampfhaft, die Augen aufzureißen.
Da war das Licht einer Öllaterne, das ihn blendete. Bevor er weitere Einzelheiten erfaßte, traf ihn ein zweiter Fußtritt.
Der Sargento krümmte sich und stöhnte vor Schmerz.
„Hoch mit euch, ihr trüben Figuren!“ befahl eine schneidende Stimme auf französisch.
Auch die anderen waren inzwischen auf ähnlich schmerzhafte Weise in die Wirklichkeit zurückgerissen worden. Mit schreckensweiten Augen sahen sie, daß sie von mehr als einem Dutzend schwerbewaffneter Kerle umringt waren. Drei oder vier Ölfunzeln erhellten die beklemmende Szenerie.
Der, der dem Sargento die Fußtritte verpaßt hatte, war ein schlanker Mann mit schmalen, tückisch blickenden Augen. Er trug einen dunklen breitkrempigen Hut, darunter waren schulterlanges strähniges Haar und ein sichelförmig herabhängender Schnauzbart zu erkennen.
Zitternd vor Kälte und vor Schreck gehorchten die fünf Seesoldaten und richteten sich an der Längsseite des Bootes auf.
Der Schnauzbärtige hatte seinen Säbel gezogen und ließ die breite Klinge im Lampenlicht funkeln.
„Mein Name ist Duvalier“, sagte er in seinem kehlig klingenden Französisch, „falls ihr noch nichts von mir gehört habt, werdet ihr um so mehr bedauern, mit mir Bekanntschaft schließen zu müssen.“
Die anderen Kerle, samt und sonders verwegen aussehende Gestalten, stimmten ein rauhes Gelächter an. Duvalier brachte sie mit einer herrischen Handbewegung zum Schweigen.
„Wer ist euer Anführer?“ schrie er die Spanier an.
„Ich“, sagte Carrillón gepreßt, „Sargento Pedro Carrillón. Wir sind Seesoldaten im Dienst seiner Allerkatholischsten Majestät, König Philipp von …“
Brüllendes Gelächter unterbrach ihn.
„Spar dir deinen Quatsch, Spanier!“ rief der Anführer der Franzosen. „Euer allerkatholischster Philipp interessiert uns einen feuchten Dreck. Im übrigen“, er trat einen Schritt vor und hielt Carrillón die Spitze der Säbelklinge gegen die unbekleidete Brust, „seht ihr nicht aus wie Seesoldaten, die sich im Dienst befinden.“ Ein lauernder Ausdruck trat in Duvaliers Augen. „Könnte es sein, daß ihr euch ein bißchen verdrückt habt?“
Carrillón verschluckte sich fast. Sein Gesicht wurde weiß, und das lag nicht nur an dem verdammten Säbel. Nein, es war die Gewißheit, daß dieser elende Schnapphahn ihn und die anderen bis auf die Knochen durchschaute.
Dennoch brauchte Carrillón den Beleidigten nicht zu spielen. In der Tat fühlte er sich in seiner Ehre gekränkt. Welches Recht hatte dieser französische Galgenstrick, sich in seine persönlichen Belange einzumischen?
„Wir sind Schiffbrüchige“, sagte Carrillón empört, „und ich verbitte mir auch im Namen meiner Männer diese Behandlung.“
Duvalier grinste bis zu den Ohrläppchen. Er ließ den Säbel sinken.
„Von einer Behandlung kann überhaupt noch keine Rede sein, Spanier. Falls wir euch in die Mangel nehmen müssen, wirst du noch genug Grund haben, dich zu beklagen.“
Abermals brach die Meute in wieherndes Lachen aus.
„Ich verlange eine Erklärung“, sagte Carrillón standhaft, „wir sind unbewaffnet und haben keine feindlichen Absichten. Ich verlange, daß wir als Schiffbrüchige respektiert werden.“
„Das hast du fein gesagt“, erwiderte Duvalier mit anhaltendem Grinsen, „keine Sorge, mein Freund, wenn du weiterhin so redselig bist, werden wir keine Schwierigkeiten miteinander haben. Na gut, beenden wir das Palaver fürs erste. Für unsere weitere Unterhaltung suchen wir uns ein gemütlicheres Quartier.“
Der Franzose wandte sich ab und schob den Säbel in die Scheide, ohne den Sargento und die vier anderen Spanier noch eines Blickes zu würdigen. Wortlos setzte sich Duvalier an die Spitze seiner Leute und bedeutete ihnen mit einem knappen Handzeichen, die angeblichen Schiffbrüchigen auf Trab zu bringen.
Carrillón zweifelte keine Sekunde daran, daß sie Piraten in die Hände gefallen waren. Auf den Inseln vor der Mississippi-Mündung trieb sich Gesindel aller Art herum. Den spanischen Verbänden war es bislang nie recht gelungen, hier für Ordnung zu sorgen. Ein Jammer!
Carrillón bedauerte in diesem Moment zutiefst, daß die in diesem Teil der Neuen Welt stationierten Einheiten Seiner Allerkatholischsten Majestät nicht häufiger zu Strafexpeditionen aufgebrochen waren. Daran, daß er aus eben jener dienstlichen Gemeinschaft desertiert war, dachte Carrillón in diesem Zusammenhang nicht.
Mit wüstem Gebrüll trieb die Piratenmeute ihre Gefangenen voran. An Fußtritten und Hieben von Musketenkolben mangelte es nicht. Carrillón mußte als erster marschieren. Ihm folgten Béjar und Hurtado, dann Romero und Lloberas.
Es geschah, als ihr Weg über weichen grasbewachsenen Boden bergan führte.
Wie es geschah, vermochte Carrillón später nicht mehr zu sagen. Er hörte nur die plötzlichen Alarmrufe und spürte einen Musketenlauf, der ihm auf schmerzhafte Weise in die Magengegend gerammt wurde. Nicht anders erging es Béjar und Hurtado.
Im blakenden Licht der Ölfunzeln waren die Silhouetten von Lloberas und Romero nur noch undeutlich zu sehen, wie sie davonhasteten.
Vier oder fünf Verfolger saßen ihnen mit wenigen Schritten Abstand im Nacken.
Carrillón schloß verzweifelt die Augen. Romero und Lloberas hatten einen Wahnsinnsentschluß gefaßt. Diese Flucht war von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Schreie gellten aus der Dunkelheit.
Carrillón riß die Augen auf.
„Nein!“ hauchte er entsetzt. „Nein, das ist unmenschlich.“
Die Todesschreie versiegten in einem Gurgeln. Dann war Stille.
Duvalier stand plötzlich vor dem Sargento.
„Ich hoffe, ihr drei habt bessere Nerven“, sagte er höhnisch. Mit einer Kopfbewegung befahl er seinen Gefolgsleuten, die Musketen wegzunehmen.
„Ihr hättet sie sowieso erwischt“, entgegnete Carrillón tonlos, „um Himmels willen, warum mußtet ihr sie gleich umbringen?“
„Zwei Esser weniger“, sagte Duvalier kalt, „laßt es euch eine Lehre sein. Hier, auf der Insel Comfort, gelten meine eigenen Gesetze. Wer nicht pariert, springt über die Klinge.“ Abermals wandte er sich abrupt ab und begab sich an die Spitze der Marschformation.
Béjar und Hurtado waren kalkweiß im Gesicht. Sie brachten keinen Ton hervor und sahen ihren Sargento nur fassungslos an.
Er senkte den Kopf und wich ihrem Blick aus. Natürlich bereiteten sie ihm Vorwürfe, einfältig wie sie waren. Aber er war nicht verantwortlich. Er hatte das Beste gewollt, ihnen die Flucht von der „Santa Teresa“ ermöglicht und versucht, sie in eine bessere Zukunft zu führen. Niemand konnte ihm einen Fehler vorwerfen. Was ihnen widerfuhr, war eine böse Fügung des Schicksals.
Die Kerle, die Romero und Lloberas niedergestochen hatten, kehrten zurück. Im Laternenlicht, damit die Gefangenen es deutlich sehen konnten, wischten sie ihre Säbelklingen an den Hosenbeinen ab.
Duvaliers Befehlsstimme ertönte, und die Kolonne setzte sich wieder in Bewegung. Abermals wurden die Gefangenen mit derben Stößen und Tritten vorangetrieben.
Pedro Carrillón spürte die Schmerzen nicht. Zu sehr waren seine Sinne in Aufruhr. Er setzte einen Fuß vor den anderen, ohne sich dessen wirklich bewußt zu werden. Es war ein Gefühl, als führe dieser Weg ins Nichts.
Er begann zu bereuen, daß sie desertiert waren. Wie gern hätte er jetzt dem Teniente und Capitán Isidoro gemeldet, welches Lumpenpack auf der Insel Comfort hauste! Ein Kommandotrupp wäre losgeschickt worden, man hätte den Piratenschlupfwinkel aufgespürt, und dann wären diese verdammten französischen Galgenstricke mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden.
Carrillón wußte, daß es sich bei der Insel Comfort um eins jener vielen Eilande handelte, die den Bayous der Küste vorgelagert waren. Aber was nutzte ihm dieses Wissen jetzt noch? Es war zum Verzweifeln.
Nach einer knappen Viertelstunde erreichten sie eine windschiefe Bretterbude, die auf einer Anhöhe unter schützenden Bäumen stand. Das Hauptquartier der Piraten konnte es nicht sein, eher ein Unterschlupf, den sie vermutlich auf Kontrollgängen benutzten.
Duvalier ließ zwei Laternen in der Hütte aufhängen, und die Gefangenen wurden hereingebracht. Außer ein paar wackligen Schemeln gab es nur Staub und Spinnengewebe.
Carrillón, Béjar und Hurtado erhielten Befehl, sich in der Mitte der schäbigen Behausung auf den Boden zu hocken. Hinter ihnen nahmen vier Piraten als Bewacher Aufstellung, der Rest der Galgenvögel harrte draußen aus. Duvalier nahm sich einen Schemel und setzte sich den Gefangenen gegenüber. Sie waren gezwungen, zu ihm aufzublicken.
„Die Plauderstunde ist eröffnet“, sagte der Franzose grinsend, „ich denke, ich brauche euch nicht zu erzählen, was passiert, wenn ihr die Zähne nicht auseinanderkriegt.“
Carrillón sah Béjar und Hurtado an, und da war noch immer dieser stumme Vorwurf in ihren Augen.
„An mir soll es nicht liegen“, sagte der Sargento, „ich will nicht allein entscheiden. Ihr wißt, über was wir reden sollen. Also?“
„Jetzt machst du es dir leicht“, sagte Béjar erbittert, „jetzt, da wir sowieso keine Wahl mehr haben.“
Hurtado wandte sich an den Franzosen.
„Was geschieht mit uns, wenn wir alles erzählen?“
„Oh, ich sagte schon, daß wir keine Schwierigkeiten miteinander haben werden, wenn ihr gesprächig seid.“ Duvalier richtete den Blick zur Decke und preßte die schlanken Finger gegeneinander. „Ich bin kein Unmensch, müßt ihr wissen. Was ich nicht leiden kann, sind unnötige Probleme.“
Die drei Spanier einigten sich rasch.
„Es gibt nichts zu überlegen“, sagte Béjar leise, „jeder ist sich selbst der Nächste.“
Carrillón nickte nur. Die beiden Soldaten waren einfache Naturen, in der Tat. Es gab nichts Greifbares, auf das sie ihre Hoffnung gründen konnten. Duvalier hatte ihnen nichts versprochen. Und dennoch hofften sie.
„Fein, fein“, sagte Duvalier salbungsvoll, „dann fangt an. Was ist mit eurem Schiff geschehen, welchen Auftrag hattet ihr? Und so weiter, und so weiter. Laßt euch die Worte nicht aus der Nase ziehen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch.“ Er lachte gekünstelt, und die vier Bewacher stimmten pflichtschuldigst mit ein.
Béjar und Hurtado waren einverstanden, daß Carrillón auch diesmal die Rolle des Wortführers übernahm. Er berichtete von der Begegnung mit der „Galicia“, nachdem sie aus Pensacola ausgelaufen waren. Und er bemühte sich, jede Einzelheit von dem zu schildern, was sich anschließend abgespielt hatte. Duvalier war ein Mann, dessen Unwillen man nicht gern hervorrief, das spürte Carrillón. Er war kein Feigling, doch er mußte auch an seine beiden noch lebenden Gefährten denken. Sie waren diesem verfluchten Obergalgenstrick ausgeliefert, also mußten sie versuchen, ihn zufriedenzustellen.
Je länger der Sargento redete, desto gespannter wurde der Ausdruck in Duvaliers Augen.
„Moment“, unterbrach ihn der Franzose mit einer heftigen Geste, als Carrillón bei der Beschreibung des Schiffbruchs angelangt war. „Ich brauche die genaue Position. Wo ist das passiert?“
Der Sargento zog die Schultern hoch.
„Ich bin Soldat. Von Seefahrt verstehe ich nicht viel. Ich habe nur mitgekriegt, daß von den Chandeleur-Inseln die Rede war. Die ‚Santa Teresa‘ muß also auf ein Riff vor diesen Inseln gelaufen sein. Welche Insel und welches Riff – das weiß ich beim besten Willen nicht.“
Duvalier fixierte ihn minutenlang mit zornig funkelnden Augen. Dann blies er die Luft durch die Nase und winkte ab.
„Also gut. Nehmen wir an, du weißt es wirklich nicht genau …“
„Ich kann es beschwören. Was hätte ich davon, die Position der Galeone zu verheimlichen?“
„Unterbrich mich nicht, Spanier!“ Duvaliers Gesicht verzerrte sich vor Wut. Einen Moment sah es aus, als würde er die Beherrschung verlieren und sich auf den Sargento stürzen. Aber er beruhigte sich wieder und faltete die Hände über den Knien. „Was ist mit den beiden Schiffen geschehen, die ihr verfolgt habt?“
„Wir haben sie im Sturm aus den Augen verloren. Nein …“ Carrillón unterbrach sich, „das war schon vorher, als es dunkel wurde. Ich konnte zufällig ein Gespräch des Kapitäns und der Offiziere mithören. Sie vermuteten, daß die Engländer und die Indianer entweder im Lake Borgne oder im Lake Pontchartrain einen sicheren Ankerplatz suchen würden. Schließlich hat Capitán Isidoro ja auch diesen Kurs steuern lassen.“
„Nur mit dem Unterschied, daß er nicht besonders aufgepaßt hat“, sagte Duvalier grinsend. Er kniff die Augen zusammen und schien eine Weile intensiv nachzudenken.
Carrillón runzelte die Stirn. Unbehagen stieg plötzlich in ihm auf. Da war etwas im Gesichtsausdruck des Franzosen, das er sich nicht erklären konnte.
Carrillóns Unbehagen steigerte sich zur Angst. Das Gesicht des Piratenführers wurde für ihn zur Teufelsfratze.
Er verstand nicht, was die jähe Kopfbewegung Duvaliers zu bedeuten hatte.
Und ihm blieb keine Zeit mehr, es zu verstehen.
Carrillón nahm noch die schnelle Bewegung hinter seinem Rücken wahr. Ein scharfer, zischender Laut folgte.
Ein dumpfer, alles auslöschender Schlag schnitt sein Bewußtsein ab.
Pedro Carrillón war bereits tot, als auch Béjar und Hurtado unter grausamen Säbelhieben starben.
7.
Duvalier wandte den Blick von den Leichen.
„Schafft sie hinaus“, sagte er verächtlich.
Die Wachtposten beeilten sich, den Befehl auszuführen. Duvalier folgte ihnen bis in die offene Tür und rief seine beiden Unterführer zu sich.
In knappen Worten schilderte er, was er von den Gefangenen gehört hatte. Das Leuchten in den Augen der Männer zeigte ihm, daß sie haargenau so dachten wie er selbst. Dieser Fischzug versprach eine außergewöhnlich fette Beute.
„Also gut“, sagte Duvalier mit einer endgültigen Handbewegung, „wir brechen sofort auf. Was einem so dicht vor der Haustür beschert wird, soll man sich nicht durch die Lappen gehen lassen.“
Die Männer lachten heiser. In diesem Punkt hatte es zwischen Duvalier und ihnen noch nie Unstimmigkeiten gegeben. Sie waren Küstenhaie, und sie waren stolz auf sich selbst. Sie nahmen sich, was ihnen zwischen die Finger geriet.
Bis zu ihrem Schlupfwinkel, der sich an einer geschützten Bucht befand, brauchten sie nur eine knappe halbe Stunde.
Im Lager wurde Alarm geschlagen. Duvalier ließ alles wachtrommeln, was die Kojen abhorchte. Etliche der wüsten Gestalten standen nur schwankend auf ihren Beinen, als sie sich auf dem Sammelplatz an der Bucht zum großen Halbkreis formierten. Laternen wurden entfacht, und Duvalier stieg auf ein Podest aus leeren Fleischfässern, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.
„Herhören!“ rief er mit metallisch klingender Stimme. „Unsere Erwartungen haben sich bestätigt. Daß der Sturm uns allerdings auf einen Schlag drei fette Brocken liefern würde, war nicht vorauszusehen. Wir wären verdammte Narren, wenn wir uns nicht holen würden, was wir kriegen können. Deshalb brauche ich jeden Mann, der noch bei Verstand ist.“ In kurzen Zügen schilderte er, was er von den gefangenen Spaniern erfahren hatte.
Von den Unterführern ließ Duvalier anschließend die Alkoholseligen aussondern. Für den Einsatz konnte er keine Leute brauchen, die wirr im Kopf waren.
Schließlich waren es insgesamt sechsundfünfzig Kerle, die sich für die nächtliche Aufgabe rüsteten und Waffen und Munition klarierten. Fünf einmastige Schaluppen und zwei ebenfalls einmastige Pinassen wurden mit jeweils acht Mann besetzt und gingen sofort ankerauf.
Die See hatte sich beruhigt, der Sturm gehörte der Vergangenheit an. Duvalier kannte sich hervorragend aus, war über jede Untiefe im Bilde und hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, welche Riffs vor den Chandeleur Islands in Frage kamen.
Die Arwenacks begannen, an ihrem Verstand zu zweifeln.
Holle und Teufel, war ihnen denn jemals in ihrem Seefahrerleben das Herz in die Hose gerutscht? Nein, verdammt noch mal. Das war ihnen kein einziges Mal passiert. Sie fürchteten keinen Sturm und kein Gefecht. Sie hatten die Hinterhältigkeiten der Spanier in der Ostsee überstanden, und sie hatten den Intriganten am englischen Königshof die Zähne gezeigt. Und was den alten O’Flynn betraf, hatten sie über seine Gruselgeschichten immer nur lachen können.
Aber dies war anders, anders als alles, was sie bisher erlebt hatten.
Dieser sonderbare Spektakel, der aus Nebel und Dunkelheit herüberdrang, jagte ihnen doch tatsächlich eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken.
Warum, in aller Welt, brachen sie nicht in schallendes Gelächter aus und hatten ihren Spaß an der ganzen Geschichte?
Aber sie standen nur stocksteif an Deck, starrten hinaus auf den finsteren See und wurden immer wütender auf sich selbst.
Denn dieser elende Widerspruch ließ sie an ihrem Grips zweifeln. Entweder waren sie die hartgesottenen Arwenacks, die man auf allen Weltmeeren kannte, dann wurde es Zeit, daß sie sich überlegten, wie sie diesen lausigen Spuk auseinandernahmen. Oder sie waren alte Waschweiber, dann war es ratsam, daß sie sich in den entferntesten Winkel der „Isabella“ verkrochen.
Aber zu nichts von beidem konnten sie sich aufraffen.
Es zerrte höllisch an ihren Nerven, daß sie sich einfach selbst nicht mehr kannten.
Vielleicht lag es daran, daß sich der Teufelsspuk immer mehr näherte.
Die dumpfen Trommelwirbel drangen hohl aus dem Nebel und wurden von Sekunde zu Sekunde lauter. Das Klagen und Stöhnen steigerte sich zu einem Geheul, das ihnen durch Mark und Bein ging. Und der monotone Singsang, schrill und durchdringend, war nervenzerfetzender als alles andere.
Die Lichtpunkte waren mittlerweile größer geworden. Die Richtung, in der sie sich bewegten, ließ zumindest eins klar werden: Die gesamte Erscheinung zog offenbar direkt an der Seeseite der Bucht vorüber, in der die „Isabella“ und die „San Donato“ ankerten.
Wie es aussah, konnte der verdammte Zauber aber noch eine Ewigkeit andauern.
Unvermittelt erreichte der erste Lichtpunkt eine nachtschwarze Lücke zwischen zwei Nebelbänken.
Den Männern auf den beiden Galeonen stockte der Atem.
Mit dem Licht glitten plötzlich Konturen aus der milchigen Suppe heraus. Die Konturen nahmen Formen an, wie ein langsam entstehendes Bild.
Ein farbenprächtiges Haus war es, ganz aus Holz gebaut.
Doch – Hölle und Verdammnis – es schwebte über dem Wasser!
Ebenso schwebten auch die Lichter, die es umgaben.
Die Männer standen wie erstarrt. Mit weit aufgerissenen Augen ließen sie das Schreckensbild vorüberziehen, ohne auch nur den kleinen Finger rühren zu können. Keiner konnte verheimlichen, daß es ihn grauste.
Doch dann war es plötzlich Edwin Carberry, dessen Donnerstimme das Klagen, das Stöhnen, das Singen und das Trommeln übertönte.
„Himmel, Arsch und Zwiebelfisch! Jetzt reicht es. Dieser Scheißspuk geht mir gegen den Strich, jawohl! Wollen wir uns das noch länger bieten lassen, was, wie?“
Das dröhnende Organ des Profos war wie ein Auslöser.
Im nächsten Moment begannen auch die anderen zu fluchen. Rufe wurden laut, der Erscheinung auf den Grund zu gehen oder ihr eine Drehbassenladung zu verpassen.
Old Donegal Daniel O’Flynn hastete aufgeregt zur Querbalustrade des Achterdecks.
„Ihr verdammten Narren!“ schrie er. „Der Fluch wird euch treffen! Seid still, um Himmels willen! Die Mächte der Finsternis lassen nicht mit sich spaßen! Wollt ihr uns denn alle ins Verderben …“
Hasard war mit wenigen schnellen Schritten bei ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Jetzt reicht es, Donegal. Hör auf damit. Es ist nicht der richtige Augenblick.“
Von der Kuhl tönte wütendes Protestgebrüll herauf, das dem alten O’Flynn galt. Was einige Männer dem Alten an Freundlichkeiten zudachten, hätte jede zarte Seele in Ohnmacht fallen lassen.
„Was heißt hier – nicht der richtige Augenblick!“ Old Donegal wandte sich ruckartig um und fixierte den Seewolf mit blitzenden Augen. „Wenn es einen richtigen Augenblick gibt, dann diesen. Ich denke nicht daran, mich wegen dieser hirnrissigen Kakerlaken den dunklen Mächten ausliefern zu lassen.“ Mit anklagend ausgestrecktem Arm zeigte er zur Kuhl hinunter, wo die Arwenacks zwar nicht zu sehen, aber um so deutlicher zu hören waren.