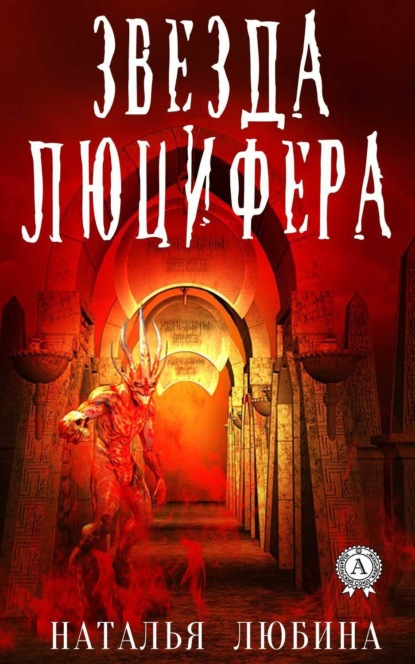Seewölfe Paket 18

- -
- 100%
- +
„Tut mir leid, Donegal“, sagte Hasard grob, „du hältst jetzt den Mund. Das ist ein Befehl.“
Er hörte den Alten schlucken, und es tat ihm leid, ihn so hart anfassen zu müssen. Aber er würde sein Räsonieren noch stundenlang fortsetzen, wenn man ihn nicht daran hinderte. Jetzt spürte der Alte an Hasards Ton, daß der Befehl ernstgemeint war. Jedes weitere Wort von ihm war folglich ein Verstoß gegen die Borddisziplin.
„Ruhe!“ brüllte der Seewolf, zur Kuhl gewandt. „Mister Carberry!“
„Sir?“ Tatsächlich kehrte sofort Stille ein.
„Schwing dich auf die Back und preie den Spuk an. Vielleicht reagiert das Ding darauf.“
„Aye, aye, Sir, Spuk anpreien. Wird sofort erledigt“, tönte der Reibeisenbaß des Profos zurück. Dann waren seine Schritte zu hören, als er in Richtung Back eilte und aufenterte.
Inzwischen war nur noch die Hälfte der schwebenden Behausung zu erkennen. Der vordere Teil wurde bereits wieder vom Nebel verschluckt.
Ed Carberry versuchte es erst auf englisch und dann auf spanisch. Jedesmal legte er eine Pause ein, doch es erfolgte keine Antwort. Zu guter Letzt kramte er seine französischen Sprachkenntnisse hervor.
„Hallo, missjöhs! Parleevu franzäs, gescherte missjöhs? Vu kompris, verdammt noch mal? Respondiert gefälligst, oder le diablo soll euch holen!“
Die denkwürdige Ansprache des Profos verhallte in der Dunkelheit.
Ohne Reaktion.
In der nächsten Minute war das schwebende Haus wieder im Nebel verschwunden. Nur noch die schwachen Lichtpunkte, das Klagen, das Stöhnen, der Singsang und die Trommelei erinnerten daran.
Ed Carberrys Schritte kehrten zur Kuhl zurück.
„Melde keinen Erfolg, Sir“, sagte er niedergeschlagen, „wenn sie das nicht verstanden haben, dann sind sie taub und stumm. Oder sie sind überhaupt keine richtigen Menschen.“
Einige der Arwenacks konnten sich ein unterdrücktes Kichern nicht verkneifen. Aber zum Glück konnte Ed Carberry in der Dunkelheit nicht feststellen, von wem es stammte.
Hasard mußte abermals für Ruhe sorgen. Dann gab er Befehl, die Hecklaterne anzuzünden. Sie alle hatten lange genug im Dunkeln gestanden. Wenn die Spanier tatsächlich in der Nähe sein sollten, dann wurde auch ihre Sicht durch den Nebel behindert. Es drohte also keine unmittelbare Gefahr.
Die Männer atmeten auf, als es heller wurde. Der verdammte Spuk und die Finsternis waren ihnen denn doch mächtig gegen den Strich gegangen.
„Seltsam an der ganzen Geschichte ist eines“, sagte Ben Brighton nachdenklich, „es waren überhaupt keine Menschen zu sehen.“
„Richtig“, entgegnete Hasard und nickte, „ich hatte den Eindruck, daß es nur farbige Lichter waren, die in den Fensterhöhlen glühten.“
„Aber wieso hat das Ding geschwebt?“ Ferris Tucker rieb sich sinnierend das Kinn.
Alle, auch der Seewolf, zogen ratlos die Schultern hoch.
Ein vernehmliches Räuspern war plötzlich zu hören, eher klang es wie ein Krächzen.
Hasard mußte grinsen.
Der alte O’Flynn stand demonstrativ beleidigt an der Steuerbordverschanzung und starrte auf die nachtdunkle Wasserfläche.
„Schieß schon los, Donegal“, sagte der Seewolf.
Old Donegal drehte sich mit gut gespieltem grenzenlosem Erstaunen um.
„Heißt das, du erteilst mir Redeerlaubnis, Sir? Soll es tatsächlich so sein, daß man auf diesem Schiff wieder seine Meinung sagen kann?“
„Wenn es sich um eine Meinung handelt – immer“, erwiderte Hasard, „aber es bleibt auch dabei, daß der Kapitän immer dann für Ruhe sorgen kann, wenn er es für angebracht hält.“
„Das habe ich jetzt begriffen“, entgegnete der Alte giftig, „früher waren wir mal eine harmonische Crew an Bord dieses Schiffes. Gut, gut, reden wir also in Zukunft nur noch, wenn wir gefragt werden.“
„Oh, was sind wir doch für harmonische Crewmitglieder!“ grölte Ed Carberry voller Vergnügen. Im nächsten Atemzug schlug er sich erschrocken die Hand vor den Mund. „Verzeihung, Sir, jetzt habe ich doch tatsächlich ohne Sprecherlaubnis getönt.“
„Nehmt mich ruhig auf den Arm!“ schrie der alte O’Flynn erbost, bevor der Seewolf ein Wort herausbringen konnte. „Eure Schandmäuler werden noch gestopft, darauf kann ich euch Brief und Siegel geben.“
„Mit Vampirblut geschrieben?“ rief Matt Davies kichernd.
„Auch dir wird das Lachen noch vergehen, Mister Davies!“ Old Donegals Zorn steigerte sich, und die Adern an seinen Schläfen schwollen an. „Ich sage euch, fordert das Schicksal nicht heraus! Hier auf dem Lake Pontchartrain geschehen Dinge, von denen wir nicht die leiseste Ahnung haben.“
„Soviel haben wir kapiert!“ rief Stenmark. „Ich denke, du kannst uns eine Erklärung liefern, Mister O’Flynn?“
Der alte Knochen betrachtete das prompt als eine ernste Frage.
„Selbstverständlich“, behauptete er würdevoll und hob den Kopf in den Nacken. „Was wir gesehen haben, war natürlich nicht von Menschenhand. Es war ein Trugbild, das der Satan persönlich uns vorgegaukelt hat. Und das, was ihr für Fensterhöhlen und Lichter gehalten habt, waren Teufelsaugen und Dämonenmäuler.“ Er blickte in die Runde, um sich von der Wirkung seiner Worte zu überzeugen. Tatsächlich hatten die meisten den Mund aufgesperrt, und alle blickten mit großen Augen zu ihm auf. Er wertete es als Zeichen, daß sie beeindruckt waren. „So, jetzt wißt ihr hoffentlich, woran ihr seid, wenn ihr die Mächte der Finsternis weiterhin mit euren ungehörigen Reden herausfordert.“
Old Donegal nickte noch einmal bekräftigend. Er verschränkte die Arme vor der Brust und nahm die Pose des Überlegenen ein.
Unvermittelt klatschte einer der Arwenacks in die Hände. Vom Achterdeck aus konnte man nicht erkennen, wer es war. Andere fielen mit ein, und nach wenigen Minuten ertönte donnernder Applaus.
Old Donegals Kinn sackte weg, und nun sah er haargenau so aus wie die anderen, als sie noch vor einem Moment zu ihm aufgeblickt hatten.
„Hast du fein hingekriegt, das!“ brüllte Batuti begeistert. „Richtig schön gruselig.“
„Das macht dir keiner so schnell nach“, fügte Luke Morgan hinzu.
„Weißt du was, Old Donegal?“ rief Ed Carberry dröhnend. „Wenn du deine Kneipe eröffnest, dann weiß ich den besten Namen dafür: ‚Zum Geisterseher‘! Ist das was, was, wie?“
Erneuter Beifall brandete auf.
Der alte O’Flynn wandte sich mit einem wütenden Ruck ab. Diesmal brauchte ihm niemand das Wort zu verbieten. Nichts sollten sie mehr von ihm hören, keinen Ton. Sollten sie mit ihrer Unverfrorenheit selig werden!
Ferris Tucker wollte hinter ihm her. Offensichtlich tat ihm Old Donegal leid, denn wie bei allen anderen Arwenacks verbarg sich auch unter der rauhen Schale des hünenhaften Schiffszimmermanns ein weicher Kern.
„Laß ihn in Ruhe, Ferris“, sagte der Seewolf lächelnd, „in seiner jetzigen Stimmung erreichst du überhaupt nichts. Er springt dir höchstens ins Gesicht.“
Ferris nickte und zuckte die Schultern.
„Wahrscheinlich hast du recht. Hoffentlich kapiert er irgendwann mal, was für einen Blödsinn er dauernd verzapft.“
„Auf diesem Schiff ist er damit vielleicht allein“, entgegnete Hasard, „aber sonst gibt es überall auf der Welt eine Menge abergläubische Leute. So absonderlich ist das nun auch nicht.“
„Verdammt, dann setzen wir ihn irgendwo an Land!“ rief Ed Carberry. „Dann kann er eine harmonische Crew von Abergläubischen gründen. O Mann, stellt euch das mal vor: Ein Dutzend Leute auf einem Haufen, und die faseln alle nur so ein wirres Zeug!“
Old Donegal Daniel O’Flynn hatte wieder seinen Platz an der Verschanzung eingenommen, kehrte ihnen allen den Rücken zu und konzentrierte sich darauf, in die Dunkelheit hinauszustarren.
Von neuem mußte der Seewolf die Lacher zur Ruhe bringen.
„Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen“, sagte er entschlossen, „ich will wissen, woran wir sind. Wer ist der gleichen Meinung?“
Es gab keinen auf der Kuhl, der nicht sofort die Hand erhob. Und auf dem Achterdeck war es nur der alte O’Flynn, der nicht ebenfalls für Hasards Vorschlag stimmte.
Alles Weitere spielte sich im Handumdrehen ab. Auf Hasards Anordnung wurde die kleine Jolle abgefiert. Als Bootsbesatzung teilte er Big Old Shane, Dan O’Flynn, Roger Brighton, Smoky, Stenmark und Ed Carberry ein. Wenig später enterte er gemeinsam mit den Männern über die Jakobsleiter ab.
Aus den Augenwinkeln heraus sah der Seewolf noch, wie Old Donegal ihnen mit entsetztem Gesichtsausdruck nachsah. Hasard konnte sich leicht vorstellen, daß der Alte fest davon überzeugt war, sie würden mitten in die Hölle pullen.
Für den Seewolf und die anderen war es indessen die einzig richtige Entscheidung. Sie brauchten klare Verhältnisse. Wo Mummenschanz getrieben wurde, konnten kaum die rechten Voraussetzungen bestehen, um die Fieberkranken zu heilen.
Dazu brauchte man vor allem Ruhe.
8.
Die „Santa Teresa“ schien ein bedrohliches Eigenleben entwickelt zu haben. Denn tief im Innern des Schiffes ächzte und knackte es an allen Ecken und Kanten, obwohl sich die See längst beruhigt hatte.
Gemeinsam mit seinem Ersten Offizier und dem Teniente, der die Seesoldaten befehligte, unternahm Don José Isidoro einen Inspektionsrundgang über die Decks.
Im untersten Stauraum waren die von den Deserteuren eingeschlossenen Männer inzwischen befreit worden. Isidoro gewährte ihnen indessen keine Pause. Er hatte ihnen lediglich ein halbes Dutzend weitere Decksleute zur Verstärkung geschickt damit sie weiter pumpten.
„Es muß einen Weg geben, die ‚Santa Teresa‘ flottzukriegen“, sagte Isidoro, während er sich mit dem Ersten zurück auf das Achterdeck begab. Der Teniente blieb bei dem Rest seiner Leute auf der Kuhl. „Die Sturmschäden an Deck können wir mit Bordmitteln beheben. Damit wird beim ersten Tageslicht begonnen.“
„Und dann, Capitán?“ entgegnete der Erste mit einem Anflug von Spott. „Ist Ihnen klar, daß wir bei Flut auf das Riff gebrummt sind? Was meinen Sie, was passiert, wenn die Ebbe einsetzt!“
„Das weiß ich selber“, fauchte Isidoro. „Wenn ich sage, daß wir einen praktikablen Weg finden müssen, dann vor Einsetzen der Ebbe.“
„Das wird aber bereits vor der Morgendämmerung der Fall sein“, sagte der Erste beharrlich. Beinahe klang es, als fände er Gefallen daran, daß die „Santa Teresa“ dem Untergang geweiht war. Zumindest gefiel es ihm, seinem stets besserwisserischen Kapitän in diesem Punkt um eine Nasenlänge voraus zu sein.
„Na und?“ Isidoro starrte ihn an. „Wozu haben wir die Männer an den Pumpen? Wozu haben wir einen Schiffszimmermann, der Lecks abdichten kann? Und wozu haben wir Leute, die ein Beiboot bemannen können?“
„Stimmt alles“, sagte der Erste trocken, „nur haben wir kein Beiboot mehr.“
Don José Isidoro verschluckte sich fast. Der Denkfehler war ihm in der Aufregung unterlaufen, und, verdammt noch mal, er gönnte dem Ersten diesen Triumph nicht. Er setzte zu einer Erwiderung an.
Doch ein warnender Schrei von der Kuhl ließ ihn stumm bleiben.
„Achtung! Fremde Schiffe! An Steuerbord!“
Isidoro und der Erste Offizier wirbelten herum. Ihnen gefror das Blut in den Adern.
Wie Schemen tauchten sie aus dem Nebel auf.
Sieben Einmaster waren es, die in gestaffelter Formation heranglitten – lautlos und siegessicher wie Schakale, die sich auf einen todkranken und hilflosen Tiger stürzen.
Und sie waren so nahe, daß sie fast schon herüberspucken konnten.
„Alarm!“ brüllte Isidoro. „Klar Schiff zum Gefecht!“
Auf der Kuhl gerieten die Seesoldaten in Bewegung. Doch ihre Zahl war erbärmlich, verglichen mit der Übermacht, die von Steuerbord herannahte. Zwei Männer hasteten zu den Luken, um die anderen aus dem Stauraum zu holen.
Der Erste Offizier zog seinen Säbel.
„Sie sind ein Optimist“, sagte er grimmig, „das Pulver in den Kartuschen ist feucht geworden. Glauben Sie, wir schaffen es noch, die Geschütze zu entladen und nachzuladen?“
Er sollte recht behalten.
Nicht einmal die Musketen und Pistolen konnten sie noch einsetzen. Und es blieb keine Zeit, trockenes Schwarzpulver aus der Pulverkammer herbeizuschaffen.
Die Männer, die an den Pumpen geschuftet hatten, stürzten in panischer Hast an Deck. Der Stückmeister warf ihnen Säbel und Entermesser zu, die sie im Vorbeilaufen auffingen, während sie an die Steuerbordverschanzungen eilten.
Unterdessen gingen die beiden ersten Einmaster bereits auf Enterkurs. Wildes Gebrüll ertönte an Bord der Piratenschiffe.
Don José Isidoro, der ebenfalls seinen Säbel gezogen hatte, beobachtete zähneknirschend das Geschehen. Er fluchte auf sich, daß er die Deckslaternen hatte anzünden lassen. Eine bessere Orientierungshilfe hatte er diesen Küstenhaien nicht geben können. Aber jetzt war es für solche Überlegungen zu spät. Es half auch nichts mehr, die Laternen noch zu löschen. Im bevorstehenden Enterkampf war es da schon besser, wenn man den Gegner sehen konnte.
Auch die übrigen Offiziere hatten sich mittlerweile auf dem Achterdeck versammelt und die Säbel blankgezogen. Wie es ihrem Rang entsprach, würden sie nicht gemeinsam mit den Mannschaften auf der Kuhl und auf der Back kämpfen.
Immer lauter brüllten sich die Piraten ihren vorzeitigen Triumph aus dem Leib, und sie trafen damit die Verteidiger an Bord der „Santa Teresa“ auf den entscheidenden Nerv.
Mit killenden Segeln glitten die beiden ersten Schaluppen auf die Steuerbordseite der spanischen Galeone zu. Capitán Isidoro und seine Männer konnten bereits das Weiße in den Augen der Piraten sehen – und ihre blitzenden Zähne, während sie ihr siegessicheres Gebrüll ausstießen.
Und noch eins wurde deutlich: Die Übermacht der Schnapphähne war erdrückend. Den zwei Dutzend Männern, über die Isidoro – einschließlich der Seesoldaten – noch verfügte, standen mehr als doppelt so viele Piraten gegenüber.
Mit dumpfem Dröhnen stießen die beiden ersten Schaluppen nacheinander gegen die Bordwand der „Santa Teresa“. Mit gellenden Angriffsschreien und blitzenden Blankwaffen enterten die Kerle, indem sie mit federnden Sprüngen aus den Wanten der Schaluppen über das Schanzkleid der Galeone schnellten.
Heftige Kämpfe Mann gegen Mann entbrannten auf der Kuhl der „Santa Teresa“. Noch waren Isidoros Decksleute und Seesoldaten in der Überzahl. Doch das änderte sich innerhalb von wenigen Minuten.
In kurzen Abständen, schon fast gleichzeitig, legten sich die restlichen Schaluppen Bordwand an Bordwand, und die gesamte wilde Meute der Piraten stürmte grölend über die Decks.
Als waffenstarrende Woge flutete dann die Masse der Angreifer über das Schanzkleid der Galeone.
Don José Isidoro schloß für eine Sekunde entnervt die Augen. War dies das Ende?
Nein, es durfte nicht sein. Er war entschlossen, zu kämpfen. Ebenso die anderen Offiziere, die mit angespannten Muskeln auf dem Achterdeck ausharrten.
Schon gellten die ersten Todesschreie. Die Männer der „Santa Teresa“ hielten sich tapfer, und sie kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Aber es hatte schon von Anfang an keinen Zweifel gegeben, daß sie der Übermacht niemals gewachsen waren.
Aus dem Getümmel auf der Kuhl löste sich unvermittelt eine Gruppe von Piraten. Ihre Säbel blitzten im Laternenlicht, als sie über beide Niedergänge zum Achterdeck aufenterten.
Isidoro vermochte nicht zu zählen, wie viele es waren. Alles ging viel zu schnell.
Der Dritte Offizier starb mit einem markerschütternden Schrei, als er die massierte Attacke von drei Angreifern zu parieren versuchte und dabei ins Stolpern geriet. Der Zweite wich zurück, als sich die Angriffswelle auf ihn konzentrierte. Ein einziger unsicherer Schritt von ihm genügte, und einer der Piraten schmetterte ihm den Säbel aus der Hand.
„Wartet nur“, knurrte Isidoro voller Grimm, „ein paar von euch schicken wir noch in die Hölle.“ Er verständigte sich durch einen Blick mit seinem Ersten Offizier. Da waren keine Differenzen mehr zwischen ihnen. Sie würden kämpfen, Seite an Seite, bis zum Letzten.
In kürzeren Abständen gellten jetzt die Schreie der Sterbenden auf dem Hauptdeck.
Isidoro sah sich plötzlich einem katzenhaft gewandten Burschen mit dunklem, breitkrempigem Hut gegenüber. Wollte der Bursche es tatsächlich allein mit ihm aufnehmen?
Aus dem Stand heraus riskierte Isidoro einen blitzschnellen Ausfall. Grenzenloses Erstaunen packte ihn, als der andere ihn leerlaufen ließ. Er hatte ihn unterschätzt. Dieser Mann gehörte zur Spitzenklasse.
Isidoro schaffte es nicht mehr, aus seinem Fehler zu lernen.
Als er herumwirbelte, um zu einem neuen Angriff anzusetzen, spürte er einen harten Schlag, der von seiner rechten Faust in den rechten Arm hinaufzuckte. Mit geweiteten Augen sah er, wie sein Säbel durch die Luft torkelte und über Bord fiel.
Auch der Erste und der Zweite Offizier waren entwaffnet worden und wurden jetzt von den Piraten in Schach gehalten.
Isidoros Gegner zog seinen breitkrempigen Hut, grinste und deutete eine Verbeugung an.
„Gestatten, mein Name ist Duvalier. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Capitán. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß Sie und Ihre beiden Offiziere meine Gefangenen sind. Wenn Sie Glück haben, bleiben Sie am Leben – vorausgesetzt natürlich, daß Ihre Vorgesetzten in Pensacola ein hübsches Lösegeld zahlen.“
„Woher wissen Sie das?“ zischte Isidoro.
„Fünf Vögel haben es uns gezwitschert“, erwiderte Duvalier feixend. „Aber seien Sie unbesorgt: Die fünf zwitschern nicht mehr.“
Isidoro hatte das Gefühl, vor Wut platzen zu müssen. Er hatte es geahnt. Diese verdammten Deserteure waren verantwortlich für alles.
Hilflos mußten der Capitán und die beiden Offiziere mit ansehen, wie ihr Schiff ausgeplündert wurde. Außer ihnen gab es keine Überlebenden. Bereits eine halbe Stunde später hatten die Galgenstricke ihre Arbeit erledigt.
Isidoro und die Offiziere wurden auf eine der Schaluppen gebracht. Schwerbeladen setzten die Einmaster Segel und gingen auf Nordkurs. Mit brennenden Augen blickte Isidoro zurück. Erst jetzt sah er, daß der Morgen zu grauen begann. Und die Ebbe hatte eingesetzt.
Sie befanden sich noch in Sichtweite, als es geschah.
Vom Sturm zermürbt, brach die „Santa Teresa“ auseinander, als ihr die Fluten keinen Auftrieb mehr gaben. Innerhalb von Minuten waren die zersplitterten Wrackteile verschwunden.
Auch Duvalier sah es, und er fand seine Entscheidung bestätigt: Als Prise hatte diese Galeone nichts getaugt. Dafür standen lohnendere Objekte in Aussicht. Im Lake Borgne oder im Lake Pontchartrain waren diese beiden Objekte zu suchen, das hatten die Deserteure berichtet. Duvaliers Augen leuchteten voller Vorfreude.
Totenstille hatte sich über den Lake Pontchartrain gesenkt.
Mit dem Beginn des Morgengrauens hatten sich die Nebelschwaden nur ein wenig gehoben, waren aber nicht höher als die Schanzkleider der Galeonen gestiegen. Ben Brighton hatte deshalb kurzentschlossen das große Beiboot abfieren lassen, um nach Hasard und seinen Männern suchen zu lassen, die noch nicht zurückgekehrt waren.
Rufe wurden auf der „San Donato“ laut.
Wenige Minuten später sahen auch die Männer an Bord der „Isabella“ die große Jolle, die mit der Suchmannschaft unter dem Kommando von Ferris Tucker herannahte.
Atemlose Spannung entstand, niemand mochte auch nur einen Laut von sich geben. Ben Brighton lief hinunter zur Pforte im Schanzkleid, als die Jolle längsseits ging.
Ferris enterte als erster über die Jakobsleiter auf. Schon an seiner niedergeschlagenen Miene war abzulesen, wie die Suche ausgegangen war. Auch die übrigen Männer sahen deprimiert aus.
„Nichts“, sagte Ferris kopfschüttelnd, „vom Boot aus ist die Sicht wirklich hervorragend. Aber die ganze See ist wie leergefegt. Keine Spur von dem verdammten Spuk und keine Spur von Hasard und den anderen.“
Ben atmete tief durch.
„Hier geht es wirklich nicht mit rechten Dingen zu“, sagte er und preßte die Lippen aufeinander. Er war sich darüber klar, daß er einen schnellen Entschluß fassen mußte.
Nachdem die Jolle an Deck gehievt worden war, hielt er mit den Männern einen kurzen Kriegsrat. Die Entscheidung war schnell getroffen.
Sie würden ankeraufgehen und den gesamten Uferbereich des Sees absuchen. Die „San Donato“ mußte an ihrem Liegeplatz bleiben. Kanonenschüsse sollten bei Gefahr als Verständigung dienen.
Das rätselhafte Geschehen bedrückte Ben Brighton und die Arwenacks gleichermaßen.
In welche teuflische Falle waren sie diesmal geraten?
ENDE
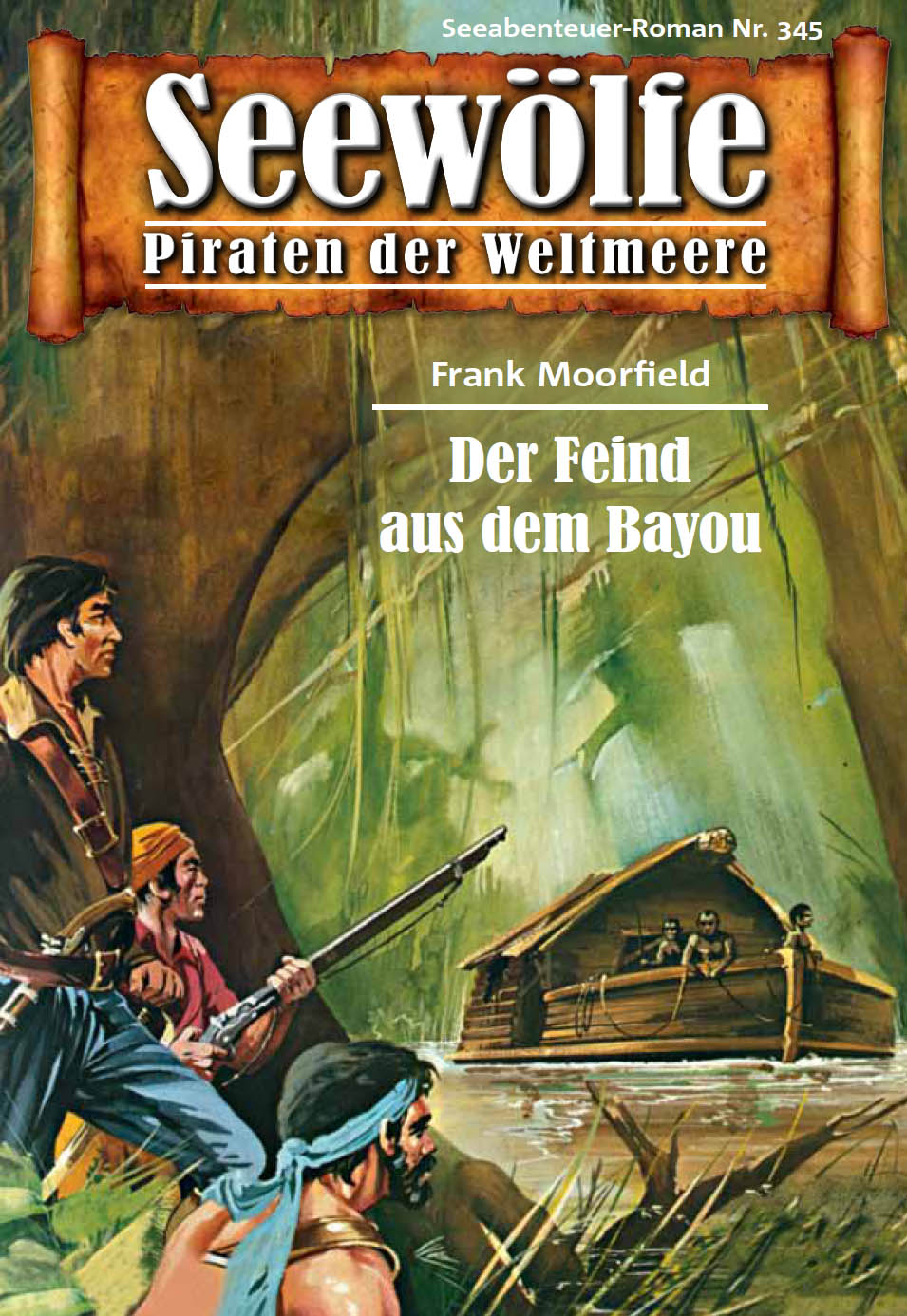
Frank Moorfield
1.
Über dem Lake Pontchartrain lag eine geradezu unheimliche Stille. Sie wurde nur vereinzelt vom Gebrüll der Alligatoren und von den Schreien der Nachtvögel unterbrochen, die im sumpfigen Ufergelände nach Beute jagten.
Stellenweise lagerten dichte, grauschwarze Nebelschwaden über der Wasserfläche des Sees, der nordwestlich der Mississippimündung in die flache Landschaft eingebettet ist. Am Horizont zeigten sich bereits die ersten hellen Schatten, die Nacht neigte sich ihrem Ende entgegen.
Das kleine Beiboot der englischen Dreimastgaleone, die wie ein schwarzes Ungeheuer in der Dünung schaukelte, wurde in jener gespenstischen Septembernacht des Jahres 1593 mit kraftvollen Riemenschlägen vorangetrieben. Die Jolle folgte einer merkwürdigen Erscheinung, die von Old Donegal Daniel O’Flynn als „Teufelsspuk“, von den übrigen Seewölfen aber als „Mummenschanz“ bezeichnet worden war.
„Hoffentlich löst sich dieser verdammte Spuk-Kübel bei Tagesanbruch nicht in Luft auf“, stieß Edwin Carberry hervor. „Ich lasse mir nämlich nicht gern etwas vorgaukeln.“
„Ich glaube nicht an Gespenster“, ließ sich der blonde Stenmark vernehmen, der als Steuerbord-Schlagmann fungierte. „Vielleicht gibt es hier Indianer, die uns zum Narren halten wollen.“
Big Old Shane, der Mann an der Ruderpinne, lachte verhalten.
„Bestimmt pullt der Teufel seine Großmutter auf einem buntbemalten Nachttopf durch die Gegend. Die Alte muß ja wohl auch mal an die frische Luft.“
Die meisten der sieben Männer an Bord der Jolle brachten eine ähnliche Meinung zum Ausdruck. Nur Smoky, dem es schwerfiel, seinen Aberglauben zu überwinden, schwieg eisern. Er pullte mit verbissenem Gesicht und zog es vor, sich seinen Teil zu denken. Schließlich hatte er das merkwürdige Gebilde einigermaßen deutlich gesehen, und wie allen anderen klang ihm jetzt noch das geisterhafte Trommeln und Singen, das Stöhnen und Wehklagen in den Ohren, das von der spukhaften Erscheinung ausgegangen war. O heiliger Patrick – wie das Heulen der armen Seelen im Fegefeuer hatte das geklungen!
Auch Philip Hasard Killigrew, der Seewolf, schwieg zunächst. Aber nicht, weil er die nächtlichen Vorgänge auf dem Lake Pontchartrain für Geisterspuk hielt, sondern weil er bereits zu einer ganz bestimmten Überzeugung gelangt war. Diese hatte ihn letzten Endes veranlaßt, die kleine Jolle von der „Isabella IX.“ abfieren zu lassen und der „Erscheinung“ zu folgen.
Seiner Meinung nach mußte es sich bei jener in allen Farben schillernden Hütte, die im Nebel den Eindruck vermittelt hatte, als schwebe sie über dem Wasser, um eine Art Hausboot handeln. Doch das mußte erst noch bewiesen werden, deshalb setzte er alles daran, jenes seltsame Wasserfahrzeug einzuholen.
Aye, Sir, dieses „schwebende Haus“ – oder was immer es auch sein mochte – hielt die Seewölfe seit Stunden in Atem. Dabei hatten sie gehofft, an den stillen und abgelegenen Ufern des Lake ein Plätzchen zu finden, an dem sich die fieberkranken Timucua-Indianer erholen konnten. Dies war nämlich die Grundvoraussetzung für die geplante Übersiedlung des Stammes in die Karibik. Vorgesehen war eine Plantageninsel, die zur Gruppe der Caicos-Inseln gehörte und in der Nähe der von den Seewölfen als Schlupfwinkel benutzten Schlangen-Insel lag.