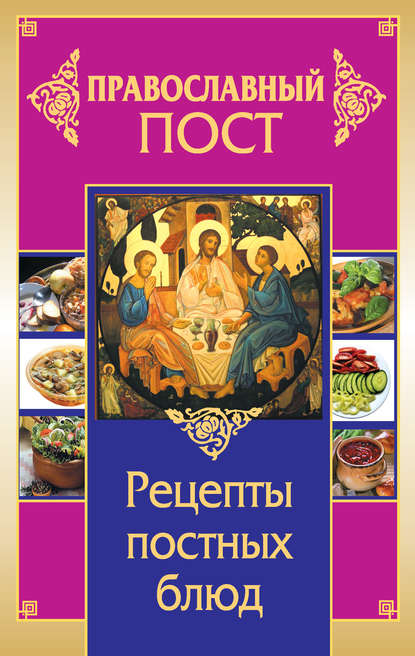Seewölfe Paket 19

- -
- 100%
- +
Philip Hasard Killigrew, Jean Ribault, Siri-Tong, Thorfin Njal, Arne von Manteuffel und Jerry Reeves hockten mit Willem Tomdijk, Carlos Rivero und den Mädchen Manon, Julie, Cécile und Esther in einer Nische zusammen – ziemlich gedrängt, denn sehr viel Platz gab es nicht. Tomdijk, der von Esther und Julie flankiert wurde, konnte das nur recht sein. Treuherzig legte er den beiden die fleischigen Hände auf die Schultern.
„Es ist nur richtig, daß ihr brave Siedlerfrauen werden wollt!“ rief er. „Und vielleicht kann ich auch noch Helferinnen in der Brauerei gebrauchen, die ich bauen werde!“
„Aber wir werden doch nach Hispaniola übersiedeln, nicht wahr?“ fragte Cécile.
„Mit Sicherheit“, erwiderte Carlos Rivero. „Es wartet eine schöne Zeit auf uns, arbeitsreich, aber vielversprechend.“
Manon warf ihm einen verheißungsvollen Blick zu. „Das glaube ich auch. Dann laßt uns auf die Zukunft anstoßen.“
Sie hoben die Becher und Humpen und stießen über dem Zentrum des grob zusammengehauenen Tisches miteinander an. Hasard blickte immer wieder zu den Nachbarnischen und den anderen Tischen. Er konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. Carberry war gerade dabei, zwei Mädchen Sir John vorzuführen. Matt Davies und Jeff Bowie zeigten stolz ihre Eisenhakenprothesen vor. Batuti ließ wie zufällig seine Oberarmmuskeln spielen. Keiner konnte es ihnen übelnehmen, daß sie wie aus dem Häuschen waren. Aber eine Enttäuschung mußte der Seewolf ihnen doch bereiten.
„Der ist ja niedlich!“ stieß eins der Mädchen hervor.
Sie hatte Sir John den Zeigefinger hingehalten und ihn rasch zurückgezogen, als er hineinzuhacken versuchte. Ärgerlich wetzte der Vogel seinen Schnabel an der Jacke, die sich über der mächtigen Profos-Schulter spannte.
„Kann er auch sprechen?“ fragte ihre Nachbarin, eine entzückende Blondine mit prallen, strotzenden Brüsten, die aus ihrem. Ausschnitt hervorzuquellen drohten.
„Affenärsche und Bilgenratten“, schnarrte Sir John. „Stinkstiefel, hart Backbord, verwanzte Prielwürmer.“
„Voilà!“ stieß die Blondine aus. „Reizend! Aber ich verstehe nicht, was er sagt!“
Carberry grinste. „Ich verstehe auch nicht, was du sagst“, erklärte er in einem grauenvollen Kauderwelsch aus Englisch, Spanisch und französischen Brocken. „Aber das schadet nichts. Wirklich nicht.“
„Sieh mal“, sagte Matt Davies im selben Moment zu einer der „Ladys“. Demonstrativ hielt er seinen scharfgeschliffenen Eisenhaken hoch. „Damit rasiere ich mich jeden Morgen.“
„Und was kannst du noch alles damit tun?“ fragte sie ihn.
Er erklärte es ihr, so gut er konnte, und sie riß die Augen in ungläubigem Erstaunen auf.
„Freunde!“ rief Willem Tomdijk und breitete die Arme aus. „Ich bin ja so froh, daß sich alles zum Guten gewendet hat! Ich will ehrlich sein: Als ich an Bord der ‚Caribian Queen‘ war, habe ich Angst gehabt – große Angst. Dieser Caligula hätte mir gern die Gurgel durchgeschnitten, und auch die Black Queen hat mich nur geduldet, weil sie wußte, welchen Einfluß ich auf unsere Leute habe! Aber das alles ist jetzt vorbei.“
„Ja“, sagte der Seewolf. „Und für uns heißt es Abschied nehmen.“
„Wie?“ Der Dicke glaubte, nicht richtig gehört zu haben. „Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, ihr würdet noch ein paar fröhliche Tage mit uns verbringen. Das kannst du uns nicht antun!“
Auch Hasard fiel es schwer, die Insel wieder zu verlassen. Auch er war von Manons, Julies, Céciles und Esthers Reizen beeindruckt und fühlte ähnlich wie seine Männer. Aber er wußte, daß ihn die Pflicht rief. Die Pflicht – das war die Verantwortung über die Schlangen-Insel, über Arkana, Araua, Karl von Hutten, Ramsgate und die Schlangenkrieger und Kriegerinnen, die dort auf seine Rückkehr warteten. Auch Coral Island wollte bewacht werden.
Die Vorsichtsmaßnahmen durften nicht vernachlässigt werden. Mit einem Angriff von See – beispielsweise durch die rachsüchtigen Spanier – war ständig zu rechnen. Er durfte sich keinesfalls darauf verlassen, daß die Schlangen-Insel ein geheimer, absolut sicherer Zufluchtsort war. Wie die Black Queen die Insel entdeckt hatte, so konnte es auch dem spanischen Feind gelingen, durch Zufall auf sie zu stoßen.
Folglich drängte die Lage nach einem raschen Aufbruch – Hasard durfte keine Zeit mehr verlieren. Eindringlich sprach er auf die neuen Freunde ein und legte ihnen die Gründe dar, die für ein schnelles Verlassen von Tortuga sprachen.
Carlos Rivero sagte: „Mir leuchtet das alles ein. Es wäre unklug von uns, euch aufzuhalten. Aber mußt du denn mit allen Schiffen zur Schlangen-Insel segeln?“
„Ich schlage vor, daß die ‚Wappen von Kolberg‘ hierbleibt“, sagte Hasard. „Was sagt der Bund der Korsaren dazu?“
Nur kurze Zeit dauerte die Beratung, dann stand es fest. Arne von Manteuffel sollte mit der „Wappen von Kolberg“ im Hafen von Tortuga bleiben, gewissermaßen als Nachhut und zur Sicherung der Insel. Arne stimmte Hasards Vorschlag spontan zu, denn er wollte die Gelegenheit nutzen, um ausführliche Gespräche mit Willem Tomdijk und Carlos Rivero zu führen.
„Über die allgemeine strategische Lage in der Karibik“, sagte er. „Ihr beiden kennt euch ja hervorragend aus und könnt das Bild abrunden, das ich mir zu verschaffen versuche.“
„Einverstanden“, sagte Willem. „Aber ich werde dich auch über die Bedeutung des Brauereiwesens in der Karibik aufklären, lieber Freund, das verspreche ich dir.“
„Mir sausen davon jetzt schon die Ohren“, erklärte Diego, der gerade eine neue Runde Wein brachte. „Und das eine laß dir gesagt sein, Willem Tomdijk: Hier auf Tortuga, ist mit Bier nicht viel zu werden. Die Geschäfte laufen ohnehin schlecht.“
„Das sehe ich“, sagte der Dicke lachend. „Aber keine Angst, Diego, dir mache ich keine Konkurrenz. Ich bin kein Narr, wie Emile es war. Ich kenne meine Möglichkeiten – und meine Grenzen.“
„Hoffen wir’s“, sagte Diego, dann eilte er wieder davon.
Emile Boussac, der Verräter – keiner weinte ihm eine Träne nach. Er hatte ein doppeltes Spiel in Szene gesetzt und mit dem Tod dafür bezahlt. Man hatte seine Leiche gefunden. Es schien keinen Zweifel zu geben: Die Black Queen hatte ihn auf dem Gewissen.
Noch einmal wurden die Geschehnisse durchgesprochen, und Willem war drauf und dran, den Seewolf erneut hochleben zu lassen. Doch Hasard wehrte es ab. Er begann, sich zu verabschieden, erhob sich, begab sich an die Nachbartische und überzeugte seine Männer davon, daß es an der Zeit wäre, Tortuga zu verlassen.
Lange Gesichter, entsagungsvolle Blicke, die den Mädchen galten – all das ließ sich nicht vermeiden. Aber am Ende sahen sie alle ein, daß die Entscheidung des Seewolfs nur richtig war. Die Schlangen-Insel und Coral Island warteten auf sie, sie mußten so schnell wie möglich dort nach dem Rechten sehen und die wartenden Freunde vor möglichen üblen Überraschungen bewahren.
So kehrten die Mannschaften an Bord der Schiffe zurück, und jeder nahm seinen Manöverposten ein. Wenig später wurden auf der „Isabella“, der „Le Vengeur“, der „Tortuga“ und dem Schwarzen Segler die Anker gelichtet und die Segel gesetzt. In Kiellinie segelten die vier Schiffe aus der Hafenbucht von Tortuga und gingen in See – und die letzten Blicke der Männer an Bord galten den Mädchen, die am Ufer standen und ihnen nachwinkten.
Auch Arne von Manteuffel und dessen Crew von der „Wappen von Kolberg“ fiel es nicht leicht, sich von Hasard und den anderen trennen zu müssen. Aber sie wußten, daß die Situation es erforderte. Ihr Zurückbleiben auf Tortuga entsprach allen strategischen und taktischen Gesichtspunkten, die Hasard mit seinem Vetter durchgesprochen hatte. Arne, Oliver O’Brien, Hein Ropers und Renke Eggens waren davon überzeugt, daß sich schon bald die ersten Erfolge dieser Maßnahme zeigen würden.
Die Zukunft war noch ungewiß, aber die Bedrohung durch die Black Queen schien vorerst gebannt zu sein. Hasard hatte sie nicht verfolgt, es war ihm vordringlicher gewesen, die Verhältnisse auf Tortuga zu klären. Im übrigen war ihre Niederlage so endgültig gewesen, daß die Annahme berechtigt erschien, sie würde sich davon nicht wieder erholen.
In diesem Punkt aber unterschätzte auch Hasard die Black Queen – ein Fehler, den sowohl er als auch seine Männer und Verbündeten noch bereuen sollten.
In Punta Gorda erregte das Erscheinen der Black Queen und ihrer vier Begleiter das erwartete Aufsehen. Nicht nur Gilbert Sarraux und Joao Nazario waren zur Stelle, um sie ausgiebig zu betrachten. Eine Gruppe von wüst aussehenden Kerlen scharte sich vor dem Eingang der Hafenkneipe „El Escarabajo“ zusammen, als die fünf Fremden die teils aus Steinen, teils aus Holz und Schilfmatten errichtete Hütte betraten. Die Kerle grinsten, stießen sich untereinander an und ließen anzügliche Bemerkungen vernehmen.
Caligula wandte sich zu ihnen um, seine Hand lag am Heft seines Säbels. Sein Gesicht war verzerrt. Aber die Queen hielt ihn zurück.
„Vergiß nicht, wir sind als Freunde hier, Caligula“, sagte sie. „Wir müssen uns so diplomatisch wie möglich verhalten.“
Von Diplomatie hatte Caligula nie etwas gehört, er wußte nicht, welche Bedeutung dieser Begriff hatte. Aber er sah ein, daß er nicht handgreiflich werden durfte. Die Queen wollte keine Streitigkeiten. Daran mußten er und die drei Piraten der „Caribian Queen“ sich halten.
„El Escarabajo“, der „Käfer“, war das Zentrum des Lebens von Punta Gorda. Hier traf man sich, hier wurden Beutezüge besprochen, Pläne gewälzt und die tollsten Abenteuer erzählt. Wer etwas an den Mann zu bringen hatte, knüpfte hier die erforderlichen Kontakte an, wer etwas erstehen wollte, war an der richtigen Adresse.
Die Queen spürte instinktiv, daß sie hier mit den Leuten ins Gespräch kommen konnte. Sie wollte nicht nur Proviant einkaufen, den sie bezahlen konnte, sie wollte mehr. Was es genau war, wußte sie sich selbst gegenüber noch nicht zu erklären, aber ihr Bestreben war darauf ausgerichtet, neue Rachepläne gegen den Seewolf zu entwickeln. Sie haßte ihn jetzt bis aufs Blut, und ihr einziges Ziel war die Vergeltung.
Die Männer, die sich vor dem Eingang eingefunden hatten, drängten nach, als die Queen und ihre Gefolgschaft das Innere der Spelunke betraten. Entschlossen steuerte die Queen auf den Tresen zu, der so windschief wirkte wie der ganze Bau. Im Halbdunkel erblickte sie die Gestalt des Wirtes. Er bediente drei Zecher, die schon einigen Wein und Rum getrunken zu haben schienen, wandte sich aber sofort der Queen zu. Sein Gebaren war diensteifrig und unterwürfig.
Ratte, dachte sie abfällig.
Caligula und die drei Piraten nahmen neben und hinter ihr Aufstellung. Die Kneipe füllte sich immer mehr mit Gestalten, gleich zwei Dutzend Kerle rückten auf die Theke zu. Caligula ahnte, daß er die Queen nicht abschirmen konnte, und wieder schob sich seine Hand an den Griff des Säbels.
„Womit kann ich den Herrschaften dienen?“ fragte der Wirt.
„Mit Wein und Rum“, erwiderte die Queen. „Wir sind durstig. Und mit ein paar Auskünften.“
„Zum Beispiel?“
Je mehr er katzbuckelte, um so widerwärtiger war er ihr. Aber sie bezwang sich und entgegnete so freundlich wie möglich: „Ich brauche Proviant, Wasser und Munition für mein Schiff. Ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Meine Männer und ich haben nicht die Zeit, auf die Jagd zu gehen und eine Quelle zu suchen. Wir sind in Eile.“
„Außerdem gehört dieser Küstenstrich uns“, sagte jetzt einer der Kerle, die sich genähert hatten. Er war groß und hager und hatte eine breite, häßliche Messernarbe im Gesicht, die sich quer über seine linke Wange zog. Seine Kumpane nannten ihn Larsky, und er stammte, wenn man seinen Erzählungen Glauben schenken durfte, aus dem fernen Land Polen. „Die Gegend ist also unser Hoheitsbereich“, fuhr er fort. „Jeder, der hier ankert, fischt oder auf die Jagd geht, hat uns zuerst um unsere Genehmigung zu bitten. Das gleiche gilt auch für Weiberröcke, die hier ihrem Gewerbe nachzugehen gedenken.“ Ungeniert und herausfordernd zugleich musterte er sie von oben bis unten. Dann glitt sein Blick wieder an ihr hoch und verharrte auf ihren Brüsten.
Caligula wollte aufbegehren, aber die Queen hielt ihn wieder zurück – durch einen einzigen Blick. Er bedeutete: Laß nur, mit dem Kerl werde ich auch allein fertig. Mit einer knappen Gebärde gab sie Caligula und den drei anderen Kerlen von ihrem Schiff zu verstehen, daß sie sich heraushalten sollten.
Die vier Männer wichen etwas zur Seite. Larsky trat in die sich öffnende Lücke und stand jetzt so dicht vor der Queen, daß sein Oberkörper ihre Brust zu berühren drohte.
„Wer bist du überhaupt?“ fragte er und grinste unverschämt.
Die Kerle, die sich hinter seinem Rücken heranschoben, lachten.
„Die Black Queen“, erwiderte sie. „Und du?“
„Larsky. Das hier sind meine Freunde T-Bone, Lee Crapper und Norimbergo und die anderen – ach, es würde zu weit führen, sie alle vorzustellen. Du lernst sie auch so noch kennen.“ Er grinste immer noch, und wieder lachten die anderen.
Die Queen erwiderte das Grinsen. „Und du bist hier der größte Maulheld, was, Larsky?“
„Ich möchte von dir wissen, was du willst.“
„Euch allen einen schönen guten Tag wünschen.“
„Uns sonst?“
„Etwas kaufen, das habe ich wohl schon gesagt“, erwiderte sie seelenruhig. „Aber vielleicht habe ich auch etwas anzubieten.“
„Das habe ich mir schon gedacht“, sagte er. „Teufel, du hast die größte, prächtigste Galion, die ich je gesehen habe.“
Schallendes Gelächter in der Kneipe. Die Kerle schienen sich prächtig zu amüsieren. Auf eine Abwechslung wie diese hatten sie schon lange gewartet.
Auch Annamaria, Amintores vermeintliche Tochter, war zugegen, aber sie hielt sich im Hintergrund. Es war ihr zuwider, wie die Kerle sich an die Black Queen heranarbeiteten. Hoffentlich haut sie ihnen ein paar runter, dachte sie.
„Laß mal sehen, was du außer deinem Vorschiff noch alles zu bieten hast“, sagte T-Bone, ein knochiger Kerl mit großen Zähnen. Er drängelte sich vor, schob sich neben Larsky und griff nach dem Lendenschurz der Queen. „He, ich gebe einen doppelten Rum für dich aus, wenn du mich als ersten an Bord läßt!“
Es gab ein scharfes, klatschendes Geräusch, und T-Bone zog die Hand zurück. Seine Miene war verwirrt. Damit hatte er nicht gerechnet. Blitzschnell hatte die Queen ihm mit unerwarteter Härte auf die Finger geschlagen.
Larsky lachte. „Du bist nicht ihr Typ, T-Bone“, sagte er. „Sie ist wählerisch. Laß mich mal ran. Hallo, Queen, schick deine Aufpasser ruhig weg. Ich gebe eine Runde Wein für sie aus, und wir haben unsere Ruhe. Na, ist das ein Angebot?“
„Ja.“ Sie ließ ihn heranrücken, dann schoß ihre Hand überraschend hoch. Es klatschte zum zweitenmal, Larsky rieb sich die schmerzende Wange – die mit der Messernarbe.
„Ich habe Ohrfeigen, Boxhiebe und Tritte anzubieten“, sagte die Queen kalt. „Für den Fall, daß mich noch jemand mit einer billigen Hafenhure verwechselt. Also, wer ist der nächste?“
„Ich“, antwortete ein Bulle von Kerl, der sich hinter Larsky und T-Bone gehalten hatte. „Lee Crapper. Manoleto, räum den Tresen. Ich lege die schwarze Hure flach und versohle ihr den Hintern. Das hat sie für ihre Frechheit verdient.“
Manoleto war der Wirt. Übersetzt bedeutete der Name soviel wie „Dreckfinger“, nicht etwa „Manuelito“ oder „Manuel“, wie man beim ersten Hinhören vermuten mochte. Manoleto hatte nie saubere Hände, und das hatte ihm den Beinamen eingebracht. Kurzum, er war einer der schmierigsten und schlitzohrigsten Kerle, die es in Punta Gorda und auf ganz Hispaniola gab.
Er warf Crapper einen huschenden Blick zu und zog sich dann schleunigst zurück. Er bangte mehr um seine Flaschen und Fässer als um die allgemeine Ordnung, die in diesem Hafen ohnehin nur symbolisch existierte.
Crapper griff nach dem Arm der Queen und wollte sie zu sich heranreißen. Er überragte sie um eine halbe Kopfeshöhe, und seine Muskelpakete hatten gewaltige Ausmaße. Caligula und die drei Piraten der „Caribian Queen“ trafen Anstalten, sich jetzt doch auf diesen Kerl zu stürzen, aber wieder war es die Queen, die die Initiative ergriff.
Sie ließ sich am Arm zu Crapper heranreißen, aber dann bückte sie sich gedankenschnell und warf ihn über ihre Schultern hinweg zu Boden. Es dröhnte, und Crappers Sturz war so hart, daß er ein entsetztes Keuchen ausstieß. Manoleto duckte sich hinter die Theke. T-Bone, Larsky, Norimbergo und die anderen Bewohner von Punta Gorda griffen zu den Waffen.
Doch die Queen hatte plötzlich wie durch Zauberei den Säbel in der linken und die Pistole in der rechten Faust.
„Schluß der Vorstellung“, sagte sie. „Ich bin nicht hier, um mit euch zu kämpfen, aber wenn ich angegriffen werde, wehre ich mich.“ Sie wartete, bis Crapper wieder auf den Beinen war, dann wandte sie sich erneut an ihn. „Ich bin bereit, mich mit dir zu duellieren. Vielleicht wird es Zeit, daß jemand in diesem Elendsnest ein Exempel statuiert. Daß ihr in totaler Freiheit lebt, ist noch lange kein Grund dafür, Fremde zu belästigen und anzufallen, die mit friedlichen Absichten erschienen sind.“ Ihre Stimme nahm noch einen etwas schärferen, schneidenderen Klang an. „Männer von Punta Gorda – ihr habt euch in mir getäuscht!“
3.
In seiner überschäumenden Wut hätte sich Lee Crapper am liebsten auf die Black Queen gestürzt, aber etwas hielt ihn zurück. Was war es? Die erstaunliche Kraft dieser Frau? Ihre Intelligenz, ihre Entschlossenheit? Sie schien hart, grausam und unduldsam zu sein, und ihre handfesten Argumente wirkten überzeugend. Für einen Moment sah er sie noch haßerfüllt an, dann aber senkte er den Blick. Ihr Mut hatte über seine Wildheit gesiegt.
„Ich verzichte auf ein Duell“, sagte er. „Ich schlage mich nicht mit Frauen.“
„Gut, Crapper.“ Sie steckte die Waffen weg und hielt ihm die rechte Hand hin. „Dann nichts für ungut. Du mußt dich aber auch davon überzeugen, daß nicht jede Frau eine billige Hure ist.“
Erst zögerte er, dann ergriff er die ihm angebotene Hand und drückte sie fest. Er hob den Kopf und grinste. „Einverstanden.“ Er drehte sich zu den anderen um. „He, Larsky, T-Bone, Norimbergo – was ist? Wollt ihr nicht auch mit der Black Queen Frieden schließen?“
Ja, sie wollten. Sie gaben ihre feindselige Haltung auf und folgten Crappers Beispiel. Es war kein Schwächebeweis, es war nur richtig, diese ungewöhnliche Frau gebührend zu empfangen und zu feiern. Teils leutselig, teils verlegen grinsend, traten die Kerle vor die Queen hin und schüttelten ihr artig die Hand, einer nach dem anderen. Die Queen stellte ihnen Caligula und die drei anderen von der „Caribian Queen“ vor, und dann tat sie das, was in dieser Lage genau richtig war: Sie bestellte eine Runde für alle.
Manoleto atmete auf. Er zapfte ein neues Faß an und füllte vor lauter Erleichterung die Humpen, Mucks und Pints bis zum Rand, was sonst ganz gegen seine Gewohnheiten war.
Die Black Queen und die Männer ließen sich an den Tischen von „El Escarabajo“ nieder, stießen miteinander an und begannen eine angeregte Unterhaltung.
„Natürlich können wir euch mit Proviant versorgen!“ rief Larsky jetzt. „Es hängt nur davon ab, ob wir uns über den Preis einigen!“
„Bestimmt“, sagte die Queen. „Ich bezahle mit Silbermünzen.“ Von den Goldstücken, die sie an Bord der „Caribian Queen“ verwahrte, erwähnte sie lieber nichts, auch nichts von dem Diamantschmuck und den ungeschliffenen, rohen Juwelen, die zu ihrem Privatschmuck gehörten. So ganz traute sie den Kerlen immer noch nicht.
Es konnte gut möglich sein, daß Larsky und seine Kumpane bei Nacht einen Überfall auf die „Caribian Queen“ unternahmen, wenn sie dort Beute witterten. In ihrem derzeitigen Zustand und mit der angeschlagenen Crew an Bord war die Galeone ziemlich leicht zu entern. Nein, die Kerle von Punta Gorda durften gar nicht erst auf den Gedanken verfallen, etwas Derartiges zu versuchen.
„Und wieviel Munition brauchst du?“ fragte Lee Crapper.
„Soviel wie möglich, ich habe mit jemandem eine Rechnung zu begleichen.“
„Wir werden sehen, was sich auftreiben läßt“, sagte Norimbergo, ein dunkelhaariger, aalglatter Bursche. „Unsere Lager wollen wir zwar nicht plündern, aber wir können dir gewiß mit Pulver und einigen Siebzehnpfünderkugeln dienen.“
„Das geringste Problem dürfte wohl die Wasserbeschaffung sein“, sagte Caligula mit galliger Miene. Er war nicht ganz einverstanden, daß die Queen mit den Kerlen dicke Freundschaft schloß. Ein bißchen Eifersucht war auch mit dabei, aber die wollte er sich lieber nicht anmerken lassen, um sich nicht lächerlich zu machen.
„Wasser gibt es gratis!“ rief T-Bone aus und zeigte lachend seine riesigen Zähne. „Wasser ist in Punta Gorda wenig gefragt! He, Manoleto, wo bleibt der Nachschub? Wein her, die Becher sind leer!“
Manoleto füllte die Becher, Mucks und Humpen. Caligula blickte mißtrauisch in seinen Humpen, er rechnete damit, Kakerlaken im Wein schwimmen zu sehen. Erstaunlicherweise war dies nicht der Fall. Dennoch blieb Manoleto in Caligulas Augen die schmierigste Ratte, der er je begegnet war. Die Stühle und Bänke, die Tische, der Tresen und der Fußboden der Kneipe „El Escarabajo“ klebten vor Schmutz, sie bereitete ihrem Namen die erforderliche Ehre.
Geschickt lenkte die Black Queen das Gespräch in die richtigen Bahnen. Sie berichtete von dem Kampf gegen den Seewolf und ließ zündende Haßtiraden auf diesen Philip Hasard Killigrew, auf Ribault, die Rote Korsarin, den Wikinger und all die anderen Korsaren von der Schlangen-Insel los.
„Dieses Lumpenpack, das vor nichts zurückschreckt, ist eine Bedrohung für alle ehrlichen Piraten der Karibik!“ rief sie aus und hieb mit der Faust auf den Tisch. „Sollten sie jemals in Punta Gorda auftauchen, eröffnet sofort das Feuer auf sie!“
„Zur Hölle mit diesen Hunden!“ brüllte Lee Crapper dazwischen. Er hatte bereits eine Gallone Wein getrunken. „Verrecken sollen sie! Wir versenken ihre Kähne, wenn sie sich hierher verirren!“ Er glaubte, die Brüste der Queen vor seinen Augen tanzen zu sehen, und ihm wurde etwas schwindlig. Vielleicht lag das aber auch noch an seinem Sturz auf die Bohlen der Spelunke.
Aber auch die anderen beteiligten sich an den Flüchen und den Verwünschungen, die gegen den Seewolf und dessen Männer ausgestoßen wurden. Natürlich hatten sie alle schon von jenem legendären Killigrew gehört, der den Spaniern und Portugiesen hier wie in der Alten Welt das Leben erschwerte.
Sie wußten auch, daß der Seewolf ein fairer Kämpfer war, der jeden Schnapphahn und Galgenstrick verachtete. Sein Zorn richtete sich gegen alle jene, die grundlos wehrlose Seeleute und Eingeborene überfielen, wie es auch die Kerle von Punta Gorda zu tun pflegten.
Von „ehrlichen Piraten“ zu sprechen, wie es die Queen tat, war da schon ein Hohn. Aber die Kerle gingen ihr auf den Leim und erklärten sich mit ihr solidarisch. Ihre Blicke schienen an ihren Lippen zu hängen. Sie war eine gute Rednerin und verstand es, Kerle wie diese für ihre Sache zu gewinnen.
Eben das wollte sie – für ihre Ziele werben und sich den Rücken stärken. Ein oder zwei Niederlagen bedeuteten nichts. Sie folgte unbeirrt ihrem Weg, der sie zur Herrscherin der gesamten Karibik erhob.
„Es lebe die Black Queen!“ schrie Larsky.
„Hurra!“ brüllte Lee Crapper und hob seinen Becher. „Drei Hurras für die Queen! Und nieder mit dem Seewolf!“
„Hurra!“ schrien die Kerle wüst durcheinander. Die Black Queen spürte, wie ihr Selbstvertrauen wieder wuchs. Natürlich versprach sie sich nicht zuviel von der Zustimmung der Kerle. Auch in El Triunfo hatte man sie so gefeiert – und doch hatte sie sich in den Siedlern getäuscht.
Nur der eine oder andere, so wußte sie, würde sich auf ganz bestimmte Weise für ihre Zwecke einsetzen lassen. Noch wußte sie nicht genau, wie ihr nächster Zug war, aber sie ahnte, daß sich die Dinge in dieser Beziehung von selbst entwickelten.
Gilbert Sarraux und Joao Nazario hatten sich an einem Nebentisch niedergelassen. Es behagte ihnen nicht, sich mit Kerlen wie Larsky, T-Bone, Crapper und Norimbergo um die schwarze Frau zu scharen, sie hielten sich lieber etwas im Hintergrund und sondierten erst einmal die Lage.
Nazario drehte sich immer wieder zu Annamaria um und winkte ihr zu. Er wollte sie zu einem Glas Wein einladen. Schon seit langem versuchte er, sie allein zu treffen und für sich zu gewinnen. Doch sie schien Amintore, diesem häßlichen Zwerg, in ewiger Treue verbunden zu sein.