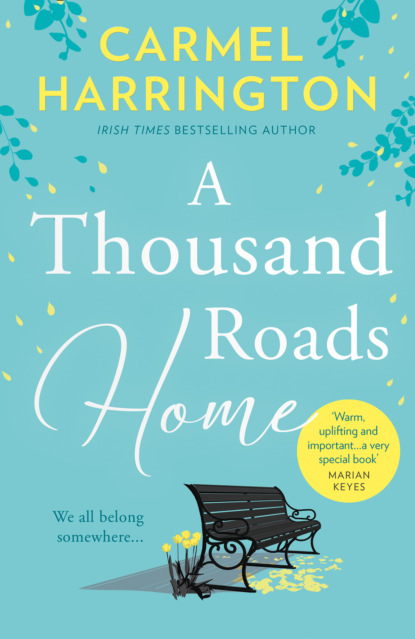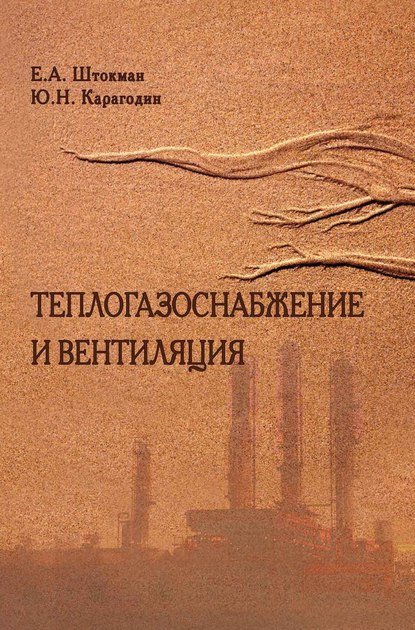Seewölfe Paket 19

- -
- 100%
- +
Shawano legte ihm die Hand auf die Schulter. „Nie würde Shawano seinen weißen Freund Hasard mißverstehen. Komm, ich will dir die Felder zeigen, die wir angelegt haben. An Gerätschaften haben wir alles, was wir brauchen, und es könnte uns nicht besser gehen. Wir sind zufrieden und glücklich, keiner hat bereut, Florida und das Delta des Mississippi verlassen zu haben. Unser ewiger Dank ist dir gewiß.“
Diese Worte brachten den Seewolf fast in Verlegenheit. Er zog es vor, Shawanos Vorschlag zu folgen. Sie brachen zu einem kurzen Marsch ins Innere der Insel auf. Marcos, Tamao, Asiaga, Ribault, Siri-Tong, Thorfin Njal und Reeves begleiteten sie. Schon wenig später blieben sie stehen, und wieder lächelte Shawano, denn seine Besucher setzten erstaunte Mienen auf.
Fischteiche, von den Quellen der Insel gespeist, waren entstanden, über ein Dutzend, und jeder davon mit größter Präzision quadratisch angelegt. Es gab einen Hühnerhof und Schweinekoben, und im Zentrum von Coral Island dehnten sich frisch bebaute Felder aus. Erste grüne Pflänzchen waren bereits gewachsen, und stolz erklärte Tamao, daß es sich um Mais und Weizen handele.
„Unglaublich“, sagte der Seewolf. „Das hätte ich nie für möglich gehalten. Wie habt ihr das fertiggebracht?“
„Wir sind eben Ackerbauern“, erwiderte Shawano bescheiden. „Was du hier siehst, ist auch nur der Anfang von allem. Komme in zwei Monden wieder, und du wirst die ganze Insel nicht wiedererkennen.“
„Es ist erstaunlich, was diese Menschen zustande bringen“, sagte Marcos. „Sie sind fleißig wie die Ameisen – und genauso flink. Wir selbst können uns an ihnen ein Beispiel nehmen. Mariano, Domingo, Rafael und ich haben übrigens schon eine Menge von den Timucuas gelernt.“
„Und die vier erzählen uns dafür Seemannsgeschichten, bei denen man das Grausen kriegt“, sagte Asiaga lachend.
„Wahre Geschichten“, sagte Marcos. „Nichts daran ist erfunden. Wollen wir wetten?“
„Nein“, erwiderte sie. „Ein Timucua wettet nicht.“
„Schon gut“, sagte der Spanier und seufzte. „Das weiß ich ja. Und ihr spielt auch nicht mit Würfeln. Dafür aber könnt ihr Brot backen, Fische braten, Gemüse pflanzen und ernten, Schuhe und Kleider aus selbstgegerbtem Leder und von euch gewebten Stoffen anfertigen. Wenn das so weitergeht, heirate ich noch eines von euren Mädchen.“
„Langsam, langsam“, sagte Siri-Tong. „Das wohl nur, wenn die Timucuas einverstanden sind. Und wenn ihr euch hier nicht anständig betragt, Don Marcos, werdet ihr auf ein Eiland umgesiedelt, auf dem es nur Felsen und Miesmuscheln gibt.“
„Um Himmels willen, nein!“ stieß Marcos hervor. „Wir benehmen uns wie gesittete Menschen! Über uns werden keine Klagen zu hören sein! Shawano, sag ihnen, was für ordentliche Menschen wir sind!“
Alle mußten lachen. Natürlich wußte Siri-Tong so gut wie Hasard, daß die vier Spanier längst zur Inselgemeinschaft gehörten und man sich auf sie verlassen konnte wie auf Buddy Bolden und dessen „Großfamilie“ sowie die drei Pearsons, die am Mississippi mitgeholfen hatten, die Timucuas von dem Sumpffieber zu heilen.
Der Seewolf, die Rote Korsarin, der Wikinger, Jean Ribault und Jerry Reeves waren heilfroh, daß sich die Indianer auf Coral Island eingelebt hatten und mit ihrer neuen Heimat zufrieden waren. Schon die erste Ernte würde die Versorgung der Schlangen-Insel sicherstellen, künftig war es für den Bund der Korsaren kein Problem mehr, die Proviantfrage zu regeln.
In diesem Zusammenhang mußte noch geklärt werden, was mit der Galeone „San Donato“ geschehen sollte. Hasard, Shawano und die anderen verharrten auf einem nur mit Büschen bestandenen Hang, als sie wieder zur Ankerbucht zurückkehrten.
„Das Schiff“, sagte der Häuptling. „Ich will es gern instand setzen, aber meine Männer wissen nicht, wie sie es an Land ziehen sollen.“
„Zum Aufslippen fehlen uns die Hilfsmittel“, sagte Marcos. „Dabei wäre wirklich dringend notwendig, den Rumpf vom Muschelbewuchs und den Algen zu befreien. Er hat eine Generalüberholung nötig und muß auch kalfatert werden.“
„Richtig“, pflichtete Hasard ihm sofort bei. „Die ‚San Donato‘ ist wichtig für uns, sie darf nicht vernachlässigt werden. Wir brauchen sie später insbesondere für Transportzwecke, außerdem sichert sie den Bewohnern von Coral Island ihre Unabhängigkeit und Beweglichkeit.“
„Wir könnten sie zur Schlangen-Insel überführen und dort gründlich überholen“, schlug Jean Ribault vor. „Ramsgates Werft bietet sich für diesen Zweck doch an.“
„Vergeßt nicht, daß der alte Hesekiel zur Zeit noch mit der Ausrüstung der ‚Empress of Sea‘ beschäftigt ist“, sagte Thorfin Njal.
„Die Werft ist noch nicht wieder frei“, sagte der Seewolf und wandte sich Shawano, Marcos, Tamao und Asiaga zu. „Wenn aber die ‚Empress‘ seetüchtig ist, kehren wir zu euch zurück und holen die ‚San Donato‘. Ihr könnt in der Zwischenzeit schon die Crew zusammenstellen, die das Schiff dann segelt.“
„Darum werden sich Marcos, Domingo und Rafael kümmern“, sagte Shawano. „Aber laßt uns jetzt zu unseren Brüdern und Schwestern gehen, sie warten bereits auf uns.“
Am Strand war ein Fest improvisiert worden. Der Klang von Trommeln empfing die Ankömmlinge, Indianerinnen klatschten im Takt in die Hände und bewegten sich im Kreis. Feuer waren entfacht worden, Fische und Geflügel wurden von flinken Händen ausgenommen, von Schuppen und Federn befreit, gewaschen und auf Spieße gesteckt, die die Timucuas über der Glut drehten.
Hasard ließ ein paar Fässer Wein von der „Isabella“, der „Le Vengeur III.“ und der „Tortuga“ holen, der Wikinger stiftete ein Faß Bier zur Feier des Tages. Die Humpen, Mucks und Becher wurden gefüllt und gingen reihum. Die Indianer kosteten nur von den Getränken und staunten über den kräftigen Zug, den die Seeleute ihnen vorexerzierten.
„Ein vorzüglicher Tropfen“, sagte Domingo, der Spanier, nachdem er von dem Wein gekostet hatte. „Wenn mich nicht alles täuscht, stammt er aus meinem Heimatland.“
„Das ist richtig“, sagte der Seewolf. „Frag mich aber nicht, auf welche Weise ich in den Besitz der Fässer gelangt bin.“
„Das tue ich nicht. Aber ich will dir etwas verraten: Wir werden selbst Wein anbauen und die Trauben in Bottichen gären lassen. Ich habe Rebstöcke gesetzt, auf einem sonnigen Hang im Inneren der Insel.“ Stolz lächelte Domingo. „Ich verstehe etwas davon, mein Vater hatte daheim in Andalusien einen Weinberg. Den eigenen Tropfen werden wir aber erst in zwei Jahren probieren können, so lange dauert es, bis die Reben hoch genug sind und tragen.“
„Wir können warten“, sagte Ben Brighton. „Uns ist kein Opfer groß genug, wenn es um einen guten Wein geht.“
„Wir könnten auch eine Brauerei bauen!“ rief Carberry. „Hölle, dieser dicke Willem hat uns derart die Ohren davon vollgequatscht, daß mir jetzt noch der Kopf summt!“
Die anderen lachten, aber Marcos sagte ernst: „Es wäre keine so schlechte Idee, auf Coral Island auch Hopfen und Gerste anzubauen. Überhaupt gibt es noch viele Pläne, wir sollten sie gemeinsam durchsprechen.“
„Meine weißen Brüder bleiben ein paar Tage“, sagte Shawano. „Wir haben genug Zeit, über alles ausführlich zu beraten und dann abzustimmen.“
„Nein“, sagte der Seewolf. „Es tut mir leid, aber das müssen wir euch überlassen. Was ihr tut, findet ohnehin unsere Zustimmung, das wißt ihr. Und wir müssen weiter – zurück zur Schlangen-Insel. Arkana, Araua, Karl von Hutten, Ramsgate und die anderen erwarten uns dringend. Die, Schlangen-Insel ist unbewacht. Die ‚Wappen von Kolberg‘ befindet sich, wie ich dir erzählt habe, noch vor Tortuga.“
„Du willst schon heute wieder auslaufen?“ fragte Tamao bestürzt. Wie Asiaga war er keinen Augenblick von der Seite des Seewolfs gewichen, seit dieser die Insel betreten hatte.
„Ich muß es tun“, erwiderte Hasard. „Und ihr müßt dafür Verständnis haben. Es wird ohnehin nicht lange dauern, und wir kehren zurück und holen die ‚San Donato‘.“
Shawano nickte mit würdevoller Miene und bedeutete allen anderen durch eine Gebärde, zu schweigen. „Was mein Bruder Hasard tut, ist gut getan. Es steht uns nicht zu, ihn unnötig zurückzuhalten. Unsere Wünsche und Gebete begleiten ihn und seine Freunde.“
Sie ließen sich gemeinsam an den Feuern nieder und genossen das Mahl, dann aber drängte der Seewolf zum Aufbruch. Der Abschied war kurz, aber herzlich. Asiaga standen die Tränen in den Augen. Siri-Tong sprach ein paar tröstende, beschwichtigende Worte, aber auch ihr fiel es nicht leicht, sich von diesen Menschen zu trennen, und sie vergaß auch nicht, sich bei den Timucuas für deren Gastfreundschaft zu bedanken.
Am frühen Nachmittag begaben sich Kapitäne und Mannschaften wieder an Bord ihrer Schiffe. Kommandorufe ertönten, die Anker wurden gelichtet und gekattet, dann setzten die Männer die Segel, und in derselben Formation wie zuvor gingen die vier Schiffe wieder in See – voran die „Isabella IX.“, hinter ihr die „Le Vengeur III.“, dann die „Tortuga“ und schließlich „Eiliger Drache über den Wassern“. Hoch am Wind auf Backbordbug liegend gingen sie auf Kurs und waren den Augen der Beobachter auf Coral Island kurze Zeit später entschwunden.
„Bald sehen wir sie wieder“, sagte Shawano – und wieder sollte er recht behalten.
Der grauhaarige Seemann hatte die „Schildkröte“ mit leichter Schlagseite verlassen und war weinselig und von einem Gefühl der Euphorie erfaßt zu seiner Schaluppe zurückgekehrt.
Jetzt war es Diego, der sich an dem Tisch von Arne von Manteuffel, Oliver O’Brien, Carlos Rivero und Willem Tomdijk niederließ. Er hatte einen vollen Weinkrug mitgebracht, grinste, füllte die Becher und sagte: „Na, ich will mal nicht so sein. Ihr seid gute Kunden, euch will ich zuvorkommend bedienen.“
Willem mußte lachen. „Ich denke, die Geschäfte laufen schlecht, Diego.“
Das alte Schlitzohr blickte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. „Das tun sie auch. Schließlich kehren bei mir nicht jeden Tag Leute wie ihr ein. Der alte Grauhai zum Beispiel – der hätte höchstens ein paar müde Copper hiergelassen, wenn ihr nicht laufend welche ausgegeben hättet.“
„Schon gut“, sagte Carlos. Zu Willem gewandt meinte er: „Gib es auf, gegen Diego kommst du nicht an. Hasard hat uns ja vor ihm gewarnt – und Jean Ribault auch.“
„Ach, die übertreiben“, sagte Diego mit einer wegwerfenden Geste. „Ich bin ein aufrichtiger, ordentlicher Wirtsmann, der seine Kunden nicht betrügt. Gepanschten Wein habe ich noch keinem kredenzt, und bei mir gibt es auch keinen andalusischen Schlaftrunk wie bei einem gewissen Plymson in Plymouth.“
„Ja, das glauben wir“, sagte O’Brien und setzte eine amüsierte Miene auf. „Aber nun mal ehrlich, Diego: Wie viele von den Mädchen hast du heute schon an Freier verkuppelt? Wir sehen doch, was du hinter deinem Tresen an den Tischen treibst. Dauernd tuschelst du mit den Kerlen, und ab und zu verschwindet einer mit einer der Ladys. Manon hat wohl einen großzügigen Anteil mit dir ausgehandelt, was?“
Diego grinste breit, seine Mundwinkel drohten die Ohrläppchen zu berühren. „Umgekehrt. Ich habe ihn mit ihr ausgehandelt.“
„Und gemeinsam haut ihr die angetrunkenen Seeleute übers Ohr, wie?“ sagte Arne von Manteuffel. „Na, das sind mir vielleicht Sitten.“
Diego wurde stockernst. „Das ist eine Unterstellung. Es geht sauber und reell zu, ohne Tricks und doppelten Boden. Die Täubchen liefern ja schließlich eine erstklassige Ware für den Preis, und ohne meine Vermittlung würde so manches Stelldichein gar nicht erst klappen. Also?“
„Also, wir ergeben uns“, erwiderte Willem Tomdijk. „Im Prinzip geht es uns ja auch nichts an, was du mit Manon ausheckst. Boussac wollte dich schließlich am Gewinn beteiligen.“
Diego beugte sich etwas vor. „Seht ihr die beiden da drüben, den rothaarigen Bretonen und den Portugiesen mit den strähnigen Haaren? Die sind auch bald reif. Sie sind von Hispaniola herüber gesegelt, um was zu erleben. Sie wissen bloß noch nicht, wie sie sich an die Mädchen ranpirschen sollen. Sie haben zu wenig Erfahrung. Aber gleich schicke ich die kleine Esther zu ihnen. Mal sehen, wen wir dann noch zur Verfügung haben.“
Arne von Manteuffel, O’Brien und Carlos Rivero musterten die beiden Neulinge unauffällig.
„So unerfahren sehen die mir nicht aus“, sagte Arne. „Vielleicht gaukeln sie dir nur was vor, Diego, um den Preis herunterzuhandeln.“
„Da liegen sie bei mir falsch. Diego läßt nicht mit sich handeln und gewährt auch keinen Kredit.“ Grinsend sah er sich nach allen Seiten um und hielt plötzlich in der Bewegung inne. Er schien jemanden entdeckt zu haben, der größere Aufmerksamkeit verdiente. Mit einem Ruck erhob er sich und eilte auf den schlanken, großen Mann zu, der völlig unbemerkt die Höhlenkneipe betreten hatte.
„El Tiburon“, sagte er mit überschwenglichem Gebaren. „Wie geht’s denn so, alter Freund? Willst du dir tüchtig einen hinter die Binde kippen? Nur zu, ich habe gerade einen prächtigen Tropfen hereingekriegt, der dir sicher zusagt. Wie wär’s mit einer Probe? Ich sitze gerade mit ein paar Freunden am Tisch, die würden dich bestimmt auch gern kennenlernen.“
Fast zerrte er den Fremden zu Arne, O’Brien, Carlos und Willem an den Tisch. Dem Mann schien es zu widerstreben, so zur Schau gestellt zu werden, aber Diego wußte, daß Arne jeden Mann von Tortuga kennenlernen wollte, und so ließ er sich die Gelegenheit nicht entgehen, einen neuen „Kontakt“ herzustellen. Immerhin war er ein Meister im Verkauf von Informationen aller Art, und auch Arne ließ sich nicht lumpen. Ein paar Silberlinge hatte er dem Dicken schon zugesteckt.
Diego hieb dem großen Mann auf die Schulter. „Hier, setz dich hin! Sieh dir diese feinen Kerle an – sie sind meine Freunde. Sie heißen Arne von Manteuffel, Oliver O’Brien, Carlos Rivero und Willem Tomdijk. He, das ist ‚El Tiburon‘, der Hai, ein Kerl wie Samt und Seide, der weder Tod noch Teufel fürchtet.“
El Tiburon setzte sich und grinste schwach. „Diego übertreibt mal wieder maßlos. Aber es freut mich, euch persönlich kennenzulernen, ich habe eure Namen nämlich schon gehört.“
„Wo?“ fragte Arne überrascht. „Wir haben dich noch nie gesehen.“
„Hier auf Tortuga. Ich bin seit acht Tagen hier, war auf der Jagd und habe von der Schlacht, die sich abgespielt hat, einiges mitgekriegt. Großartig, wie ihr die Black Queen in die Flucht geschlagen habt. Ich stehe auf eurer Seite. Von der Queen will hier so gut wie keiner was wissen, sie ist eine Gefahr für alle.“
Diego schenkte Wein nach und schob auch El Tiburon einen vollen Becher zu. Aufmerksam musterten Arne und seine drei Gefährten den großen Mann. Er war schlank, sehnig, schien voll unterschwelliger Kraft zu stecken und wirkte mit seinem dunklen Haar und dem mahagonifarbenen Teint wie der Inbegriff eines Spaniers.
„El Tiburon“, sagte Arne. „Ist das dein richtiger Name?“
„Nein, natürlich nicht. Ich heiße Joaquin Solimonte.“ Der Mann nahm einen Schluck von dem Wein und gab durch seine Miene zu verstehen, daß er ihm schmeckte. „Früher war ich einmal Decksmann auf einer spanischen Handelsgaleone – bis ich in Havanna einfach von Bord ging und mich nie wieder blicken ließ. Ich schlug mich bis nach Hispaniola durch, dort habe ich ein neues Leben als Siedler angefangen. Ich wohne in einem einsamen Landstrich der Insel und begegne fast nie einem Menschen. Manchmal habe ich das Bedürfnis, mit anderen zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen. Dann setze ich für ein, zwei Wochen nach Tortuga über.“
„Du kennst dich also auf Hispaniola aus“, sagte Willem. „Könnte man dort eine Brauerei bauen? Wie stehen die Chancen?“
„Eine Brauerei? Es gibt doch Wein genug“, entgegnete Solimonte verdutzt.
Willem grinste ihn an. „Du hast eben mein Bier noch nicht probiert. So etwas gibt es in der ganzen Karibik nicht – echten holländischen Gerstensaft. Ich schwöre dir, damit werde ich auf Hispaniola Bombengeschäfte tätigen. In El Triunfo habe ich eine Brauerei gehabt, verstehst du?“
„Ja“, erwiderte der Spanier einigermaßen verwirrt. Er wußte nicht, was er mit diesem Hinweis anfangen sollte.
Diego beugte sich über den Tisch und legte ihm die Hand auf den Unterarm. „Laß Willem reden, wundere dich nicht über ihn. Jedem, den er trifft, geht er mit seinem Geschwafel auf den Geist.“ Der dicke Holländer wollte aufbegehren, aber Diego fuhr fort: „Erzähl uns lieber deine Geschichte, El Tiburon. Jene, durch die du deinen Beinamen erhalten hast.“
„Warum?“ Solimonte schien jetzt eher konsterniert zu sein. „Du weißt doch, daß ich damit nicht gern herumprahle.“
Diego seufzte und blickte zu Arne und Oliver O’Brien. „Er sträubt sich mal wieder, dabei ist die Geschichte hochinteressant. Aber El Tiburon ist zu bescheiden, er stellt sich nicht gern heraus.“
„Ich erinnere mich nur ungern an die Begebenheit, das ist es“, sagte der Spanier.
„Trotzdem – ich will sie euch nicht vorenthalten“, sagte Diego unbeirrt. Er goß wieder Wein nach, und dann begann er zu sprechen, von Piraten und von Haien, Tiburones, den blutrünstigen, mordgierigen Schrecken aller Seefahrer, bei deren bloßer Nennung manchem ein kalter Schauer über den Rücken lief.
Nicht nur Arne, O’Brien, Carlos und der dicke Willem waren aufmerksame Zuhörer – auch Gilbert Sarraux und Joao Nazario lauschten. Vom Nebentisch aus konnten sie jedes Wort verstehen, denn Diego gab sich nicht die geringste Mühe, seine Stimme zu dämpfen. Er war ein fesselnder, mitreißender Erzähler, man konnte nicht umhin, seinem Bericht aufmerksam zu lauschen.
6.
Zwei Jahre lagen die Ereignisse zurück, an die Joaquin Solimonte noch heute mit gelindem Grauen zurückdachte. Seinerzeit hatte er noch mit einer Gruppe von Siedlern aus aller Herren Länder an der Nordküste von Hispaniola gelebt, westlich von Cabo Samaná an einer winzigen, geschützt und gut versteckt liegenden Bucht, in der das halbe Dutzend kleiner Einmaster ankerte, derer sie sich bedienten, um nachts ihre Fischernetze auszuwerfen. Einige der Glücksritter und Abenteurer waren früher Freibeuter gewesen, hatten die Piraterie aber satt und genossen ihr ruhiges, beschauliches Dasein.
Nur eine Gefahr gab es – die Haie, die die kleine Bucht verseuchten. Nie wagte einer der Siedler, ein Bad zu nehmen oder auch nur durch das flache Wasser in Ufernähe zu waten. Die Bucht schien ein Brutplatz der „Tiburones“ zu sein, der Menschenfresser, die überraschend angriffen und stets auf der Lauer lagen.
Manchmal sahen Joaquin und seine Gefährten die Dreiecksflossen, die die Fluten pfeilschnell zerschnitten. An den Lagerfeuern kursierten die wildesten und haarsträubendsten Erzählungen über Männer, die dem Blutrausch der Bestien zum Opfer gefallen waren.
Eines Nachts ging in der Bucht ein Dreimaster mit dunkel gelohten Segeln vor Anker. Viel zu spät warnte der Wachtposten die schlafenden Siedler durch seinen Pfiff. Er selbst war eingenickt und wachte erst auf, als die Besatzung der Galeone ein Beiboot abgefiert hatte und zwölf Männer an Land pullten. Ein fataler Fehler, für den die Siedler mit ihrem Blut bezahlten.
Schlaftrunken, noch halb benommen sprangen sie von ihren Lagern auf, griffen zu den Waffen und stürmten ins Freie, aber schon peitschten die ersten Musketenschüsse. Der Wachtposten brach mit einem gurgelnden Aufschrei zusammen, blieb liegen und rührte sich nicht mehr. Zwei andere Männer sanken vor den Hütten zu Boden, ein anderer blieb schwer verletzt liegen, die anderen rannten an ihm vorbei und eröffneten das Feuer auf die Angreifer.
„Ergebt euch!“ brüllte der Kapitän der Galeone auf französisch. „Ihr habt keine Chance!“ Er selbst führte das Bootskommando an, und er war der erste, der zwischen den Hütten war, seine Pistole abfeuerte und mit dem Säbel zwei Männer tötete.
Französische Piraten hatten die einsame Siedlung überfallen, um sie zu plündern und niederzubrennen. Sie waren auf der Suche nach allem, was es zu rauben gab – Gold, Silber, Juwelen, Munition und Waffen, Proviant und Wasser.
Reichtümer gab es in der Siedlung am Cabo Samaná nicht, wohl aber Pulver, Kugeln, Fisch und Wild – und die Ausrüstungen der Boote, die in der Bucht ankerten. Die Angreifer waren eine skrupellose Horde von Schnapphähnen, denen es an allem mangelte. Sie hatten ein Gefecht gegen zwei spanische Galeonen hinter sich, in dem sie arg angeschlagen worden waren und sich nur mit größter Not gerade noch rechtzeitig hatten zurückziehen können.
Nur notdürftig hatten sie die Schäden am Schiff behoben. Es war jetzt unterbemannt, es hatte mehr als ein Dutzend Tote gegeben, und zwei Freibeuter lagen im Logis im Sterben. Auch das wollte der Franzose: Männer pressen, damit die Galeone wieder voll seetüchtig und manövrierfähig wurde.
Doch der Franzose hatte nicht mit der Zähigkeit der Siedler gerechnet. Der Überraschungsangriff war gelungen, aber jetzt hatten die Überrumpelten sich gefangen und gliederten sich in zwei Gruppen auf. Die eine verteidigte verbissen die Hütten, die andere trieb eine Handvoll Piraten bis in den Urwald zurück, wo sich ein wütendes Handgemenge entwickelte.
Joaquin Solimonte kämpfte bei den Hütten, er schwang einen gewaltigen Schiffshauer und fällte einen Gegner, der ihm mit einem Entermesser entgegensprang. Dann hatte er den Kapitän vor sich – einen schwarzbärtigen, wüst aussehenden Kerl mit breitkrempigem, schwarzem Hut und schwarzer Kleidung. Joaquin griff ihn beherzt an, aber der Kerl konnte verteufelt gut fechten. Fluchend drangen sie aufeinander ein, aber keiner gewann im Kampf die Oberhand über den anderen.
Um sie herum waren das Brüllen und Fluchen der Männer, das Klirren der Blankwaffen und das vereinzelte Krachen von Musketen und Pistolen. Auch aus dem Busch drangen die Kampfgeräusche herüber – und plötzlich johlten und pfiffen die Siedler.
Es war ihnen gelungen, einen Teil der Widersacher niederzuwerfen und zu töten – nur zwei Piraten entkamen und hetzten zurück zum Boot. Vier Siedler jagten ihnen nach und stellten sie wenige Schritte von der Jolle entfernt. Noch einmal flammte das Handgemenge auf, und stöhnend sanken auch diese beiden Schnapphähne zusammen.
Die wenigen Kerle, die an Bord der Galeone zurückgeblieben waren, konnten nicht wagen, die Kanonen einzusetzen. Nichts von dem, was an Land geschah, war im Dunkeln zu erkennen. Sie riskierten, ihre eigenen Kumpane zu töten. Sie konnten nur abwarten.
Joaquin reagierte zu spät auf eine Finte des Piratenkapitäns, er mußte sich zur Seite werfen, um dem drohenden Stich zu entgehen. Er strauchelte und stürzte.
Bevor er sich herumwerfen und wieder aufrappeln konnte, war der Kerl über ihm, senste ihm den Schiffshauer aus der Hand und ließ das Heft seiner Waffe mit dem geschwungenen Handkorb auf Joaquins Kopf niedersausen. Joaquin spürte den Hieb, als habe ihn jemand mit einem Hammer geschlagen. Dann schwanden ihm die Sinne.
Die Schmerzen tosten in seinem Kopf, als habe man seinen Schädel gespalten, aber er erfaßte die Situation doch mit einem Blick, als er wieder bei Bewußtsein war. Sie hatten ihn verschleppt, er befand sich an Bord der Piratengaleone, allein unter Galgenstricken und gnadenlosen Schlagetots. Keinen seiner Kameraden hatte das gleiche Schicksal getroffen.
Er konnte sich den Zusammenhang erklären: Der Franzose hatte den Rückzug anordnen müssen. Im letzten Augenblick hatte er sich, von Schüssen verfolgt, mit seinen letzten Kerlen zum Boot gerettet und war in rasender Eile zum Schiff gepullt. Nur eine Geisel hatte er mitgenommen – ihn, Joaquin, denn noch gab er sich nicht geschlagen.
Der Schwarzbärtige stand breitbeinig vor ihm. Joaquin stellte sich bewußtlos, aber der Kerl hatte bereits bemerkt, daß sein Gefangener wieder bei Sinnen war. Sein rechter Fuß schwang zurück und zuckte vor – Joaquin bäumte sich unter dem Tritt in seine Körperseite auf. Aber er stöhnte nicht, diese Blöße wollte er sich nicht geben.
„Der Hund ist zäh“, sagte der Pirat. „Aber wir bringen ihm das Winseln bei. Er wird um Gnade flehen und seinen Hurensöhnen von Freunden raten, sich schleunigst zu ergeben.“
Joaquin schlug die Augen auf und sah den Mann haßerfüllt an. „Fahr zur Hölle! Du hast dich in uns getäuscht! Keiner wird uns besiegen, wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen!“
Ein zweiter Tritt in die Seite brachte ihn zum Verstummen.
„Wie ich höre, verstehst du meine Sprache!“ brüllte der Piratenkapitän. „Um so besser! Ich bin Chagall, der Diener des Teufels höchstpersönlich! Dich schicke ich zur Hölle, Hundesohn, und dein Schreien wird deine Bastardkumpane überzeugen, daß es besser ist, sich zu ergeben! Sag ihnen, sie sollen die Flagge streichen!“