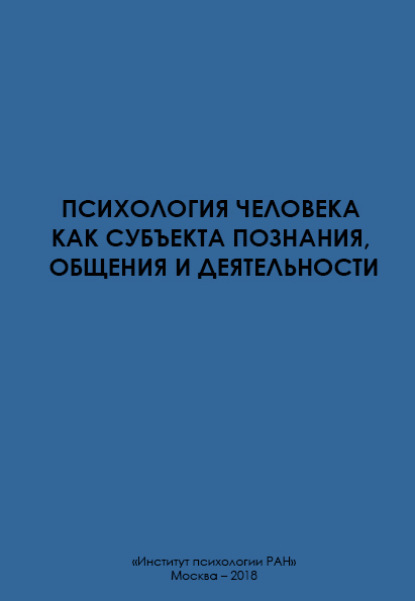Seewölfe Paket 19

- -
- 100%
- +
„Nein.“ Joaquin sprach es ruhig aus. Er wußte, daß sich Chagall an ihnen die Zähne ausbeißen würde. Die Siedler hatten sich im Urwald versteckt, sie kannten sich dort genausogut aus wie die Tiere, die in der immergrünen Selva hausten. Es nutzte Chagall nichts, das Kanonenfeuer auf die Hütten zu eröffnen und alles zusammenzuschießen, er konnte alles in Schutt und Asche legen, doch es brachte ihm nichts ein.
Die geheimen Waffen- und Munitionsdepots der Siedler befanden sich im Urwald, sie hatten alles vergraben, was ihnen gehörte. Auch Proviant und Wasser würde Chagall nicht in seinen Besitz bringen, und mit den sechs Einmastern konnte er wenig anfangen.
Er brauchte Männer, Pulver, Kugeln und Nahrung, aber wenn er erneut mit einem Stoßtrupp an Land ging, erwartete ihn das erbitterte Musketenfeuer der Siedler. Aus dem Busch heraus würden sie ein Zielschießen auf den Gegner veranstalten.
Chagalls einzige Chance lautete Erpressung. Er befand sich in einer verzweifelten Situation und mußte sie zu seinen Gunsten lösen, sonst hatte er auch vor seinen Männern verspielt, und es bestand die Gefahr einer Meuterei.
„Bastard“, sagte er. „Ich habe einiges über diese Bucht vernommen. Sie ist klein, aber fein, nicht wahr? Sie hat den Ruf einer Mördergrube. Requins tummeln sich hier, Haie, die nur auf ein Opfer warten. Wenn sie deine Beine verschlungen haben, wird dein Gebrüll die Narren, die im Dschungel hocken, zur Kapitulation zwingen.“
„Hier gibt es keine Haie“, sagte Joaquin in gebrochenem Französisch. Er sprach Spanisch und Französisch durcheinander.
Die Piraten quittierten seine Worte mit brüllendem Gelächter. Chagall beugte sich zu ihm hinunter und setzte ein süffisantes, falsches Lächeln auf.
„Keine Haie?“ wiederholte er mit vorgetäuschter Freundlichkeit. „Das ist gut für dich. Du hast eine Chance, mein Freund, ich gewähre sie dir, großzügig, wie ich bin. Du gehst von Bord und schwimmst zum Ufer. Wenn du es schaffst, bist du frei. Willst du mir nicht danke schön sagen?“
Joaquin spuckte ihm mitten ins Gesicht. Chagall stieß eine lästerliche Verwünschung aus, das Übelste und Gemeinste, was der Spanier je vernommen hatte. Zwei Kerle rissen Joaquin von den Planken hoch, traten und schlugen ihn und zerrten ihn zum Backbordschanzkleid des Hauptdecks. Sie zogen ihn bis auf eine kurze Hose aus, dann trafen sie Anstalten, ihn ins Wasser zu werfen.
„Halt!“ rief Chagall. „Er soll langsam sterben. Er soll kämpfen und schreien und seine Kumpane das Grausen lehren. Gebt ihm ein Messer! Na los, wird’s bald?“
Einer der Kerle drückte Joaquin mit einem Fluch sein Messer in die Hand. Joaquin wollte sich auf Chagall stürzen, doch sie hielten ihn zurück, und wieder setzte es Prügel. Chagall lachte roh und gab seinen Kerlen ein Zeichen. Sie hoben Joaquin hoch und schleuderten ihn außenbords.
Im Fall stieß er sich den ohnehin schon lädierten Kopf an den Berghölzern. Ihm wurde übel, er drohte das Bewußtsein zu verlieren. Doch als er ins Wasser klatschte, kehrten seine Sinne voll zurück. Er drehte sich um die Körperachse, tauchte wieder auf, schöpfte Luft und nahm das Messer zwischen die Zähne.
Er begann zu schwimmen und hörte, wie Chagall über ihm schrie: „Musketen – Feuer!“
Noch eine Variante des grausamen Spiels also – und Joaquin Solimonte wußte, daß er sterben würde.
7.
Übermächtig ist der Selbsterhaltungstrieb in jedem normalen Menschen – Joaquin wollte sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Es nutzt wenig, ein guter Schwimmer zu sein, wenn ein oder zwei Dutzend lachender Piraten mit Musketen, Arkebusen und Tromblons ein Zielschießen auf einen veranstalten.
Die ersten Schüsse belferten, die Kugeln sirrten heran. Trotz der Dunkelheit bot Joaquins nackter Körper ein gut sichtbares Ziel, er schimmerte weißlich im Mondlicht.
Joaquin zog sich blitzschnell unter Wasser zurück. Ein guter Taucher, das war er schon immer gewesen. Vor vielen Jahren hatte er einen Mann aus Zipangu kennengelernt, der ihm das Tauchen nach Austern beigebracht hatte. Diesem Mann war er jetzt dankbar. Joaquin konnte sich unter Wasser aufhalten und bis hundert zählen, seine Atemluft reichte so lange aus.
Er schwamm bis auf den Grund der Bucht, hielt dann auf das Ufer zu und betete in Gedanken zum Himmel. Mein Gott, bewahre mich vor den Haien! Jesus, Maria, seid gütig und rettet mich!
Die Atemnot begann, er mußte wieder aufsteigen. Seine Lungen taten weh, drohten zu platzen. Er schoß ein Stück aus dem Wasser, schöpfte japsend frische Luft – und blickte über die Schulter in das Aufblitzen von drei, vier Musketen. Noch hatte er sich nicht weit genug von Chagall und dessen Spießgesellen entfernt, noch war er dem höllischen Feuer der Waffen ausgesetzt.
Wie zornige Hornissen zirpten die Kugeln auf ihn zu. Er fiel ins Wasser zurück, glaubte, ihnen zu entgehen, doch plötzlich streifte etwas siedend heiß seine rechte Schulter. Fast schluckte er Wasser. Taumelnd bewegte er sich in den Fluten, die Schmerzen drohten ihm erneut die Sinne zu rauben.
Doch er blieb bei Bewußtsein. Um ein Haar verlor er das Messer, er hatte es beim Luftschnappen in die rechte Hand genommen. Das Entsetzen war schlimmer als die Schmerzen. Blut! Er hatte nur einen Streifschuß empfangen, aber das Blut lockte die Haie an. Er wußte es – und es war ein Ammenmärchen, daß die Haie nachts schliefen und nicht angriffen. Alles, was über die gefürchteten Mörder erzählt wurde, war unwahr, nur eins stimmte: Blut brachte sie um den Verstand und verwandelte sie in rasende Bestien.
Tintenschwarz war das Wasser, und Joaquin konnte nichts von dem, was um ihn herum geschah, sehen. Doch er spürte die Bewegung hinter sich und fuhr herum. Zähne, wie Perlen an einem Band aneinandergereiht, schimmerten zum Greifen nah, gewaltige Kiefer klafften auf – der Hai war da!
Joaquin handelte instinktiv und versuchte auszuweichen. Er wußte nicht, ob er es seiner Bewegung oder einem Zufall zu verdanken hatte, aber er geriet unter den grauen Bauch des Hais und sah ihn über sich hinweggleiten. Ohne zu zögern stieß er mit dem Messer zu. Er fühlte den Widerstand, schloß die Augen, stieß wieder und wieder zu und ahnte, daß dies nur der Auftakt seines Endes sein konnte.
Ein Schemen im Nichts, ein Ungeheuer der Finsternis schien der nächste düstere Leib zu sein, der heranhuschte. Joaquin drehte sich, hackte mit dem Messer um sich, alles schien in Bewegung zu sein, das Wasser quirlte zu wühlendem, schwanzschlagendem, zähnebeißendem Leben auf, und mittendrin schwamm er, der nackte, ungeschützte, verwundbare Mann.
Er stach zu, wie von Sinnen, traf wieder, hatte Glück und entging dem Zuschnappen der messerscharfen Zähne, aber er begriff kaum noch, was um ihn herum geschah.
Ein Alptraum, der ihn in gewitterdurchtobten Nächten gequält hatte, wurde wahr: Er ritt den Hai und klammerte sich an seiner Rückenflosse fest, er hieb mit dem Messer zu und traf ein drittes Mal – dann schoß er wie von einem Katapult geschnellt durch das Wasser auf das Ufer zu.
Keine Luft, es stach in seinen Lungen, aber er fühlte Grund unter seinen Füßen. Er kämpfte, arbeitete sich voran, wühlte sich auf allen vieren durch Schlick, glaubte zu ersticken, zu ertrinken, und doch richtete er sich plötzlich aus dem Wasser auf und watete wankend an Land. Wie ein Betrunkener torkelte er vorwärts, stolperte durch seichte Wellen und durch Gischt und stürzte auf dem Sand auf die Knie.
Ein Stöhnen entrang sich seinen Lippen. Wie im Fiebertraum nahm er die Gestalten neben sich wahr, sie tauchten wie im Spuk auf, packten ihn unter den Achseln und schleppten ihn fort.
Gebrüll vom Schiff der Piraten verkündete, daß Chagall und seine Meute verfolgt hatten, wie sich Joaquin an Land gerettet hatte. Wutentbrannt ließ Chagall die Kanonen zünden. Aber die donnernde Breitseite erfolgte zu spät.
Die Siedler, die Joaquin zu Hilfe geeilt waren, erreichten mit dem taumelnden Spanier das Dickicht und brachten sich in Sicherheit, während die Siebzehnpfünderkugeln im Strand einschlugen und Sandfontänen hochspritzten.
Keiner wurde durch die Kugeln verletzt. Die Männer legten sich platt auf den Untergrund und warteten auf die nächste Breitseite. Doch von Bord der Piratengaleone tönte nur Gebrüll zu ihnen herüber.
Chagall wollte keine Munition mehr vergeuden, er wußte, daß er verloren hatte. Außerdem lag er mit seinen Kerlen im Streit. Sie warfen ihm vor, ein Versager zu sein. Chagall vermochte sich nur durch eine blitzschnelle, rigorose Aktion zu behaupten: Er griff den Wortführer der Meuterer an und tötete ihn im Kampf mit dem Messer.
Klatschend landete die Leiche des Piraten in der Bucht. Chagall brüllte auf die Bande ein, die jetzt wieder gehorchte. Der Anker wurde gelichtet und gekattet, dann setzten die Kerle die Segel, und das Schiff glitt aus der Bucht des Schreckens.
Die Siedler rechneten zunächst mit einem Trick der Freibeuter, doch in diesem Punkt täuschten sie sich. Chagall kehrte nicht zurück. Er segelte weiter und suchte nach einem neuen Opfer, das leichter zu überwältigen war.
Erst im Morgengrauen kehrten die Siedler zu ihren Hütten zurück. Sie bargen und bestatteten die Toten und versorgten die Verwundeten.
Ein Landsmann von Joaquin Solimonte, ein Katalane namens Rosario, deutete auf die Bucht und sagte: „Der tote Pirat ist verschwunden, die Tiburones haben ihn verschlungen. Aber du hast nicht nur Chagall, sondern auch den Haien eine schwere Niederlage zugefügt, Joaquin. Wir werden dich von jetzt an nur noch ‚El Tiburon‘ nennen.“
„Ich habe nur meine Pflicht euch gegenüber getan“, sagte Joaquin. „Ich wollte nicht, daß ihr meinetwegen aufgebt.“
„Chagall wollte ein Exempel statuieren“, sagte Rosario. „Es ist ihm gründlich mißlungen. Und du hast ein Zeichen gesetzt – El Tiburon. Wir werden dir das nie vergessen.“ Er wies noch einmal auf die Bucht – und da blickte auch Joaquin in diese Richtung. Er sah die toten Haie, die mit den Bäuchen zuoberst im Wasser trieben.
„Acht Haie“, sagte Diego und verdrehte etwas die Augen. „Das muß man sich mal vorstellen. Dieser Rosario war mal hier und hat mir alles erzählt, deshalb weiß ich es. Von El Tiburon selbst hätte ich es nie erfahren, er stellt sein Licht ja immer unter den Scheffel.“
„Weil Leute wie du das Blaue vom Himmel herunterlügen“, sagte Solimonte, der jetzt ziemlich ärgerlich wirkte. „Es waren nur drei Haie, das weißt du genau.“
„Rosario sprach aber von acht Haien.“
„Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte der Spanier. „Rosario ist ein aufrichtiger Mann. Aber diese verflixte Geschichte ist immer weiter ausgesponnen worden, und in zwei Jahren haben sich die verdammten Haie vermehrt. Man darf keinem dieser Strolche etwas anvertrauen, sie schwindeln, daß sich die Balken biegen.“ Die letzten Worte hatte er an Carlos Rivero gerichtet, der ihm aufmunternd zulächelte.
„Laß nur“, sagte Carlos. „Diego ist eher noch bescheiden gewesen. Ich kenne Seeleute, die noch zu viel schlimmeren Übertreibungen imstande sind und jede Menge aus der eigenen Phantasie hinzudichten.“
„Ja“, pflichtete O’Brien ihm bei. „Sämtliche Hafenkneipen in England müßten beispielsweise hufeisenförmig gebogene Balken haben – wegen des vielen Seemannsgarns, das dort an den Tischen zum besten gegeben wird.“
„Ich dichte nichts hinzu“, erklärte Diego. „Rosario selbst sagte, daß nach deinem Kampf mit den Haien die Siedler so – äh – motiviert waren, daß sie jederzeit einen neuen Kampf gegen die Piraten gewagt hätten. Oder stimmt das etwa auch nicht?“
„Das stimmt“, erwiderte Joaquin. „Aber ich bleibe dabei: Es waren drei Haie. Ich muß es wohl wissen.“
Arne von Manteuffel beherrschte die spanische Sprache recht gut, er hatte in den vergangenen Wochen fleißig gelernt. Was er noch nicht verstand, ließ er sich von Carlos Rivero oder Willem Tomdijk übersetzen.
Jetzt wandte er sich an Joaquin und sagte: „Immerhin. Auch der Kampf gegen drei Haie reicht schon. Meine Hochachtung. Deine Gefährten haben recht, wenn sie dich El Tiburon nennen.“
„Das ist mir egal“, entgegnete Joaquin. „Ich lege ohnehin keinen gesteigerten Wert darauf, aber der Name haftet mir nun mal an. So etwas wie damals will ich nie wieder erleben, ich habe es mir geschworen. Ich hasse die Haie.“
„Auch auf der ‚Le Vengeur‘ gibt es einen Mann, der Ähnliches erlebt hat“, sagte Arne von Manteuffel. „Er heißt Mel Ferrow und wird der Mann mit dem Haizeichen genannt. Ribault hat mir erzählt, daß er mal einen mörderischen Kampf mit einem Hai geführt hat. Seitdem trägt er eine entsetzliche Bißnarbe auf dem Rücken. Wenn jemand von Haien spricht, kann er fuchsteufelswild werden.“
„Ich kann den Mann gut verstehen“, sagte Joaquin.
Diego kicherte. „Paß auf, daß du nie auf die Totenrutsche gerätst. Du weißt ja, auch um Tortuga herum wimmelt es von Haien.“
„Ja“, erwiderte Joaquin. „Da sagst du mir nichts Neues. Doch laßt uns jetzt das Thema wechseln. Ich bedaure, daß ich während eures Gefechts gegen die Black Queen nicht hier im Hafen war. Als ich aus den Bergen zurückkehrte, waren vier von euren Schiffen schon wieder ausgelaufen. Ich habe aber den Schußwechsel beobachtet und gesehen, wie die Piratengaleonen versenkt wurden. Großartig. Später haben mir die Leute hier im Hafen alles erzählt. Ich bedaure, daß ich den Seewolf nicht persönlich kennengelernt habe.“
„Und Siri-Tong“, fügte Diego grinsend hinzu. „Mein lieber Mann, sie ist ein Prachtbild von Frau.“
„Laß dich nicht weiter aus“, sagte Carlos Rivero drohend. „Die Rote Korsarin ist für jeden tabu. Aber eins ist sicher, Joaquin, auch Hasard, Siri-Tong, Ribault, der Wikinger und Jerry Reeves hätten gern ein paar Worte mit dir gewechselt. Du scheinst ein feiner Kerl zu sein, man sitzt gern mit dir zusammen und trinkt ein Gläschen.“
Diego nahm dies als Aufforderung und füllte erneut die Becher. Joaquin trank einen Schluck, dann nickte er Arne, O’Brien, Carlos und dem dicken Willem zu. „Danke. Eigentlich hatte ich nie damit gerechnet, Männer wie euch in der Schildkröte anzutreffen.“
„Was soll denn das nun wieder heißen?“ fragte Diego.
„Daß hier sonst das übelste Gesindel verkehrt“, erwiderte Joaquin. „Das weißt du doch selbst am besten. Eines Tages gerätst du an den Verkehrten, Diego, und wirst wegen deines Herumspionierens und des Handels mit Informationen gepfählt oder gevierteilt. Oder du saust selbst die Totenrutsche hinunter.“
Diego war viel zu hartgesotten, um sich von solchen Worten beeindrucken zu lassen.
„Nett, wie du das sagst“, erwiderte er und grinste breit und ausgiebig. „Es freut mich immer, wenn mir jemand eine glückliche Zukunft voraussagt.“
Die Männer lachten und stießen miteinander an. Joaquin lag eine Frage auf der Zunge, er sprach sie jetzt aus. „Diese vielen Siedler von El Triunfo, die jetzt auf Tortuga sind – was soll aus ihnen werden? Es gibt doch nicht genügend Unterkünfte, und die Insel selbst ist auch ziemlich klein. Für diese Männer dürfte es mit der Zeit ein Problem werden, hier zu leben – wegen des begrenzten Wildbestandes, meine ich. Auf Dauer gesehen, wird es an der Verpflegung mangeln.“
„Wie sieht es denn auf Hispaniola aus?“ fragte Arne von Manteuffel.
„Ihr wißt ja, wie groß Hispaniola ist“, erwiderte Joaquin. „Dort läßt es sich gut leben. Auch Hunderte von Männern würden sich von dem, was das Land und die See hergeben, ernähren können. Man muß nur den erforderlichen Pioniergeist haben und alles aufbauen, was man braucht.“
„Kennst du denn ein Plätzchen, an dem sich unsere Leute ansiedeln könnten?“ fragte Willem.
„Ja.“
„Darüber müssen wir uns noch ausführlicher unterhalten“, sagte Arne. „Vielleicht wird Hispaniola für die Menschen aus El Triunfo wirklich eine neue Heimat. Wann werdet ihr darüber entscheiden, Willem?“
„Wenn sich die Wogen der jüngsten Geschehnisse ein bißchen geglättet haben“, erwiderte der Dicke. „Noch sind alle viel zu aufgeregt. Bei einer Versammlung würde sich nicht viel ergeben. Ich habe da meine Erfahrungen. Schließlich bin ich der Bürgermeister von El Triunfo gewesen.“
Joaquin wollte wissen, was in El Triunfo vorgefallen war, und Willem berichtete ihm ausführlich von dem Überfall des spanischen Verbandes.
Diego stand auf und kehrte zu seinen Thekengästen zurück. Über die Vorfälle an der Küste von Honduras wußte er ja bereits Bescheid, die Sache war nichts Neues für ihn. Lieber kümmerte er sich wieder um sein Geschäft.
Unauffällig gab er Esther einen Wink. Sie sollte sich mit den beiden „Neuen“ beschäftigen. Esther verstand und lächelte Diego zu. Dann setzte sie sich in Bewegung und durchquerte mit aufreizendem Hüftschwung die Kneipe.
Sarraux und Nazario hatten sich die ganze Zeit über geschickt im Hintergrund gehalten und fast jedes Wort von dem gehört, was an Arne von Manteuffels Tisch gesprochen worden war. Einiges konnten sie sich jetzt schon zusammenreimen, und sie waren sicher, daß die Informationen auf das Interesse der Black Queen stoßen würde.
Esther hatte jettschwarzes Haar, ihre Augen waren dunkel und geheimnisvoll. Ihr Teint war eindeutig südländisch. Irgendwie erinnerte sie Nazario entfernt an Annamaria von Punta Gorda. Esther war genau sein Typ, er sprach sofort mit ihr, als sie sich dem Tisch näherte.
Gilbert Sarraux wollte nicht das dritte Rad am Wagen sein. Er entfernte sich und traf in einer Ecke der Kneipengrotte auf ein anderes Mädchen, das sich bereitwillig zu einem Glas Wein einladen ließ. Da sich auch die Runde um Joaquin Solimonte inzwischen auflöste, sah er keinen Grund dafür, noch länger bei Nazario zu bleiben.
Arne von Manteuffel und Oliver O’Brien verließen die „Schildkröte“ und kehrten an Bord der „Wappen von Kolberg“ zurück. Auch Carlos Rivero ging, nur Willem Tomdijk blieb noch mit Joaquin zusammen, aber sie gesellten sich zu Diego an die Theke, so daß es vorläufig für Nazario und Sarraux nichts mehr aufzuschnappen gab.
Was die Ereignisse in El Triunfo betraf, von denen der dicke Holländer immer noch sprach, so waren der Bretone und der Portugiese im übrigen sicher, daß es zu diesem Thema keine Neuigkeiten mehr für die Queen gab. Sie war ja selbst in El Triunfo gewesen, das hatte sie den beiden erzählt, bevor sie sich in Punta Gorda getrennt hatten.
Joao Nazario hatte also Zeit und Muße, sich dem Mädchen Esther zu widmen. Wie es schien, verstanden sie sich sehr gut miteinander.
„Du bist mein Fall“, sagte Nazario. „Wir zwei könnten einiges zusammen unternehmen.“
„Das glaube ich auch“, sagte Esther lächelnd. Sie versäumte nicht, ihre Oberweite durch einen leichten Ruck nach vorn vollendet zur Geltung zu bringen. „Zum Beispiel könnten wir noch ein Glas Wein zusammen trinken.“
Er mußte lachen. „Ja, natürlich.“ Diego war gerade in Sichtweite, Nazario drehte sich um und winkte ihm zu. Wenig später waren die Becher neu aufgefüllt, und Nazario prostete Esther zu.
„Was hat dich eigentlich hierher verschlagen?“ fragte er.
„Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir später.“
„Und woher stammst du?“
„Aus Paris.“
„Du bist dort geboren?“
„Nein“, antwortete sie. „Wo meine Wiege stand, weiß ich selbst nicht.“
„Du bist noch sehr jung“, sagte er mit einem prüfenden Blick.
„Einundzwanzig“, sagte sie. „Aber unser Gespräch soll doch wohl hoffentlich nicht in ein Verhör ausarten.“
Er schüttelte den Kopf. „Nein, nein. Gibt es hier kein ruhigeres Plätzchen, an dem man sich ganz ungestört unterhalten kann?“
„Doch. Aber ganz einig sind wir uns noch nicht, oder?“ Sie blickte ihn mit verschmitzter Miene an.
„Wie wär’s mit einem Silberling?“ fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. „Der reicht nicht mal für einen Spaziergang am Hafen. Sagen wir – drei Silberlinge.“
„Und was bietest du dafür?“
„Siehst du das nicht?“
Er beugte sich zu ihr hinüber und blickte in ihren Ausschnitt. Dann rückte er grinsend näher zu ihr heran. „Ich meine etwas anderes. Ich stelle ganz bestimmte Forderungen.“ Er setzte ihr auseinander, was er von ihr verlangte, in allen Einzelheiten.
„Einverstanden, wenn du fünf Münzen springen läßt.“
„Es bleibt bei drei Silberlingen“, sagte er.
„Schönen Dank für den Wein“, sagte sie. „Aber wenn das so ist, gehe ich lieber.“ Sie wollte aufstehen, aber er hielt sie am Arm fest.
„Hör mal, ist denn das, was ich will, so ungewöhnlich?“ fragte er mit etwas heiserer Stimme.
„Ziemlich.“
„Gut, dann schlage ich vier Silberlinge vor.“
Sie schien zu zögern, dann aber willigte sie ein, und das Feilschen hatte ein Ende. Nazario zahlte die Zeche. Sie verließen die Kneipengrotte. Es war schon seit einiger Zeit dunkel geworden. Sterne funkelten am samten wirkenden Nachthimmel. An den Piers und an der Kaimauer plätscherte das Wasser. Joao Nazario atmete tief durch, legte die Hand um Esthers Hüfte und dachte, was für ein guter Gedanke es doch gewesen war, nach Tortuga zu segeln.
„Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt“, sagte er.
„Esther.“
„Gut, Esther. Ich heiße Joao.“
„Wir werden zwei schöne Stunden miteinander haben“, sagte sie, aber sie wußte nicht, wie sehr sie sich irrte.
8.
Sie stiegen zu einer höher in den Bergen gelegenen Hütte hinauf, die Esther für ihr Gewerbe übernommen hatte. In der „Schildkröte“ war nicht genug Raum für alle Mädchen und deren Freier, und so waren viele von ihnen auf Unterkünfte ausgewichen, die ihnen selbstverständlich Diego empfohlen hatte, der dafür wiederum „Vermittlungsgeld“ kassierte.
Die Hütte war bis vor einem Jahr von einem alten Seemann bewohnt worden, den eines Tages ein Kreole im Inselurwald tot aufgefunden hatte. Man wußte nicht, woran der Alte gestorben war, aber es hieß, es sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen.
Weiter wurde gemunkelt, auf der Hütte laste ein Fluch, und so hatte jeder den rot angestrichenen, etwas windschiefen Bretterverschlag gemieden. Diego hatte Esther natürlich nichts von dem Gerede erzählt, aber sie war im übrigen auch nicht abergläubisch und hätte sich ohnehin den Teufel darum geschert.
Esther öffnete die in rostigen Angeln knarrende Tür, tat drei Schritte bis in die Mitte des Raumes und entfachte eine Öllampe, deren Docht weit heruntergedreht war. Im dämmrig-rötlichen Licht trat auch Joao Nazario ein, drückte die Tür hinter sich zu und blieb stehen.
Sein Blick war auf das Mädchen gerichtet. Sie drehte sich zu ihm um und begann, an ihrem Kleid zu nesteln.
„Möchtest du Wein trinken?“ fragte sie ihn.
„Später. Jetzt möchte ich etwas anderes.“
Esther ließ ihr Kleid zu Boden gleiten. Als auch Joao Nazario sich seiner Sachen entledigt hatte, sanken sie auf das Lager und ließen sich vom Rausch der Leidenschaft entführen. Nazario war ein temperamentvoller, ausdauernder Liebhaber. Esther enttäuschte ihn in keiner Beziehung.
Später saßen sie nebeneinander auf dem zerwühlten Nachtlager, und Esther steckte sich die Haare hoch.
„Du warst gut, das muß man dir lassen“, sagte sie.
„Also gibt es einen Preisnachlaß?“
„Nein, auf keinen Fall.“
„Keine Angst, du kriegst dein Geld“, sagte er lachend. „Ich bleibe auch noch ein paar Tage und schätze, daß wir uns wiedersehen – vielleicht schon morgen nacht.“
„Ich wäre nicht abgeneigt“, sagte sie. Aber wie würde es sein, wenn sie erst ein bürgerliches Dasein führte? Die Siedler von El Triunfo waren die Verbündeten des Seewolfs, sie würden mit größter Wahrscheinlichkeit in Hispaniola seßhaft werden, wie das vereinzelt schon angeklungen war. Der eine oder andere Kerl interessierte sie, sie konnte ihn sich als Ehemann vorstellen.
Aber war das auf Dauer etwas für sie? Würde sie irgendwann nicht doch ihrem Gewerbe nachtrauern? Darüber nachzudenken, war dringend erforderlich. Sie nahm sich auch vor, mit Manon und den anderen darüber zu sprechen.
Nazario überlegte, daß die Gelegenheit günstig sei, das Mädchen ein wenig auszuhorchen. Vielleicht wußte sie das, was Sarraux und ihm an Information noch fehlte.
„Bist du schon lange hier?“ fragte er sie.
„Nicht sehr lange. Erst ein paar Tage. Meine Freundinnen und ich sind mit einer Galeone aus Frankreich herübergesegelt“, erwiderte sie.