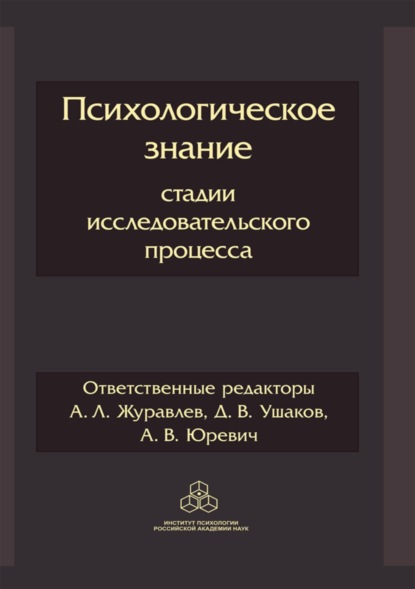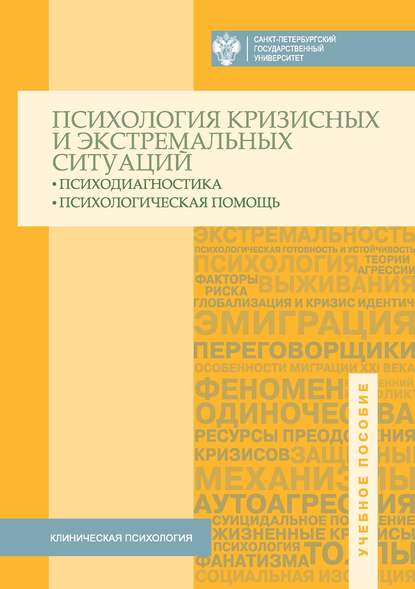Seewölfe Paket 19

- -
- 100%
- +
Willem Tomdijk war zum Richter, Arne von Manteuffel zum ersten Beisitzer gewählt worden. Alles, was Beine hatte auf Tortuga, war zu dem Gerichtstermin erschienen. Ein zweiter und dritter Beisitzer waren rasch ausgesucht: Diego und Carlos Rivero nahmen neben dem dicken Willem und dem Vetter des Seewolfs Platz.
Sarraux und Nazario mußten in die Mitte der Versammlung treten. Pedro und der grauhaarige Engländer aus Northumbria mußten Manon zurückhalten, als sie sich auf die Angeklagten stürzen und auf sie einschlagen wollte. Manch einer hätte gern Selbstjustiz geübt, die Stimmung war drohend.
Der Bretone und der Portugiese schienen in sich zusammenzukriechen. Sie hatten jetzt Angst. Sarraux’ Blick war flackernd, Nazario kaute ununterbrochen auf der Unterlippe herum.
Willem Tomdijk eröffnete die Verhandlung. Eine Veränderung schien sich an ihm vollzogen zu haben. Er war nicht mehr der gutmütige Dicke, den er sonst gern zur Schau stellte. Der Blick seiner schmutziggrauen Augen war kalt, seine Miene starr und etwas verkniffen.
Völlig reglos hockte er da und sagte: „Noch einmal: Die Anklage lautet auf Doppelmord. Ihr beiden, Sarraux und Nazario, habt das Mädchen Esther und den Spanier Joaquin Solimonte, genannt El Tiburon, brutal umgebracht. Gesteht endlich! Gebt es zu! Ihr habt keine Chance, es abzustreiten!“
„Wer behauptet denn, daß wir mit diesem El Tiburon überhaupt etwas zu tun hatten?“ fragte Nazario.
„Ich!“ schrie Pedro. „Ich habe ihn überall gesucht und nicht gefunden! Dann haben wir euch Hundesöhne an der Totenrutsche erwischt! Ihr habt ihn runtersausen lassen, das ist völlig klar!“
„Es wäre besser gewesen, die beiden gleich hinterherzustoßen!“ rief Manon.
Willem Tomdijk schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Es gab einen scharfen, knallenden Laut, und der Tisch begann bedrohlich zu wackeln.
„Ruhe!“ sagte er laut. „Reden darf nur, wer etwas gefragt wird. Zuwiderhandlungen werden geahndet.“
Stille trat ein. Die meisten Männer und auch die Mädchen aus Paris fragten sich, warum mit den Spionen soviel Aufhebens gemacht wurde. Das beste wäre doch wohl gewesen, sie nach draußen zu schleppen und am nächsten Baum aufzuknüpfen.
Aber Willem, Arne, Carlos, O’Brien und sogar Diego waren anderer Meinung. Fair sollte es zugehen, eine ordentliche Gerichtsverhandlung hatte auch der letzte Lumpenhund verdient. Willem fixierte den Portugiesen.
„Was hast du also zu deiner Verteidigung zu sagen?“ fragte er.
„Daß wir El Tiburon nicht getötet haben“, erwiderte Nazario. „Zeigt uns die Leiche. Ohne Leiche kein Mord. Überhaupt – ich glaube nicht, daß er tot ist.“ In Wirklichkeit war er davon überzeugt, aber Sarraux und er hatten El Tiburon nicht mehr gesehen, nachdem sie ihn von der Totenrutsche gestoßen hatten. Es war anzunehmen, daß die Haie den Mann zerrissen und gefressen hatten.
„El Tiburon ist überall gesucht worden“, erklärte Diego. „Ohne Erfolg. Er ist verschwunden. Das viele Blut im Wasser unterhalb der Totenrutsche kann nur eins bedeuten: Die Haie haben ihn getötet. Diesmal war er nicht schnell genug.“
Wieder drohte Unruhe aufzukeimen, aber Willem Tomdijk behauptete sich in seiner Rolle als Richter. Er verstand es, sich den nötigen Respekt zu verschaffen. Das begriffen auch die Angeklagten – und Sarraux begann, den dicken Mann zu fürchten. Er hatte gehofft, sich herausreden zu können, begriff aber, daß dieser Tomdijk in keiner Weise zu beeinflussen war.
„Beschränken wir uns vorerst auf den Mord an Esther“, sagte Willem. „Joao Nazario, du hast mit ihr eine Liebesnacht verbracht, dafür gibt es mehr als einen Zeugen. Im Gespräch mit dir hat sie begriffen, daß du ein Spion bist, hat dir einen Schlaftrunk verabreicht und wollte uns benachrichtigen. Aber irgend etwas hat nicht geklappt. Du hast sie überrascht und getötet.“
„Nein.“ Nazario vermied es, die Umstehenden anzuschauen. Schon gar nicht mochte er zu dem Platz blicken, an dem Esther bis vor kurzem noch aufgebahrt gewesen war. Inzwischen war sie von ihren Freundinnen bestattet worden, doch vier Kerzen brannten noch in der Nische der Kneipengrotte, in der alle ihr die letzte Ehre erwiesen hatten. „Nein“, wiederholte er. „Ich war es nicht. Ich wollte sie festhalten, aber sie ist gestolpert und …“
„Und hat sich den Kopf gestoßen. An einem Stein“, fuhr Sarraux fort.
„Und dabei hat sie sich so unglücklich gedreht, daß sie auf ein verkehrt herum in den Boden gerammtes Messer gefallen ist“, sagte Diego höhnisch. „Nur so kann sie sich die schwere Wunde zugezogen haben, oder?“
Die Last der Beweise war erdrückend. Willem, Arne, Diego und Carlos sprachen auf die Gefangenen ein, mal beschwörend, mal drohend und zornig. Schließlich war es Gilbert Sarraux, der als erster einsah, daß alles Leugnen keinen Sinn mehr hatte. Seine Miene nahm, gut gespielt, einen weinerlichen Ausdruck an. Dabei sah er mitleidheischend zu Willem.
„Was ist, wenn wir gestehen und – alles erzählen?“ fragte er. „Kriegen wir dann – mildernde Umstände?“
„Nein“, erwiderte Willem kalt. „Das Gericht läßt nicht mit sich feilschen. Mord bleibt Mord.“
„Hier wird nur beschlossen, auf welche Art ihr sterben werdet“, sagte Arne von Manteuffel.
„Manon hat recht“, sagte Diego. „Die Totenrutsche wäre genau das richtige für die Hunde.“
Joao Nazarios Gesicht wurde kalkweiß. „Nein! Das könnt ihr nicht mit uns tun! Das ist – ungesetzlich!“
„Wir bestimmen, welches Gesetz auf Tortuga gilt“, sagte Carlos Rivero. „Ich denke, im Namen aller Anwesenden zu sprechen und die richtige Definition gewählt zu haben.“
„Richtig!“ schrie die Versammlung.
„Ich war es!“ stieß Sarraux mit schriller Stimme hervor. „Ja, ich! Ich habe das Mädchen ertappt, als mein Freund besinnungslos am Boden lag! Ich …“
„Ich räche dich, Esther!“ schrie Manon. Sie hatte ein Messer an sich gerissen und wollte sich damit auf den Bretonen stürzen, doch wieder waren es die Männer, die geistesgegenwärtig genug waren und sie zurückhielten.
„Weiter, Angeklagter“, sagte Willem.
Wieder breitete sich Schweigen aus, in das die helle, gehetzt klingende Stimme des Bretonen fiel.
„Ich wußte nicht, was ich tat“, sagte er. „Ich dachte, Joao sei tot. Er ist mein bester Freund, mein Bruder. Das müßt ihr verstehen. Ich wollte von dem Mädchen wissen, was los wäre, aber sie schrie nur und riß vor mir aus. Da habe ich das Messer nach ihr geschleudert. Aber – ich wollte sie nur verletzen.“
„Mit Sicherheit“, sagte Carlos. „Soviel Menschlichkeit würde ich einem Galgenvogel wie dir jederzeit zutrauen. Es war also ein Unfall, daß das arme Ding gestorben ist.“
„Sozusagen, ja“, erwiderte der Bretone.
„Gilbert wollte sie nicht töten“, fügte Nazario sofort hinzu. „Er hatte ja kein Interesse daran. Und ich – ich mochte diese Esther, wirklich. Wäre ich bei Bewußtsein gewesen, dann, äh – wäre sie noch am Leben, denn ich hätte verhindert, was Gilbert getan hat.“
„Genug“, sagte Diego. „Das reicht. Mir wird gleich schlecht.“
„Wirklich geschmacklos und abstoßend zugleich“, sagte Willem. „Weiter jetzt. Wo habt ihr El Tiburon gefaßt, als ihr auf der Flucht wart?“
„In dem Hohlweg“, entgegnete Sarraux und beschrieb die Lage der Höhle, in der sie sich versteckt hatten. „Wir hörten ihn, und da hat Joao auf ihn gelauert und ihm eins mit einem Stein übergezogen. Es ist die volle Wahrheit, ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist.“
„Euch Kerlen ist nichts heilig“, sagte Carlos.
„Weiter, weiter“, drängte Willem. „El Tiburon kam euch gerade recht. Ihr brauchtet ja jemanden, den ihr aushorchen konntet. Habt ihr ihn gefoltert? Hat er gesprochen? Was wolltet ihr von ihm wissen? Wer ist überhaupt euer Auftraggeber?“
„Er hat nichts ausgespuckt“, erwiderte Nazario. „Er ist ein ganz hartgesottener Kerl, das muß man ihm lassen. Wir wollten alles von ihm wissen – alles über Tortuga, und wo die Schiffe des Seewolfs abgeblieben sind.“
„Die Black Queen schickt uns“, sagte Sarraux mit jammernder, weinerlicher Stimme. „Warum sollen wir das noch länger verheimlichen? Sie hat sich nach der Schlacht, die hier stattgefunden hat, nach Hispaniola verholt, zur Nordküste. Sie liegt in Punta Gorda, dort haben wir sie in der Hafenkneipe ‚El Escarabajo‘ getroffen.“
„Sie hat uns angesprochen“, sagte Nazario in freizügiger Veränderung des wahren Sachverhalts. „Wir wollten erst gar nichts von ihr wissen, aber sie hat uns mit diesem Auftrag geködert und uns zwanzig Piaster versprochen für den Fall, daß wir Neuigkeiten über den Seewolf und Tortuga herauskriegen.“
„Die Münzen haben euch natürlich nicht verlockt“, sagte Diego voll Hohn und Verachtung. „Nur zögernd habt ihr euch auf das Unternehmen eingelassen, nicht wahr? Und natürlich bereut ihr jetzt, eure Einwilligung gegeben zu haben.“
„Ja, so ist es“, erwiderte der Bretone. „Wenn ich könnte, würde ich alles wieder rückgängig machen.“
Arne von Manteuffel hatte aufgehorcht. Er ließ sich alles ganz genau schildern: die Ankunft der Queen in Punta Gorda, ihr Eintreffen im Hafen, ihr Verhalten. Sarraux und Nazario waren die ersten gewesen, die den Zweidecker gesichtet hatten, sie wußten über jede Einzelheit Bescheid und hatten ja auch das Schiff bespitzelt, als es in der Nebenbucht vor Anker gegangen war.
Gemeinsam redeten sie sich von der Seele, was sie jetzt plagte und ihren Untergang bedeutete. Sie konnten nur noch darauf hoffen, durch ihr umfassendes Geständnis die Gemüter zu besänftigen.
Als sie geendet hatten, sagte Arne von Manteuffel: „Das ist ja hochinteressant. Ich stelle hiermit den Antrag, die Gefangenen einzusperren und es dem Seewolf zu überlassen, den letzten Urteilsspruch über sie zu fällen. Ich breche sofort auf und verständige ihn. Ihr anderen wartet hier auf mich.“
Es entstand eine tumultähnliche Situation – Manon und die Mädchen forderten Vergeltung, und auch die Siedler und Inselbewohner wollten den Bretonen und den Portugiesen auf der Totenrutsche sehen.
Willem Tomdijk hatte dieses Mal Mühe, den Aufruhr zu schlichten. Er nahm einen Humpen zur Hand und hieb damit mehrmals auf den Tisch, so hart, daß der Humpen in zwei Stücke zerbrach.
„Ruhe!“ schrie er. „Arne von Manteuffel hat recht! Der Seewolf muß sofort unterrichtet werden! Er hat die Queen besiegt, es steht ihm zu, auch über ihre Schergen das Urteil zu verhängen!“
Nach einigem Hin und Her wurde die Diskussion abgeschlossen und der Beschluß gefaßt: Carlos Rivero sollte die Agenten Sarraux und Nazario solange streng bewachen, bis er neue Anweisungen erhielt. Die Gerichtsverhandlung war somit beendet, die Gefangenen wurden abgeführt und die Versammlung aufgelöst.
Arne von Manteuffel kehrte schleunigst an Bord seines Schiffes zurück. Er gab seine Befehle, und O’Brien ließ ankerauf und in See gehen. Die „Wappen von Kolberg“ verließ die Hafenbucht von Tortuga – ihr Ziel war die Schlangen-Insel.
Der Spionageauftrag der Black Queen und die Kenntnis ihres derzeitigen Aufenthaltsortes waren zwei Faktoren, die für den Seewolf von größter Wichtigkeit waren. Allein wollte Arne über die Konsequenzen und Schritte, die sich daraus ergaben, nicht entscheiden.
2.
El Tiburon wußte genau, wohin er sich zu wenden hatte. Während der Überfahrt von Tortuga nach Hispaniola war er zu der Überzeugung gelangt, daß es doch besser war, den Kampf gegen die Black Queen nicht als Einzelgänger aufzunehmen. Immerhin waren da noch Caligula und die Crew der „Caribian Queen“, die er nicht vergessen durfte. Wie sollte er mit der Horde von wilden Schlagetots fertig werden, wenn etwas von seinem Plan mißglückte?
Hispaniola erhob sich in den Schleiern und Schatten der Abenddämmerung aus der See – der Rücken eines schwimmenden Giganten. Bald konnte El Tiburon mit bloßem Auge die Wipfel der uralten Mangroven und Sumpfzypressen, der Palmen und Eukalypten erkennen. Die gewaltige Manzanillo-Bucht dehnte sich vor ihm aus. El Tiburon steuerte ihren östlichen Bereich an, dort wollte er vertäuen und an Land gehen.
El Tiburons gewöhnlicher Aufenthaltsort befand sich an der Westseite von Hispaniola. Dort hatte er in einer einsamen Küstenregion eine Hütte gebaut, einige hundert Yards vom Ufer entfernt im Inneren des undurchdringlichen Busches. Ungestört wollte er sein, er führte das Dasein eines Eremiten, seit er damals, vor zwei Jahren, gegen den französischen Freibeuter Chagall hatte kämpfen müssen.
Die alte Siedlung von Cabo Samaná war wenige Wochen nach dem Überfall der Franzosen aufgelöst worden. Die Bukanier hatten sich in alle Winde zerstreut. El Tiburon wußte aber nach wie vor, wo Rosario, einer der früheren Kameraden, zu finden war. Es gab eine Übereinkunft zwischen ihnen: Wenn der eine den anderen brauchte, dann begab er sich zu ihm. Auch Rosario wußte, wo El Tiburon gewöhnlich hauste, aber außer ihm war das nur wenigen Männern bekannt.
Natürlich hatte sich El Tiburon noch einmal die Frage gestellt, ob es nicht doch ratsamer gewesen wäre, Verstärkung aus dem Hafen von Tortuga mitzunehmen. Aber auch diesmal hatte er die Möglichkeit verworfen. Vielleicht war es sogar gut, wenn man ihn – vorläufig zumindest – auf Tortuga für tot hielt. Denn Arne von Manteuffel, Diego und die anderen hätten sicherlich nichts unversucht gelassen, um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten.
War es letztlich nicht wirklich Wahnsinn, was er plante? Bevor er landete, stellte er sich erneut die Frage. Aber er wußte, was er tat. Er hatte ein impulsives, schnell aufbrausendes Temperament und war ein typischer Südländer. Doch er konnte auch gründlich Denken und wußte, seine Unternehmungen genau abzuwägen.
Die Black Queen mußte bekämpft und vernichtet werden, ehe sie ein noch größeres Unheil als auf Tortuga anrichtete. Viel stand auf dem Spiel. Das hielt sich El Tiburon noch einmal vor Augen – und dann landete er am Ufer der Manzanillo-Bucht unter dichtem überhängendem Gestrüpp.
Sorgfältig vertäute er das Fischerboot am Stamm einer Mangrove, brach ein paar Zweige ab und tarnte es. Er nahm seine wenigen Sachen an sich: das Messer, mit dem er gegen die Haie gekämpft hatte, einen alten Säbel, den er in der Hecklast gefunden hatte, sowie den Kieker. Er stieg an Land und bahnte sich mit dem Säbel einen Weg durch das Dickicht.
Mühsam war diese Art, sich voranzubewegen. Das Unterholz wurde immer verfilzter und schien sich gegen den Eindringling zu wehren. Aber El Tiburon ließ sich nicht beeindrucken. Er war im Urwald zu Hause. Nichts konnte ihn hier aufhalten. Er arbeitete schnell und mit kräftigen Schlägen, verausgabte sich aber nicht zu sehr.
Nach etwa hundert Yards blieb er stehen. Der Dschungel atmete Feuchtigkeit, die Nässe schien durch alle Poren der Haut zu dringen. Die Selva dünstete einen morastigen Geruch aus, aber das Faszinierendste war im Dunkelwerden die eigentümliche Musik, die den einsamen Mann umgab. Papageien und andere Vögel kreischten, Affen keckerten, Zikaden zirpten, und aus den Niederungen ertönte das Quaken der Frösche.
Etwas bewegte sich träge vor El Tiburons Füßen – eine Schlange. Giftig oder harmlos? Der Kenner stellte sich die Frage nicht, er verhielt sich ruhig und ließ das Tier ziehen. Schlangen waren im Prinzip scheu und suchten lieber das Weite. Sie griffen nur an, wenn sie selbst sich in die Enge getrieben fühlten.
Ein Laut schwang in dem abendlichen Konzert mit, den El Tiburon nicht einzuordnen wußte. Die Nachahmung des Schreis einer Uferschnepfe – unwillkürlich mußte er grinsen. Jetzt wußte er, daß er am Ziel war.
„Keine Angst“, sagte er halblaut. „Ich bin ein Freund, kein Feind. Ich suche Rosario. Ich bin Joaquin Solimonte.“
„El Tiburon!“ Der Mann, der den Namen aussprach, trat aus dem Unterholz, keine drei Yards von El Tiburon entfernt. Er war mittelgroß und fiel durch sein entstelltes Gesicht auf. Er hatte eine Hasenscharte, konnte aber deutlich und verständlich sprechen. „Es ist gut, daß du deinen Namen genannt hast“, sagte er. „Ich habe unseren Leuten eben schon ein Alarmsignal gegeben.“
„Das habe ich gehört. Wer bist du?“
„Fango. Rosario hat uns viel über dich erzählt.“ Fango ließ einen Pfiff ertönen, der sofort erwidert wurde.
El Tiburon grinste immer noch. „Entwarnung. Wie viele seid ihr?“
„Zehn Mann. Wir hätten dich glatt erschossen, wenn du einfach so in unser Lager geplatzt wärst.“ Fango musterte El Tiburon im Büchsenlicht. „Du siehst genauso aus, wie Rosario dich beschrieben hat. Komm!“
Er führte El Tiburon, und sie gelangten durch das Dickicht auf einen schmalen Pfad, der sich wie eine große Schlange durch den Urwald wand. Alle drei, vier Tage mußte der Pfad vom wuchernden Gestrüpp befreit werden, das wußte El Tiburon. Der Dschungel verschlang alles, was der Mensch schuf, alles mußte ihm mühsam abgerungen werden.
Auf einer kreisförmigen Lichtung endete der kurze Marsch. Neun Männer richteten ihren Blick auf El Tiburon und Fango. Einige von ihnen hatten gesessen, die anderen gelegen. Rosario erhob sich aus einer Hängematte, und auch seine Kameraden waren plötzlich auf den Beinen.
„El Tiburon!“ rief Rosario. Ein breites Lächeln glitt über seine markanten Züge. „Das ist eine gelungene Überraschung! Ich habe dich seit einer Ewigkeit nicht gesehen! Was führt dich zu mir?“
„Der Durst“, erwiderte El Tiburon und lachte. „Habt ihr Wein? Oder wenigstens ein bißchen Wasser?“
„Wasser und Rum“, erwiderte Fango und gab einem der Männer einen Wink. Eine Flasche wurde hervorgezaubert und weitergereicht, schweigend nahm El Tiburon einen Begrüßungsschluck zu sich. Dann schüttelte er allen nacheinander die Hand.
„Bist du der Anführer?“ fragte er seinen Freund Rosario.
„Ja“, erwiderte dieser. „Willkommen in dieser Runde von Glücksrittern und Teufelskerlen. Fango hast du schon kennengelernt, die anderen stelle ich dir noch mit ihren Namen vor. Gibt es Schwierigkeiten? Du kannst offen sprechen, du bist hier unter Freunden. Ich lege für jeden meine Hand ins Feuer.“
Erst jetzt bemerkte El Tiburon die Baumhütte hoch über seinem Kopf. Eine Strickleiter führte hinauf. Die Plattform, auf der man das Haus aus Schilf und Matten errichtet hatte, war zwischen den Blättern der Urwaldsträucher fast völlig versteckt.
„Ich störe euch nicht gern in eurem Domizil“, sagte El Tiburon. „Vielleicht habt ihr auch Wichtigeres zu tun, als euch meine Probleme anzuhören. Aber ich brauche tatsächlich eure Hilfe.“
Ein Lagerfeuer wurde entfacht, die Männer ließen sich nieder und tranken wieder aus der Flasche.
„Keine langen Vorreden“, sagte Rosario. „Welches Schiff gilt es zu überfallen? Wir haben eine Pinasse, El Tiburon, ein prächtiges Schiffchen, mit dem ich mich an jeden dicken Don herantraue.“
„Meine Gegner sind diesmal nicht unsere lieben Landsleute“, sagte El Tiburon. „Die verhalten sich ruhig und scheinen zur Zeit fest und tief zu schlafen. Nein, die Gefahr droht aus einer anderen Ecke. Habt ihr schon einmal etwas von der Black Queen gehört?“
„Ich schon“, entgegnete ein Ire namens O’Toole. „Sie soll vor kurzem in El Triunfo an der Küste von Honduras gewesen sein. Es heißt, sie sei auf der Suche nach Verbündeten. Aber der Henker soll mich holen – ich habe keine Ahnung über ihre Machenschaften. Sie ist überall und nirgends, taucht mal hier und mal dort auf. Ein schwarzer Bulle steht ihr zur Seite. Er heißt Caligula.“
„Zur Zeit befinden sich die Black Queen und Caligula in Punta Gorda“, erklärte El Tiburon.
Dann erzählte er alles, was er wußte und was sich auf Tortuga zugetragen hatte. Rosario, Fango, O’Toole und die anderen lauschten interessiert. Hin und wieder trank jeder einen Schluck Rum aus der Flasche und am Ende des Berichts wurde kräftig geflucht.
„Ein Teufelsweib, diese Queen“, sagte Rosario. „Was hat sie vor? Ist sie verrückt?“
„Eher größenwahnsinnig“, erwiderte El Tiburon. „Man muß ihr das Handwerk legen, bevor es zu spät ist. Sonst heißt es eines Tages: Auf Hispaniola regiert jetzt die Schwarze Königin, und jeder hat sich ihr zu unterwerfen. Jeder muß von dem, was er sich als Eigentum erworben hat, die Hälfte an die Queen abgeben. Jeder hört auf die Befehle der Queen.“
„Niemals!“ stieß Fango zornig hervor. „Ich unterwerfe mich keinem, den ich nicht selbst auswähle! Ich lasse mich nicht herumkommandieren, schon gar nicht von dieser schwarzen Hure!“
„Verjagen wir sie von Hispaniola!“ rief O’Toole. „Dies ist unser Revier!“
„Also auf nach Punta Gorda“, sagte Rosario entschlossen. „Sehen wir uns diese Queen mal aus der Nähe an. Los, holt die Waffen! Löscht das Feuer, nehmt genügend Proviant, Rum, Wasser und Munition mit!“
Im Handumdrehen waren alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen. Der Trupp von elf Männern bewaffnete sich und brach zu dem Platz auf, an dem die Pinasse vertäut lag.
El Tiburon atmete auf. Rosario hatte seine Erwartungen nicht enttäuscht, und er schien sich auf seine kleine Gruppe voll und ganz verlassen zu können. Diese Männer redeten nicht viel herum, wenn es zu handeln galt. Sie waren gewohnt, jederzeit sprungbereit zu sein und ihr Versteck im Dschungel mit den Posten an Bord der Pinasse zu vertauschen.
El Tiburons Worte hatten sie sofort überzeugt. Sie zweifelten nicht an der Richtigkeit seiner Darstellungen. Die Freundschaft zwischen Joaquin und Rosario war die Garantie dafür, daß alles stimmte und seine Richtigkeit hatte.
Binnen kurzer Zeit hatten sie die Entfernung zu dem versteckten Liegeplatz der Pinasse überbrückt und kletterten an Bord. Die Leinen wurden losgeworfen. El Tiburon registrierte, daß es sich bei der Pinasse um einen schlanken, überaus schnellen und wendigen Einmaster handelte. Als er jetzt aus dem Versteck glitt und Kurs auf die offene See nahm, schien das Wasser unter ihm dahinzufliegen.
Solche Einmaster hatten den Bukanier zu ihren Siegen verholfen. Bei nächtlichen Angriffen – aber auch bei Überfällen im Tageslicht – gingen die Männer tollkühn an Galeonen heran, die im Vergleich zu ihren Fahrzeugen wie Riesen wirkten. Dann wurde gepullt und gesegelt, und das Entermanöver erfolgte so schnell, daß die Besatzung des überfallenen Schiffes meistens völlig überrumpelt war.
Die Nacht senkte sich über See und Insel, es wurde stockdunkel. Schweigend verrichteten die Männer an Bord der Pinasse ihre Manöver. Bald gingen sie auf östlichen Kurs und hielten ihren Einmaster am Wind, der immer noch aus Nordosten wehte.
Rosario, O’Toole, Fango und die anderen stellten El Tiburon vorläufig keine Fragen mehr. Er sagte ihnen noch nichts über seine genauen Absichten. Sie unterstellten sich bedingungslos seinem und Rosarios Kommando. Sie waren eine verschworene Gemeinschaft, in der jeder vorbehaltlos für den anderen eintrat. El Tiburons Sache war jetzt auch ihre Sache. Was sie in Punta Gorda erwartete, stand auf einem anderen Blatt. Sie würden ihre Handlungen den Gegebenheiten anpassen.
Im Heraufziehen des neuen Tages erreichte Arne von Manteuffel mit der „Wappen von Kolberg“ die Schlangen-Insel. Mit geblähtem Zeug fiel die Galeone vom Wind ab und glitt dann, von der Crew mit großem Geschick gesteuert, durch den gefährlichen Mahlstrom. Der Felsendom nahm sie auf und ließ sie wieder frei. Sie schob sich in die Bucht, drehte bei und ging vor Anker.
Hier lagen die „Isabella IX.“, die „Le Vengeur III.“, der Schwarze Segler und die „Tortuga“ vor Anker. Die Bordwachen liefen auf den Decks zusammen, es wurde gejohlt und gewinkt.
Arne und seine Männer grüßten zurück, dann wurde das Beiboot der „Wappen von Kolberg“ abgefiert, und Arne, Oliver O’Brien, Renke Eggens, Hein Ropers und zwei Decksleute enterten ab. Sie nahmen auf den Duchten Platz, legten ab und pullten an Land, wo sich bereits alles versammelt hatte.
Kaum hatte sich der Bug des Bootes in den Uferstand geschoben, sprang Arne an Land und ging zu seinem Vetter. Jean Ribault, Siri-Tong, Thorfin Njal, Jerry Reeves, Karl von Hutten, Arkana, Araua, Ramsgate, Gotlinde und Ben Brighton bildeten den Kern der Gruppe, die sich um Arne und dessen Begleiter scharte.
„Schlechte Nachrichten?“ fragte Hasard.
„Ja und nein“, entgegnete Arne.
Dann berichtete er in aller Eile, was sich seit dem Auslaufen von Hasards Verband aus der Bucht von Tortuga auf der Insel zugetragen hatte.
Wer bis jetzt noch etwas schlaftrunken in die Morgenluft geblinzelt hatte, war mit einem Schlag hellwach. Carberry, der hinter Ben Brighton stand, ließ einen saftigen Fluch vernehmen und wollte auch noch etwas hinzufügen, verstummte aber, als er den zurechtweisenden Blick von Gotlinde wahrnahm.