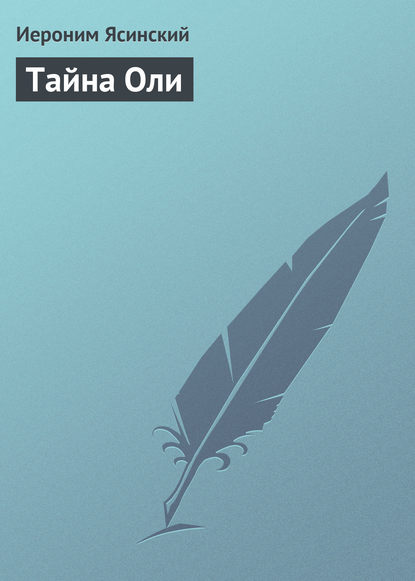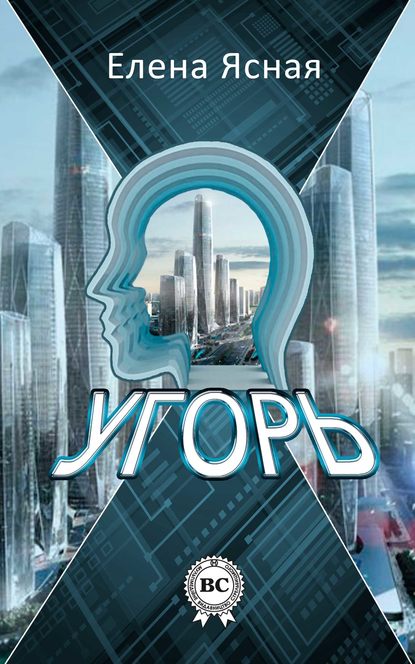Seewölfe Paket 19

- -
- 100%
- +
„Das spielt keine Rolle, jedenfalls nicht in den Augen des Seewolfs. Ich war lange genug mit Ribault und Siri-Tong zusammen, sie haben mir seine Ansichten genau auseinandergesetzt.“
„Schön und gut“, sagte Willem. „Dennoch wäre ich froh, wenn die ‚Wappen von Kolberg‘ bald zurückkehrte. Arne von Manteuffel überbringt uns sicher die Order des Seewolfs. Ich bin erst beruhigt, wenn ich die beiden Mörder baumeln sehe.“ Abrupt blieb er stehen. „Überhaupt – wäre es nicht besser gewesen, wenn wir sie uns hätten vorführen lassen? Dieser verdammte Marsch. Ich bin nicht gut zu Fuß, das weißt du doch.“
Ein Nörgler war er schon immer gewesen, und am schlimmsten wurde sein Gejammer, wenn er sich auf den eigenen Füßen durch die Gegend bewegen mußte. Er hatte darüber nicht richtig nachgedacht, als sie aufgebrochen waren, und bereute jetzt, nach nicht mehr als dreihundert Schritten, bereits seinen Entschluß.
Carlos mußte grinsen. „Stell dich nicht so an“, sagte er. „In El Triunfo bist du auch nicht so zimperlich gewesen und konntest ganz hübsch rennen, als die Spanier die Siedlung zusammenschossen. Also los – nur Mut.“ Er ging einfach weiter, um den Dicken durch sein Beispiel anzuspornen.
Willem dachte aber nicht daran, weiterzumarschieren. Er stand nur da, schwitzte und schnappte japsend nach Luft. Sein Herz schlug wie verrückt. Eine halbe Meile Flachland hätte er noch akzeptiert, aber diese Steigung raubte ihm seine letzten Kräfte.
Was weder Willem noch Carlos bemerkten: Manon war ihnen heimlich gefolgt. In der „Schildkröte“ hatte sie vernommen, was sie besprochen hatten. Sie wollte dabeisein, wenn die Gefangenen noch einmal vernommen wurden. Auch sie mußte jede Einzelheit erfahren, die zu Esthers Tod geführt hatte, das war sie nicht nur Esther, sondern auch ihren Freundinnen schuldig.
Sie hörte den dicken Mann vor sich im Gestrüpp schnaufen und keuchen, aber sie sah nicht, daß Carlos sich von ihm abgesondert hatte und immer mehr Vorsprung gewann. Sie orientierte sich an Willems Lauten und steuerte auf ihn zu.
Carlos hatte die Höhle inzwischen fast erreicht, blieb aber plötzlich stehen, weil er ein verdächtiges Geräusch gehört zu haben glaubte. Er griff zur Pistole. Mißtrauisch blickte er nach links und nach rechts. Aus welcher Richtung war der Laut gedrungen? Es hatte sich angehört, als sei ein Mensch auf einen trockenen Zweig getreten.
Dicht vor ihm raschelte es – und Carlos zückte die Pistole und schritt auf das Geräusch zu. Aber er ahnte nicht, daß es eine Falle war. Sarraux und Nazario hatten rechtzeitig das Nahen des Gegners bemerkt. Sie waren ja auch durch das, was sie von dem Engländer und dem Spanier erlauscht hatten, gewarnt und wußten, daß Rivero und Tomdijk früher oder später erscheinen mußten.
Sarraux täuschte Carlos also durch das Rascheln, und Nazario befand sich dicht hinter dem Rücken des Spaniers. Carlos hatte den Bretonen fast erreicht, da riß Nazario hinter ihm die Muskete hoch und ließ den Kolben auf seinen Hinterkopf niedersausen. Carlos registrierte die Bewegung und wollte herumfahren. Aber er hatte keine Chance mehr. Der Schlag traf ihn, er brach zusammen und rührte sich nicht mehr.
Sarraux ging zu Nazario und stieß einen grimmigen Laut der Genugtuung aus, als er Carlos daliegen sah. „Recht so. Immer kräftig drauf. Aber es darf kein Schuß fallen, Joao, sonst haben wir gleich wieder das ganze Pack auf dem Hals.“
„Klar.“ Nazario grinste und eilte weiter.
Sein Kumpan folgte ihm. Sie huschten durch das Dickicht den Hang hinunter, begingen jetzt aber doch einen Denkfehler: Sie rechneten nicht mit Willem. Vielmehr nahmen sie an, daß Carlos entgegen der Annahme der beiden Wachtposten allein erschienen wäre, um sie noch einmal zu verhören. So geschah das Unvermeidliche: Nazario prallte unversehens mit dem Dicken zusammen. Wie aus heiterem Himmel erfolgte der Zusammenstoß, und sie waren beide so überrascht und schockiert, daß sie nur ein dumpfes „Ach“ und „Oh“ von sich gaben.
Willem krachte schwer zu Boden, Nazario indes blieb auf den Füßen. Willem geriet ins Rollen und walzte mit seinem Gewicht die Büsche platt. Seine Bewegung gewann immer mehr an Geschwindigkeit, und es hatte den Anschein, als würde er bis vor die „Schildkröte“ rollen.
Manon hörte das seltsame Rumpeln, mit dem sich der Holländer ihr näherte. Es knackte und prasselte, dann kugelte der Dicke auf sie zu. Sie stieß einen Schrei aus, hatte aber die Geistesgegenwart, sich durch einen Sprung in Sicherheit zu bringen. Willem kullerte an ihr vorbei, ein japsender und schimpfender Berg von Mensch, dessen Hände hierhin und dorthin griffen, aber keinen Halt fanden.
Manon streckte noch die Hand nach ihm aus, aber es war zu spät, er war vorbei. Sie hätte ihn auch nicht festhalten und bremsen können. Er hätte sie nur mitgerissen.
Nazario und Sarraux hatten den Schrei gehört und eilten auf das Mädchen zu. Sie ahnte mehr etwas von den beiden, als daß sie sie wirklich herannahen hörte, und ergriff die Flucht. Willems Sturz konnte nur einen Grund haben: Die Gefangenen waren ausgebrochen und hatten ihn überwältigt. Aber wo war Carlos?
Manon wollte nach ihm rufen, doch jetzt schossen Nazario und Sarraux aus dem Dickicht hervor und packten sie an beiden Armen. Sie stöhnte auf vor Entsetzen, ging in die Knie und riß den Mund weit auf.
Bevor sie jedoch schreien konnte, preßte Nazario ihr eine Hand gegen die Lippen und zischte: „Ich töte dich, wenn du dich wehrst. Sei vernünftig. Du weißt, daß wir mit Weibern nicht gerade zart umspringen. Und ich weiß, daß du nicht sterben willst.“
Manon hing an ihrem Leben wie jeder andere Mensch, aber die Wut und der Haß brachten sie zur Raserei. Sie war wie von Sinnen und leistete auch weiterhin Widerstand. Sarraux und Nazario mußten ihre ganze Kraft aufbieten, um sie festzuhalten. Der Portugiese war drauf und dran, sie für immer zum Schweigen zu bringen, aber er bezwang sich. Er wußte, daß sie das Mädchen noch brauchten – als Geisel.
Willem war es unterdessen gelungen, einen Strauch mit beiden Händen zu packen. Durch die ungestüme Rollbewegung wurde der Busch glatt entwurzelt, aber Willem nahm ihn mit und hielt ihn so vor sich hin, daß er seine Abfahrt bremste. Rutschend stoppte er und rappelte sich staubbedeckt und mit zerfetzter Kleidung auf.
„Hurensöhne“, zischte er. „Das werdet ihr mir büßen!“ Zornig begann er loszuhasten – in die Richtung, aus der er abwärts gesaust war. Sein Bauch wackelte bedenklich, aber seine Abneigung gegen das Laufen hatte sich gelegt. Er hatte auch Manon gesehen und schreien hören und sorgte sich um sie. Und Carlos? Wo war der?
Carlos Rivero erhob sich auch gerade wieder und rieb sich stöhnend den Hinterkopf. Die Ohnmacht war kurz gewesen, das Erwachen schlimm. Aber er wußte, daß es die Gefangenen gewesen waren, die ihn niedergeschlagen hatten. Die Gewißheit versetzte ihn in unbändigen Zorn, er richtete sich auf und hastete den Hang hinunter. Wo steckte Willem?
Wenig später prallten die beiden fast miteinander zusammen. Im letzten Augenblick stoppten sie ab und blieben keuchend voreinander stehen.
„Manon“, stammelte Willem. „Wo – wo ist sie? Sie muß uns gefolgt sein. Jetzt ist sie den Kerlen – in die Arme gelaufen.“
„Wie haben die bloß entwischen können?“ fragte Carlos. Er wandte den Kopf und vernahm wieder ein Geräusch im Dickicht. Ohne zu zögern, eilte er in die Richtung, aus der es herüberwehte. Rascheln – die Gefangenen auf der Flucht! Was hatten sie mit Manon gemacht? Carlos lief, so schnell er konnte. Willem folgte ihm, konnte aber natürlich nicht mithalten und blieb wieder zurück.
Carlos erreichte eine Anhöhe, der dichte Buschbewuchs öffnete sich vor ihm zu einer Art Rondell. Er sah Sarraux und Nazario – und er entdeckte auch Manon, die von ihnen mitgeschleift wurde, obwohl sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehrte. Carlos blieb stehen und hob die Pistole.
„Stehenbleiben!“ rief er. „Nazario, du bist der erste, der stirbt! Ergebt euch! Was ihr tut, ist sinnlos!“
Die beiden hielten tatsächlich an. Aber Sarraux hielt Manon das Messer an die Kehle, und Nazario zielte mit der Muskete auf Carlos.
„Auf was wartest du?“ rief er. „Schieß doch! Wahrscheinlich hast du recht – ich verrecke! Aber auch du beißt ins Gras, verfluchter Hurensohn! Und das Weib verblutet hier am Boden, vor deinen Augen! Wie findest du das?“
„Das wagt ihr nicht“, sagte Carlos so ruhig wie möglich. „Ihr habt die ganze Insel gegen euch. Man wird euch finden und in Stücke zerreißen.“
„Wir haben nichts zu verlieren“, sagte Sarraux höhnisch. „Vergiß das nicht, Bastard. Und denk auch daran, daß ich Esther getötet habe, ohne mit der Wimper zu zucken.“
„Warum wollt ihr eure Lage durch einen weiteren Mord erschweren?“ fragte Carlos. Er hoffte, daß Willem alles mithörte und schleunigst Verstärkung holte. Aber Willem war nicht schnell genug. Bis er die „Schildkröte“ erreichte, war bereits alles vorbei.
„Manon wird leben, wenn du vernünftig bist“, sagte Nazario. „Wir nehmen sie mit. Als Faustpfand. Später lassen wir sie frei. Verlaß dich darauf, Rivero. Wir fordern freies Geleit, sonst nichts.“
„Ich habe keine andere Wahl.“ Carlos ließ die Pistole sinken. Dies war die Probe aufs Exempel. Wenn Nazario schoß, bewies er, daß er grundlos und ohne jeden Skrupel tötete. Dann würde auch Manon sterben. Schoß er nicht, hatte sie noch eine Chance.
Nazario nahm die Muskete herunter. Er grinste flüchtig, dann entfernten sich Sarraux und er rückwärts mit Manon. Noch einmal versuchte sie, sich loszureißen, aber sie konnte sich dem Griff der Kerle nicht entwinden.
Carlos Rivero mußte in ohnmächtiger Hilflosigkeit mit ansehen, wie sie mit dem Mädchen verschwanden. Willem Tomdijk traf viel zu spät mit der Verstärkung ein, aber es hätte wenig genutzt, wenn er schneller gewesen wäre. Nazario und Sarraux hatten Manon in ihrer Gewalt. Ihr Leben durfte nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Die Männer von Tortuga fanden den grauhaarigen Engländer und den Spanier. Der Engländer war schlimmer verletzt, als sie anfangs angenommen hatten. Er mußte sich beim Wundarzt in Behandlung begeben. Konnte man ihm Vorwürfe machen? Kaum. Aber Willem Tomdijk, Carlos Rivero, Diego und die anderen wußten jetzt nicht, was sie Arne von Manteuffel erzählen sollten, wenn dieser wieder auf Tortuga eintraf.
Sarraux und Nazario hatten unterdessen in einer verborgenen Nebenbucht einen Einmaster gefunden und lösten die Leinen. Niemand behelligte sie. Ungestört konnten sie die Segel setzen. Dann nahmen sie Kurs auf Punta Gorda.
Manon lag zu ihren Füßen. Sie hatten sie gefesselt, damit sie nicht über Bord sprang und zurück zur Insel schwamm. Es war damit zu rechnen, daß sie in ihrer grenzenlosen Wut auch vor den Haien keine Angst hatte.
5.
Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt landeten El Tiburon, Rosario, Fango, O’Toole und die sieben anderen Insassen der Pinasse nordwestlich von Punta Gorda in einer versteckten Bucht.
„Ein feiner Platz“, sagte Rosario. „Hier wird unseren Kahn keiner entdecken. Also los, lassen wir einen Mann zur Bewachung zurück und brechen wir auf nach Punta Gorda.“
„Nein“, sagte El Tiburon. „Ich gehe allein, Rosario. Ihr wartet hier auf mich. Nein, widersprich mir nicht. Ich will erst einmal die Lage sondieren.“
„So habe ich mir das aber nicht vorgestellt“, sagte Rosario.
O’Toole grinste. „Ich auch nicht. Ich hatte mich schon gefreut, mal den Busen der Black Queen ein bißchen anzufassen.“
„Und in Punta Gorda soll es auch einen guten Wein geben“, meinte Fango. Sein häßliches Gesicht war zu einer Grimasse verzerrt. „Nur der Wirt ist ein Schmierfink. Er heißt Manoleto.“
„Versucht nicht, mich zu beeinflussen“, sagte El Tiburon. „Ich brauche euch vor allem als Segelmannschaft.“
„So? Und ich dachte, wir seien Freunde“, sagte Rosario. „Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn.“
„Gut, aber dann sind wir auch für deine Kameraden verantwortlich“, sagte El Tiburon. „Mit meinem Fischerkahn wäre ich nicht weit gelangt, ich habe die Pinasse also dringend gebraucht. Ich bin euch für eure Unterstützung dankbar. Aber denk mal einen Augenblick weiter, Rosario. Ich wäre ein Schweinehund, wenn ich euch leichtfertig einer Gefahr aussetzen würde.“
„Du spielst also wieder den einsamen Rächer?“
„Ja, Rosario, so ungefähr. Nur im äußersten Notfall dürft ihr in Punta Gorda auftauchen.“
„Das ist ein merkwürdiges Abkommen“, meinte Rosario. „Aber ich will dir die Sache nicht durch Kritik erschweren. Wenn du in zwölf Stunden nicht zurück bist und uns Bericht erstattest, sehen wir nach dem Rechten. Einverstanden?“
„Einverstanden.“ El Tiburon grinste hart. Sie gaben sich die Hand, dann sprang er an Land und verschwand im Dickicht.
Die Entfernung nach Punta Gorda betrug etwa drei Meilen, aber der Weg durch den Busch war nicht so beschwerlich wie an der Manzanillo-Bucht, wo das Gestrüpp und die Bäume sehr viel dichter zusammengewachsen waren. El Tiburon gelangte zügig voran und wußte, daß er Punta Gorda noch am frühen Nachmittag erreichen würde.
Männer wie Rosario und er brauchten keine Karten, um sich auf Hispaniola und dem Seegebiet um die Insel zurückzufinden. El Tiburon hatte die Gegend genau im Kopf, kannte die Entfernungen und wußte über jede Einzelheit Bescheid. Lange genug hatte er die Insel ausgekundschaftet. Er konnte sich auch noch gut an Punta Gorda erinnern, obwohl er seit knapp zwei Jahren nicht mehr dort gewesen war.
Zum erstenmal würde er nun der Black Queen gegenübertreten. Innerlich bereitete sich Joaquin auf alles vor. Er hatte sich zurechtgelegt, was er sagen würde und war auf jede Frage gefaßt. Er war ziemlich sicher, daß er sich nicht versprechen und verraten würde. Aber er mußte höllisch aufpassen. Wenn die Queen so gefährlich war, wie sie ihm beschrieben worden war, würde es nicht leicht sein, sie hinters Licht zu führen.
Genau das aber hatte El Tiburon vor. Würde es ihm gelingen oder hatte er sich zuviel vorgenommen? Der Seewolf hatte es schwer gehabt, den Verband der Queen zu zerschlagen. Schon viele Männer hatten sich an dieser Frau die Zähne ausgebissen.
Aber er, El Tiburon, konnte nicht nur gegen Haie kämpfen. Er hatte allein dem Busch getrotzt und die Selva und ihre Tücken besiegt. Er hatte viele Gefechte miterlebt und wußte sich unter Raubtieren zu bewegen, vierbeinigen und zweibeinigen. Was er sich in den Kopf setzte, das schaffte er in den meisten Fällen auch. Sein ganzer Stolz würde es sein, dem Seewolf zu begegnen und ihm von seinem Sieg über die Queen zu berichten.
Aber soweit war er noch nicht. Sein Fußmarsch erfuhr eine kurze Unterbrechung, als er auf eine Bucht unweit von Punta Gorda stieß, in der ein Schiff vor Anker lag. Vorsichtig schlich er sich an, so weit, daß er es aus einem Versteck im Dickicht beobachten konnte.
Unwillkürlich hielt er den Atem an. Kein Zweifel, nach den Beschreibungen, die er auf Tortuga vernommen hatte, handelte es sich um den Zweidecker der Black Queen. Oder irrte er sich? Der Name „Caribian Queen“ war nirgends zu erkennen, weder am Bug noch am Heck. Niemand war an Bord zu sehen. Er spähte durch seinen Kieker, entdeckte aber auch jetzt niemanden. Totenstille herrschte. Kein Boot lag am Ufer. Wenn die Mannschaft an Land gegangen war, dann hatte sie ihr Beiboot gut versteckt und entsprechend getarnt.
Er lohnte sich nicht, danach zu suchen. Die Idee, an Bord des dunklen, unheimlich wirkenden Schiffes zu entern, beschäftigte nur kurz El Tiburons Gedanken. Wahnsinn – was gewann er, wenn er den Versuch unternahm? Vielleicht lauerten an Bord Kerle, die nur darauf warteten, über einen ungebetenen Gast herzufallen. El Tiburon verwarf den Plan, kaum, daß er ihn gefaßt hatte.
Das Schiff schien ein drohender Bote des Unheils zu sein. Er tat nur gut daran, ihm vorläufig keine weitere Beachtung zu schenken. In Punta Gorda würde er mehr erfahren – vor allem, ob es sich tatsächlich um die „Caribian Queen“ handelte, wie er vermutete.
Einen richtigen Reim konnte er sich auf den Zweidecker also nicht bilden. Er wunderte sich nur, daß er hier vor Anker lag und nicht im Hafen von Punta Gorda.
Er setzte seinen Weg nach Punta Gorda fort und langte kurze Zeit später in dem kleinen Hafen an. Hier herrschte ein reges, buntes Treiben. Die Ankunft des schlanken, dunkelhaarigen Mannes schien überhaupt nicht aufzufallen. Dennoch hatte er den Eindruck, daß ihn hier und dort Augen aufmerksam musterten. Ein bulliger Kerl zum Beispiel, der mit drei anderen an den Piers herumlungerte, schickte ihm einen Blick zu, der nicht auf Freundlichkeit schließen ließ.
Dieser Mann – so sollte El Tiburon noch erfahren – war Lee Crapper, und bei ihm waren Larsky, T-Bone und Norimbergo. Sie waren Bukanier, aber nicht von der Sorte wie Rosario und Joaquin Solimonte. Sie waren aus schlechtem Holz geschnitzt und spielten mit dem Gedanken, bei der Black Queen anzuheuern – die Frau war ganz nach ihrem derben Geschmack.
El Tiburon tat so, als bemerke er die Blicke nicht. Unbeirrt steuerte er auf sein Ziel zu, die Hafenkneipe „El Escarabajo“. Er betrat sie durch den Perlenschnurvorhang der Rundbogentür und blieb stehen. Seine Augen mußten sich erst an das Halbdunkel gewöhnen, er war vom draußen herrschenden Sonnenlicht wie geblendet.
Manoleto, der Wirt, nahm einen schmutzstarrenden Lappen zur Hand und bewegte ihn mit aufreizender Langsamkeit über die Holzplatte der Theke, die auch energischen Reinigungsversuchen erfolgreich standgehalten hatte. Immer wenn ein Fremder die Spelunke betrat, widmete sich Manoleto dieser sinnbildlichen Tätigkeit, aber nicht einmal er selbst wußte, welchen Zweck das hatte. Seine flinken kleinen Rattenaugen waren auf El Tiburon gerichtet, der jetzt auf die Theke zuschritt.
El Tiburon legte die Hände auf die Platte, zog sie aber rasch wieder zurück. Das Holz war klebrig, man hatte unwillkürlich das Gefühl, daran haften zu bleiben. Alles schien außerordentlich schmierig zu sein.
Der Wirt selbst war eine der dreckigsten Ratten, die er je gesehen hatte. Er konnte sich nicht entsinnen, ob dieser Mann schon in Punta Gorda gewesen war, als er vor zwei Jahren hier eingekehrt war. Vielleicht hatte die Kneipe damals auch einen anderen Namen gehabt. Jetzt hieß sie treffend „Der Käfer“. Von Kakerlaken und Schaben, Wanzen und Läusen schien es nur so zu wimmeln.
„Was darf’s sein?“ fragte Manoleto in der ihm eigenen unterwürfigen Art. „Wenn man von so weit herkommt, hat man sicher großen Durst. Ich habe guten Rotwein, aber auch einen feinen Weißwein. Der löscht den Durst noch besser.“
„Weißwein ist richtig für mich“, sagte El Tiburon. „Aber sehe ich so aus, als hätte ich eine lange Reise hinter mir? Woran erkennt man das?“
„Ach, ich habe das nur so dahingesagt“, erwiderte Manoleto ausweichend. Er holte einen Krug, füllte einen Becher randvoll und schob ihn El Tiburon zu, aber dieser deutete auf einen zweiten Becher.
„Schenk dir selbst auch ein“, sagte er. „Ich gebe einen für dich aus.“ Er kostete von dem Wein, obwohl er skeptisch war. Erstaunlicherweise schmeckte er aber doch sehr gut, wie Manoleto versichert hatte.
Manoleto fühlte sich geschmeichelt. Er trank und gab ein genüßliches Schmatzen von sich, als er den Becher wieder absetzte.
„Es geschieht nicht oft, daß ein Fremder etwas für mich spendiert“, sagte er. „Schönen Dank, Amigo. Ich heiße Manoleto.“
„Und ich Joaquin Solimonte. Ein Fischerboot hat mich in der Nähe abgesetzt, die Leute haben mich freundlicherweise von Tortuga mitgenommen.“
„Tortuga, so, so. Und was führt dich her? Brauchst du was? Eine Frau? Proviant, Wasser, Wein, eine Pistole oder einen Säbel?“
El Tiburon lachte. „Nichts von alledem. Eigentlich suche ich nur jemanden, mit dem ich ein vertrauliches Gespräch führen kann.“
Manoleto war hellhörig geworden. „Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich kann schweigen wie ein Grab. Ist jemand hinter dir her?“
„Auch das nicht. Gilbert Sarraux und Joao Nazario schicken mich als Boten.“ El Tiburon beugte sich vor und senkte die Stimme, als er dies sagte. Er hatte eine Verschwörermiene aufgesetzt und war sicher, die Neugier des schmierigen Kerls geweckt zu haben. „Du kennst die beiden doch, oder?“
„Natürlich, sie stammen ja aus Punta Gorda. Ich meine, sie leben schon seit einiger Zeit hier. Bist du – ihr Freund?“
„So ist es.“
„Feine Kerle, die beiden.“ Manoleto seufzte. „Solche Männer hat man gern um sich herum, man kann sich auf sie verlassen. Willst du noch einen Schluck Wein?“
„Ja.“ El Tiburon sah zu, wie der Kerl seinen Becher füllte und bedeutete ihm, sich selbst auch wieder zu bedienen. Es bereitete ihm Spaß, ihn ein wenig auf die Folter zu spannen.
„Welche Nachricht haben Sarraux und Nazario denn für mich?“ fragte Manoleto, der vor Ungeduld ganz zappelig wurde. „Eigentlich wundert es mich, daß sie sich an mich wenden.“
„Sie stecken in der Klemme – bis zum Hals.“
„Wie kann ich ihnen helfen?“
„Mir ist daran gelegen, ein Treffen mit der Black Queen zu vereinbaren“, erwiderte El Tiburon. „Ich soll ihr erste geheime Nachrichten übermitteln.“
„Die Black Queen? Wer ist denn das? Ich hab noch nie was von der gehört.“
El Tiburon grinste. „Klar. Und du weißt von nichts und niemandem, oder?“
„Erraten. Du scheinst ein kluger Mann zu sein.“ Manoleto mußte ebenfalls grinsen. Er trank geräuschvoll. „Ich möchte keine Schwierigkeiten haben, verstehst du?“
„Dafür habe ich volles Verständnis. Aber denk mal darüber nach, ob du die Black Queen irgendwie benachrichtigen kannst. Ich weiß nämlich, daß sie hier ist. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sogar ihr Schiff gesehen.“
„Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst.“
„Schon gut, ich will dich nicht drängen“, sagte El Tiburon. „Aber überlege es dir. Es wird nicht zu deinem Nachteil sein. Die Queen ist dir für deinen Hinweis bestimmt dankbar. Hör zu: Morgen um die gleiche Zeit bin ich wieder hier. Wenn die Queen Interesse an meiner Botschaft hat, kann sie entweder selbst zur Stelle sein oder einen Boten schicken.“
„Ich verspreche dir gar nichts, Joaquin.“ Manoletos Gesicht nahm einen traurigen, fast weinerlichen Ausdruck an. „So ist das in meinem Beruf. Man glaubt, etwas für seine Mitmenschen tun zu können, aber oft steht man selbst hilflos da und beschränkt sich darauf, Wein auszuschenken.“
„Sicher.“ El Tiburon klopfte ihm mitfühlend auf die Schulter, dann zahlte er seine Zeche. „Irgendwie bin ich davon überzeugt, daß meine Botschaft die Queen erreicht“, sagte er, bevor er „El Escarabajo“ verließ.
Er kehrte zum Ankerplatz der Pinasse zurück, legte unterwegs aber mehrfach Pausen ein, um sich zu vergewissern, daß ihm niemand folgte. Sein Argwohn schien aber unbegründet zu sein. Niemand war ihm auf den Fersen. Unbehelligt erreichte er Rosario und die anderen, die es sich an Bord der Pinasse gemütlich gemacht hatten und eine Flasche Rum kreisen ließen.
„Hallo!“ stieß Rosario überrascht hervor. „So früh hatten wir dich gar nicht zurückerwartet. Hat das große Treffen mit der Black Queen schon stattgefunden?“
„Nein“, entgegnete El Tiburon. Dann berichtete er über seine Unterhaltung mit Manoleto in „El Escarabajo.“
„Ja, Manoleto“, sagte Fango. „Das ist eine ganz üble Ratte. Nimm dich vor dem Hund in acht, El Tiburon. Er ist gerissen und verschlagen – und schwatzhaft obendrein.“
„Eben. Dann habe ich mich also an den richtigen Mann gewandt.“ El Tiburon lachte, wurde aber rasch wieder ernst.
Er begann, sich auf seine Zusammenkunft mit der Queen vorzubereiten. Rosario bot ihm Waffen aus seinen Beständen an, und El Tiburon suchte sich ein Messer mit handtellerbreiter Klinge und einen Radschloßdrehling aus, den die Verbündeten vor einiger Zeit einem Spanier abgenommen hatten.
„Mit dem Mehrschüsser habe ich schon manchen guten Treffer gelandet“, sagte Rosario. „Du wirst deine Freude daran haben.“
El Tiburon drehte die Waffentrommel und spannte probeweise den Hahn. Der Drehling war bestens geölt und lag gut in der Hand. El Tiburon legte ihn beiseite und nahm die Flasche entgegen. Er prostete seinen Begleitern zu, trank und dachte an seine Rache.
6.