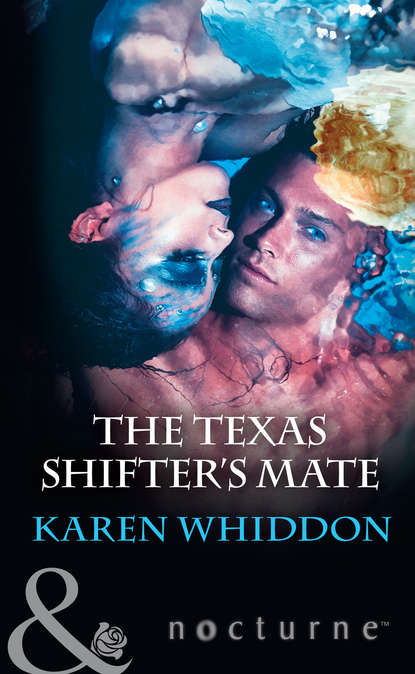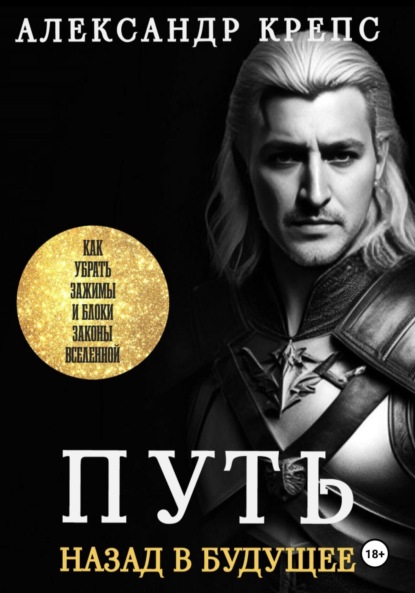Seewölfe Paket 23

- -
- 100%
- +
„Horch mal“, sagte Matt Davies.
„Wie?“ Carberry war noch nicht ganz da. Eben hatte er ja noch in Silber gebadet.
„Hörst du nichts?“ fragte Matt Davies.
Carberry wurde unwirsch. „Was soll ich denn hören?“
„Die Geräusche.“
„Was für Geräusche?“
„Aus dem Berg, Mann! Bist du taub oder was?“ knurrte Matt Davies.
Nun hätte sich normalerweise der Profos bei einer Frage nach der Schärfe seines Gehörs ganz erheblich aufgepumpt und dem Frager alles mögliche angedroht, denn nur Idioten können daran zweifeln, ob ein Profos schwerhörig sei – ein Profos, der dazu verpflichtet ist, die Kakerlaken an Bord husten zu hören.
Nichts da.
Der Profos wendete etwas den massigen Schädel – und lauschte. Und er vernahm das Scharren und Rumpeln, das Schlagen und Pochen, das Knistern und auch ein Knacken. Und er zog diesen massigen Schädel etwas unbehaglich ein, während er ihn wieder zu Matt Davies drehte und sich gleichzeitig rechts am Hals kratzte.
„Klingt nicht gut“, sagte er. „Klingt ganz so, als lebe dieser Berg aus Silber …“
Er hatte noch etwas anfügen wollen, aber da war ein neues Geräusch in ihrer unmittelbaren Nähe. Sie starrten beide ruckartig dorthin – links von ihrem Schlafplatz. Dort rieselte etwas aus den Ritzen zwischen den Stollenwänden, die mit Brettern verschalt waren, mit sehr grauen und zum Teil schon recht morschen Brettern. Schutt war das, was da in den Stollengang rieselte und unten auf dem Boden ein kleines Hügelchen bildete. Es glitzerte ein bißchen zwischen diesem Schutt.
Dann hörte das Rieseln auf – die Geräusche aus dem Berg blieben. Sie blickten sich beide stumm an – zwei Männer, die den größten Teil ihres Lebens auf See verbracht und dem Teufel samt seiner Großmutter alle Ohren abgesegelt hatten. Den Schwanz auch, wenn der Teufel einen hatte, was man aber nicht so genau wußte.
Aber hier?
„Das ist vielleicht ein Scheißberg“, sagte Carberry. „Stell dir mal vor, der ganze Mistkram bricht zusammen, und wir sitzen da mitten drin – mit tausend Schiffsladungen Silber im Genick. Und was meinst du, wie schwer Silber ist?“
Matt Davies wurde unruhig, wobei ihn die Frage nach dem Gewicht von Silber nicht so sehr bedrückte wie der Gedanke, wann „der ganze Mistkram“ denn zusammenbrechen würde.
„Wir sollten Hasard wecken“, sagte er hastig. „Hier sind wir unseres Lebens nicht mehr sicher.“
Hasard war längst wach und hatte dem ersprießlichen Dialog seiner beiden Kerle interessiert gelauscht. Sieh an, dachte er, in Gefechten sind sie unerschütterlich und auch dann, wenn ihnen das Wasser bis zu den Nasenlöchern steht und die Ratten bereits von Bord verschwunden sind, aber vor dem Berg haben sie einen unheimlichen Respekt. Man mochte fast glauben, mehr Respekt als vor Stürmen, Seebeben, Flutwellen und Riesenkraken.
Ein vierter Mann war auch bereits wach – Pater Aloysius, der scharfgesichtige Kerl aus dem Land Tirol, der sie mit nahezu traumwandlerischer Sicherheit aus dem Tacna-Tal über Berge und Pässe nach Potosi geführt hatte. Er war ein Mann aus den Bergen – und man konnte Berge auf ihn bauen.
Er grinste durch das Halbdunkel des Stollens zu Carberry und Matt Davies hinüber, nachdem er sich aufgerichtet hatte, und sagte belustigt: „Die Indios haben mit ihrer Arbeit angefangen – drüben, auf der anderen Seite des Berges. Und das hört ihr jetzt. Hier bricht nichts ein – eher drüben. Außerdem sind wir hier nicht tief im Berg, sondern mehr oder weniger an seinem Rand. Wenn was zusammenkracht, sind wir Manns genug, uns nach draußen zu schaufeln.“
„Aha“, sagte Carberry. „Und was da zwischen den Brettern rausrieselt, ist harmlos, wie?“
„Irgendwann nicht mehr“, erwiderte Pater Aloysius gelassen, „aber da sind wir nicht mehr hier. Jeder Berg arbeitet oder anders ausgedrückt, er verändert sich, weil vieles auf ihn einwirkt, zum Beispiel von außen Schnee, Regen, Wind, Hitze und Kälte. Kein Stein, und mag er noch so hart sein, hält das auf die Dauer aus. Sogar die Wurzeln von Pflanzen können einen Stein sprengen – nicht von heute auf morgen, aber im Laufe von Jahren. Wenn sich an der Oberfläche etwas verändert, muß zwangsläufig auch im Inneren des Steins eine Wandlung stattfinden. In diesem Berg kommt hinzu, daß ihn die Menschen anbohren und Stollen hineintreiben. Sie durchlöchern ihn. Da fragt sich, wie lange er das hinnimmt, dieser Berg. Und wenn er sich wehrt, dann werden es die geschundenen Indios sein, die von ihm erschlagen werden.“ Die Stimme von Pater Aloysius wurde grimmig: „Und hoffentlich erschlägt der Berg dann auch ein paar Aufseher.“
Das also war Pater Aloysius, und er nahm nie ein Blatt vor den Mund, dieser streitbare Gottesmann aus einem Land, wo auch die Berge in den Himmel ragten, Mahnmale für die Winzigkeit der Menschen, die sich dennoch anmaßten, sie erobern und ausbeuten zu können.
So begann also dieser 28. Dezember, ein klarer, kalter Tag in diesen Höhen, in denen die Luft so dünn war, daß man mit dem Atmen Mühe hatte. Aber sie hatten bei ihrem Aufstieg in diese Regionen Pausen eingelegt, verordnet von Pater Aloysius. Und so hatten sie sich allmählich an die dünnere Luft gewöhnt. Ihre Gesichter waren tiefbraun und bärtig geworden.
Hasards Augen hatten jetzt die Farbe von bläulichem Gletschereis.
Er nickte nur, als Stenmark den Stollen betrat und meldete, im südlichen Bereich des Cerro Rico sei „kein Schwanz“ zu sehen. Er meinte das wörtlich, denn auf diese Seite des Berges verirrte sich nicht einmal ein Hund. Was sollte er hier! Die Abfälle in der Stadt waren so reichlich, daß er sich eine Wampe anfressen konnte. Den Hunden in der Stadt ging es besser als den Indios im Berg.
Stenmark war die Morgenwache gegangen. Seine Meldung bestätigte, was Pater Aloysius bereits am Vortag gesagt hatte, als sie in den verlassenen Stollen eingedrungen waren. So merkwürdig das klingen mochte: hier auf der Südseite des Silberberges waren sie absolut sicher.
Hier hatte man zwar anfangs vor vierzig oder fünfzig Jahren Stollen in den Berg getrieben und oberflächlich Silber abgebaut, aber dann war man auf die Nordseite umgewechselt, wo sich die Stadt ausgebreitet hatte. Von dort war es bequemer, das abgebaute Silber in die Stadt zur Münze zu bringen.
Eine erste Erkundung des Stollens hatte ergeben, daß noch ein paar Nebenstollen angelegt worden waren, ziemlich verzweigt, so daß die Männer tatsächlich ein ideales Standquartier gefunden hatten. Denn diese Nebenstollen waren ideale Verstecke. Wer hier eindrang, konnte blitzschnell und lautlos überrumpelt werden. Im übrigen hatten sie in einem dieser Nebenstollen ihre Maultiere untergebracht, jetzt fünfzehn an der Zahl, von denen sieben in ihre Hände gefallen waren, als sie in der Weihnachtsnacht den Silbertransport überfallen hatten.
Stenmark wurde von Mel Ferrow, dem Haifischkämpfer, abgelöst. Auch tagsüber verzichtete Hasard nicht auf einen Wachposten am Eingang zum Stollen. Vorsicht war immer geboten. Sie war ein Gesetz, das hier genauso seine Gültigkeit hatte wie auf See.
Die Männer versorgten die Maultiere, dann frühstückten sie – äußerlich gelassen, aber innerlich gespannt. Es gab noch keinen Plan, wie sie vorgehen wollten, und der Seewolf hatte – was das betraf – bisher geschwiegen.
Aber ihm entging keineswegs, daß die Kerle eine gewisse Nervosität zeigten. Matt Davies zum Beispiel putzte unentwegt seine Eisenhakenprothese, obwohl die wie stets geradezu silbern schimmerte. Bei Matt war das immer ein Zeichen, daß ihn das Fell juckte.
Und der Klotz von Profos zerrte an seinem dunkelblonden Rauschebart, der sein Rammkinn um etliches verlängerte. Jean Ribault saß auf einer Kiste, schien aber Hummeln im Hintern zu haben.
Ein verstecktes Lächeln kerbte sich in Hasards Mundwinkel. Er sagte: „Wenn ihr gefuttert habt, könnt ihr euch wieder aufs Ohr hauen, Leute.“
„Was? Wie?“ Carberry ließ die Hand sinken und starrte Hasard ungläubig an. „Ich hab’ aber die ganze Nacht durchgepennt, Sir. Ich bin so ausgeruht, daß ich mindestens drei Tage lang am Ruder stehen könnte.“
„Ich auch“, erklärte Matt Davies.
Die Männer nickten, und Jean Ribault sagte: „Raus mit der Sprache, Mister Killigrew, Sir! Du hast doch noch was auf der Pfanne, wie ich dich kenne, und ich kenne dich jetzt seit genau sechzehn Jahren.“
„Mit Unterbrechungen, mein Freund“, korrigierte Hasard, „aber sonst stimmt es. Was das andere betrifft, muß ich dich enttäuschen. Ich habe nichts auf der Pfanne. Ihr braucht wirklich ein bißchen Ruhe. Bis auf unseren guten Pater Aloysius seid ihr nämlich alle ziemlich angeschlagen …“
„Du wohl nicht, wie?“ schnappte Jean Ribault.
„Oh, ich bin noch ganz gut beieinander“, sagte Hasard gelassen, „jedenfalls so gut, daß ich mit Pater Aloysius einen kleinen Spaziergang nach Potosi unternehmen kann, um ein wenig herumzuschnüffeln und dann darüber nachzudenken, was ich auf die Pfanne zaubere, von der du sprachst.“
„Und wir sollen hier inzwischen pennen!“ sagte Jean Ribault erbittert.
„So ist es, mein Guter“, sagte Hasard sanft, „denn ich halte nichts davon, daß wir mit alle Mann hoch durch die Stadt ziehen und vermutlich dabei so auffallen wie buntkarierte Rübenschweine.“ Er blickte zu Carberry hinüber, der schnell wegschaute. Ihm war das immer furchtbar peinlich, wenn sein Kapitän gewisse Ausdrücke benutzte, die aus dem Provos-Vokabularium stammten und dazu dienten, den Arwenacks den Marsch zu blasen. Hasard lächelte und fügte hinzu: „Zwei Mann genügen zur Erkundung. Pater Aloysius kennt die Stadt und fällt als Dominikaner nicht weiter auf. Und ich bin dabei, weil ich meine, daß ich als euer Kapitän dazu ein Recht habe. Oder ist jemand anderer Ansicht?“
Gott bewahre! Sie schüttelten alle energisch die Köpfe. Und Jean Ribault sagte hastig: „So hatte ich das nicht gemeint, Sir. Ich meinte nur, daß wir alle voller Tatendrang sind und …“
Hasard winkte ab. „Weiß ich, weiß ich, vor allem wenn ich sehe, wie du auf deiner Kiste rumrutschst. Aber ihr werdet euren Tatendrang schon noch einsetzen können, verlaßt euch drauf! Und dann werdet ihr froh sein, ein paar Stunden Ruhe gehabt zu haben. Wenn wir hier loslegen, möchte ich keine Müdemänner sehen, die nicht mehr reagieren können, weil sie bereits im Stehen schlafen. Ist das klar?“
Das war klar, nur der Profos brummelte: „Könntest du nicht doch erwägen, mich mitzunehmen, Sir? Ich meine, damit du jemanden hast, der aufpaßt, daß dir keiner ins Kreuz springt oder so. Vielleicht haben die Dons hier einen Steckbrief von dir, nicht?“
„Genau!“ sagte Dan O’Flynn.
Hasard seufzte. „Ich trage einen Bart, Leute. Ihr braucht euch nur selbst im Spiegel zu betrachten und werdet euch kaum wiedererkennen. Für die Dons bin ich ein bärtiger Fremder an der Seite eines Gottesmannes, nicht mehr und nicht weniger. Es bleibt dabei: wir ziehen zu zweit los. Schon drei sind zuviel.“
„Wenn das nur gutgeht“, murmelte der Profos.
„Keine Sorge, Bruder Edwin“, sagte Pater Aloysius. „Der Herr wacht über euren Kapitän und mich und paßt auf, daß uns nichts geschieht.“
„Schon, schon“, sagte der Profos, „aber vielleicht schaut der Herr mal woanders hin, weil er dort mehr aufpassen muß. Er muß überhaupt eine Menge Augen haben, der Herr da oben. Und wenn nun das Auge, mit dem er auf Potosi schaut, müde ist? Hast du das bedacht, Bruder?“
„Es ist nicht müde, Bruder Edwin.“
Carberry grinste schlitzohrig. „Er geht Wache, Tag und Nacht, Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Ob er sich nicht mal ablösen läßt?“
Pater Aloysius schüttelte den Kopf. „Du mußt glauben, Bruder Edwin. Ließ der Herr dich fallen, als du am Seil über dem Abgrund hingst?“
„Da hat mein Diegolein mich gehalten“, sagte Carberry.
„Und wer befahl deinem Diegolein, sich gegen das Seil zu stemmen?“
Carberry kratzte sich hinter dem rechten Ohr und brummte: „Weißt du, Bruder, du hast eine ganz verdammte Art, mich auf himmlische Pfade zu locken. Da werde ich immer mißtrauisch. Wie war das denn, als mich mein lieber Diego an den Tacna zerrte und mit einem hinterfotzigen Stoß ins Wasser beförderte, he? Hat der Herr da nicht aufgepaßt?“
„Nahmst du Schaden, Bruder Edwin? Nein, du wurdest gebadet, und deine Seele wurde geläutert, auch wenn du voller Zorn warst. Du mußt diese Zeichen des Herrn verstehen. Es sind Zeichen! Der Herr ist auch in einem Maulesel, der stark genug war, dich einer Reinigung im Wasser zu unterziehen, aber auch stark genug, dich vor dem tödlichen Sturz in die Tiefe zu bewahren. Der Herr straft, und der Herr vergibt und beschützt. Du mußt mehr Vertrauen haben – und glauben.“
Carberry kratzte sich wieder hinter dem Ohr, jetzt dem linken.
„Mal sehen“, murmelte er ein bißchen unglücklich.
Die Männer grinsten in sich hinein.
2.
Pater Aloysius und Hasard umgingen den Cerro Rico und betraten die Stadt von Westen her. Niemand hielt sie auf oder kümmerte sich um die beiden Männer. Der Pater hatte seine Bergkleidung abgelegt und trug jetzt seine Kutte.
Es war doch erstaunlich, wie die Leute, denen sie begegneten, auf den Gottesmann reagierten. Man neigte den Kopf oder trat zur Seite, um dem Kuttenmann seine Reverenz zu erweisen. Pater Aloysius nickte gelassen oder hob leicht die rechte Hand.
„Es gibt auch weiße Schafe unter den Spaniern“, sagte er leise zu Hasard, „und es sind nicht eben wenige.“
„Ich weiß“, sagte Hasard ebenso leise, „dennoch bleibt unverständlich, warum sich die vielen weißen Schafe immer wieder von den paar schwarzen Schafen auf der Nase herumtanzen lassen.“
„Damit müssen wir leben“, sagte Pater Aloysius.
„Ja, leider“, murmelte Hasard und schaute sich um. „Ich wundere mich, daß die Stadtzugänge nicht bewacht werden, und hatte gedacht, wir müßten uns heimlich einschleichen.“
Pater Aloysius schüttelte den Kopf. „Sie fühlen sich absolut sicher. Von den Indios droht keine Gefahr – im Umkreis bis zu achtzig oder hundert Meilen gibt es kaum noch welche und wenn, dann leben sie versteckt und zurückgezogen oder haben sich Ausweichmöglichkeiten geschaffen wie unsere Leute im Tacna-Tal. Und die hier versklavten Indios führen ein viel zu erbärmliches Dasein, um noch die Kraft zum Rebellieren zu haben. Außerdem stehen sie Tag und Nacht unter Bewachung. Und Räuberbanden haben sich hier noch nicht blicken lassen. Potosi liegt zu weit von der Küste oder anderen großen Städten entfernt. Du weißt selbst, Bruder Hasard, wir haben fast einen Monat für unseren Marsch hierher gebraucht.“
Hasard nickte. Jetzt hielt er doch etwas den Atem an, denn diese Stadt in dreizehntausend Fuß Höhe inmitten einer einsamen Bergwelt war schlichtweg überwältigend. Sie erschlug einen. Die Städte, die er kannte, waren dagegen armselige Schatten. Das Wort „Potosi“ war gleichbedeutend mit Reichtum, Prunk und Luxus. So etwas hatte er noch nicht gesehen.
Ja, draußen vor der Stadt hatten ein paar armselige Hütten gestanden – als seien sie aussätzig. Hier jedoch herrschten die Steinbauten vor, versehen mit ornamentalen Fassaden, mit Nischen, Bögen, Simsen und Säulen, mit kunstvoll geschmiedeten Portalen, mit vorkragenden hölzernen Erkern und Balkons, deren Balkenwerk mit Schnitzereien von Meisterhand verziert war.
Hier mußten Kunstschmiede, Holzschnitzer und begabte Steinmetze am Werk gewesen sein. Ein Gebäude war prächtiger als das andere, ob es nun ein Bürgerhaus oder ein Kirchenbau war. Da war ein Haus aus rosa getöntem Gestein errichtet, ein anderes wiederum bestand aus geschliffenen Granitblöcken, die wie Zinn schimmerten. Für ein drittes Haus war grünlicher Marmor verwandt worden.
Dort öffnete sich ein zierliches Portal, eine schwarzhaarige Schönheit tippelte die Marmorstufen hinunter, schaute nach rechts und links, streifte die beiden Männer mit einem hochfahrenden Blick, rümpfte das gepuderte Näschen, schwenkte die Hüften und schritt stadtwärts. Alles an diesem Wesen schien zu glitzern – von den Diademen im Haar über die Ohrringe, die Halsketten, die Ringe an den Fingern, die Perlknöpfe an der Mantilla bis zu den Schuhen mit den silbernen Spangen.
Hasard starrte.
Pater Aloysius stieß ihn sanft an und räusperte sich.
„Nur eine Hure, Bruder Hasard“, sagte er. „Sie tragen Kleider aus Damast und Seide, golden und silbern bestickt. Die Gewebe stammen aus Granada, Flandern und Kalabrien, die Hüte aus Paris und London, die Diamanten aus Ceylon, die Edelsteine aus Indien, die Perlen aus Panama, die Strümpfe aus Neapel, die Parfüms aus Arabien. In den Häusern haben sie Teppiche aus Persien, Gläser aus Venedig und Porzellan aus China. Die Señores, denen sie diesen Aufwand zu verdanken haben, tragen die besten bestickten Tuche aus Holland, ihre Prunkdegen beziehen sie aus Toledo, Sattelwerk und Steigbügel ihrer Pferde sind aus reinstem Silber.“
„Mein Gott“, murmelte Hasard.
Pater Aloysius lächelte still.
„Was hattest du erwartet, Bruder?“ sagte er. „Dachtest du, hier Bettler zu sehen? Die gibt es nicht. Es gibt nur Reiche und Arme – die letzteren sind die Indios, vor allem jene, die im Berg schuften, damit sich jene Hure dort in Samt und Seide kleiden und mit dem Schmuck dieser Welt behängen kann. Sicher, bei den Reichen, wie ich sie nannte, sind Unterschiede anzumerken, aber die entsprechen mehr dem jeweiligen Stand. Unter ihnen sind Feldkapitäne und Soldaten, Mönche und Asketen, Abenteurer und Spieler, Huren wie jene und Edeldamen, Kaufleute und Beamte. Nur – sie hungern nicht, sie vegetieren nicht, sie arbeiten nicht bis zum körperlichen Zusammenbruch. Sicher auch gibt es hier das, was man als den Pöbel bezeichnet. Aber dann ist es der reichste Pöbel dieser Welt, weil er vom Tisch der Reichsten schmarotzt wie die Made im Speck. Das Silber aus dem Berg fließt durch Hunderte von offenen Händen, die alle schmutzig sind.“
„Und wo sind die weißen Schafe?“ fragte Hasard.
„Überall“, erwiderte Pater Aloysius ruhig. „Sie haben sich nur verblenden lassen. Eines Tages werden sie aufwachen.“
Sie schritten durch die Calle Ayacucho, die nach Osten verlief. Pater Aloysius deutete nach links voraus.
„Dort vorn siehst du die Moneda, Bruder, die Münze“, sagte er. „Dorthin wird das Silber aus dem Berg transportiert und zu Münzen geschlagen oder in Barren gegossen. Schau sie dir genau an, diese Silberwerkstatt. Von dort nimmt alles seinen Lauf – bis hinüber nach Spanien in die Alte Welt, in der dieses Silber seine mächtige und verderbliche Rolle spielt.“
Sie waren stehengeblieben, und Hasard schaute in die Richtung, in die Pater Aloysius gewiesen hatte. Auf Anhieb wirkte das Gebäude der Münze düster und drohend und so ganz anders als die benachbarten Bauten. Wie eine Festung, dachte Hasard.
Ein riesiger Torbogen bildete den Zugang ins Innere – einen Innenhof von der Größe einer kleinen Plaza, in deren Mitte ein fast orientalischer Brunnen aufragte. Das schmiedeeiserne Gitter in dem Torbogen war geöffnet. Links und rechts des Gitters stand je ein Posten. Ja, dieses Heiligtum wurde bewacht, wenn auch nur von zwei Soldaten.
Es tat sich etwas, denn die beiden Soldaten hatten das Kreuz durchgereckt und waren zu Standbildern erstarrt. Die Leute rechts der Straße hingegen begannen, sich wie Marionetten zu verbeugen.
Rechts? Was war denn da?
„Die Plaza“, raunte Pater Aloysius. „Dort befindet sich auch das Rathaus.“
Sie gingen ein Stück weiter in Richtung der Münze. Dann blieben sie wieder stehen – jetzt ebenfalls Marionetten in einem unbekannten Spiel, in welchem sich die so vornehm und aufwendig gekleideten Spanier – auch die Damen – plötzlich tief verneigten, als wehe der Mantel des Herrn an ihnen vorbei.
Von der Plaza wurde eine Sänfte zur Münze getragen – von sechs Indios, die an diese Sänfte gekettet waren wie Pferde oder Maultiere an eine Kutsche. Es war eine prächtige Sänfte, vergoldet, verziert, funkelnd, spiegelnd. Prächtig waren auch die Soldaten, die diese Sänfte eskortierten – wippende Federbüsche zierten ihre Eisenhelme. Oder waren die gar aus Silber?
Gar nicht prächtig sah der Mensch aus, den man durch die blitzenden Fenster im Inneren der Sänfte erkennen konnte. Er blickte starr vor sich hin und nahm keine Notiz von den ehrenwerten Señores, Señoras und Señoritas, die ihm mit Verbeugungen, Knicksen und Kopfneigen tiefsten Respekt bekundeten.
„Don Ramón de Cubillo, der Provinzgouverneur“, flüsterte Pater Aloysius und fügte respektlos und fast etwas lauter hinzu: „Das größte Arschloch südlich von Lima!“
Hasard zuckte direkt zusammen. Dieser Pater war immer so geradeheraus. Aber es stimmte, auch wenn Hasard diesen Menschen anders beschreiben würde.
Ein fetter Kerl mit einem Froschgesicht saß in der Sänfte. Und mit diesem Froschgesicht stierte er trüb und grämlich vor sich hin, das breite Froschmaul nach unten gebogen, als sei die Jagd nach dicken Fliegen und Brummern ergebnislos gewesen. Auf seiner Stirn perlte sogar Schweiß.
Hatte er Sorgen, der Ärmste? Ein dürrer, aber dennoch sehr fein herausgeputzter Teniente stelzte hinter der Sänfte her wie ein unterernährter Gockel hinter dem Rest seiner ansonsten davongelaufenen Hennen. Er meinte wohl, etwas für den Frosch in der Sänfte tun zu müssen.
Er reckte den dünnen Hals und krähte: „Es lebe der Gouverneur!“
Deswegen liefen die sechs Indios auch nicht schneller. Die soldatische Eskorte hingegen, die Señores, Señoras und Señoritas wiederholten den Gockelruf, aber Hasard hatte den Eindruck, daß die Stimmen der Señores keineswegs schmetternde Trompeten waren – und den Damen hüpfte auch kein Busen aus der Garnitur, als sie ihren Gouverneur „leben“ ließen.
Sehr müde war das alles.
Und sehr müde, wenn auch jovial, winkte Don Ramón nach links und nach rechts. Seine Patschhand war mit funkelnden Ringen besteckt. Vielleicht war deren Gewicht zu schwer, um freudig zu winken. Aber da saß kein Schwung dahinter, nicht ums Verrecken. Und er starrte auch weiter aus Froschaugen trübe vor sich hin.
Der Teniente blieb ruckartig stehen – vor Pater Aloysius.
„Ich habe gesehen“, schnarrte er, „daß Sie dem verehrten Gouverneur nicht gehuldigt haben!“
Pater Aloysius lächelte den Teniente milde an und sagte: „Ich huldige dem Herrn, Bruder Teniente, und unseren verehrten Gouverneur schließe ich in mein Gebet ein, das da lautet: Gebet, so wird euch vergeben! Und der Bruder Lukas, der dies sagte, fügte hinzu: Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, da ihr mit messet, wird man euch wieder messen.“
„Äh!“ sagte der Teniente und noch einmal: „Ah!“ Er konnte mit dem, was der Bruder Lukas verkündet hatte, wohl nicht viel anfangen. Dafür musterte er jetzt Hasard, zog die Augenbrauen hoch und schnarrte: „Und wer sind Sie?“
„Ein Pilger, Señor Teniente“, sagte Hasard freundlich. „Der Pater und ich befinden sich auf dem Weg nach Jerusalem.“
„Was – was? Wie?“ Der Gockel hatte Schluckbeschwerden und ruckte mit dem Kopf, als picke er nach einem Wurm. „Jerusalem? Das liegt doch woanders – äh – in Palästina!“
„Wir haben, um den Herrn zu erfreuen, den weitesten Weg genommen“, erläuterte Pater Aloysius.
„Verrückt!“ schnappte der Teniente, zuckte herum und stelzte mit eiligen Schritten hinter der Sänfte her.
Hasard und der Pater wechselten einen schnellen Blick und hatten Mühe, nicht ein donnerndes Gelächter anzustimmen. Aber das wäre fehl am Platze gewesen.
Die Sänfte verschwand im Innenhof der Münze. Die beiden Standsoldaten erwachten wieder zum Leben und verschlossen das schmiedeeiserne Tor.
„Der Bastard ist zu vollgefressen und zu faul, vom Rathaus zur Münze zu Fuß zu gehen“, sagte Pater Aloysius. Dann zog ein Grinsen über sein scharfkantiges Gesicht. „Hast du seine grämliche Miene gesehen, Bruder Hasard? Sie stimmt mich heiter. Ihn zwicken und zwacken die Sorgen, das ist es. Denn es hapert mit dem Nachschub für die Mine – keine Arbeitskräfte, kein Silber. So einfach ist das. Und er muß befürchten, daß ihm der Vizekönig in Lima aufs Dach steigt, wenn die Silberlieferungen immer spärlicher werden.“
Hasard nickte. Ein noch vager Plan ging ihm durch den Kopf.
Sie überquerten die Calle Lanza, die nach Süden auf den Silberberg zuführte, und stießen auf die Plaza, wo zur Zeit ein Markt abgehalten wurde. Nördlich der Plaza ragte die Kathedrale auf, ein imposanter Bau, der die anderen Prachtbauten noch in den Schatten stellte. Ja, natürlich, auch die Kirche hatte Geld und konnte es mit vollen Händen ausgeben.