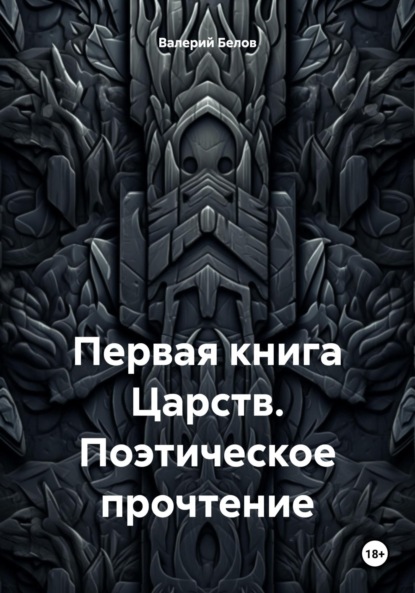Seewölfe Paket 23

- -
- 100%
- +
Er plärrte also, und Carberry war fassungslos.
Der Profos faßte sich erst wieder, als ihn der Dicke angreinte: „Sie haben mir weh getan, Sie Schlimmer!“
Da grinste der Profos und säuselte: „Ei-ei-ei, hat der böse Onkel dem Dickerchen was aufs Bäckchen geklopft, ja, ei der Daus! Soll ich das Doktorchen holen, um das Wehwehchen zu heilen?“ Und dann röhrte der Profos: „Du fängst gleich noch eine, du aufgeschwemmte Pißnelke …“
„Na, na, na, Mister Carberry“, mahnte Dan O’Flynn grinsend. „Denk an die Vulgärsprache …“
„Der Zorn des Herrn ist in mir“, sagte Carberry aufgebracht und fuhr den Dicken an: „Hör auf zu jammern, du Heulphilipp, sonst muß ich aus deinem Hintern Speckwürfel schneiden und sie dir ins Froschmaul stopfen!“
Der Dicke stierte zu ihm hoch, seine Augen quollen beängstigend aus den Höhlen, sein Mund bewegte sich schnappend wie ein Fischmaul, dann verdrehte er plötzlich die Augen – und fiel um.
„Du hast ihn verschreckt“, sagte Dan O’Flynn, „und darum ist er weggetreten. Vergiß nicht, ihm sein Säbelchen abzunehmen. Am besten, wir durchsuchen ihn gleich von oben bis unten.“
Carberry nickte, und sie beugten sich über den Dicken.
Inzwischen hatten Pater Aloysius und Karl von Hutten bereits die Indios beruhigt, die erst allmählich begriffen, daß für sie die Stunde der Freiheit geschlagen hatte. Hasard filzte den Teniente und fand einen Schlüssel, der in die Kettenschlösser paßte. Im Nu waren die Indios befreit. Pater Aloysius empfahl ihnen, das Weite zu suchen und Begegnungen mit Spaniern zu vermeiden. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Mit glücklichen Gesichtern überkletterten sie den Westhang der Schlucht, winkten oben noch einmal und verschwanden.
Jean Ribault starrte auf die Sänfte und kratzte sich hinter dem Ohr.
„Die sollten wir verschwinden lassen, wie?“ sagte er zu Hasard.
Hasard nickte. „Aber durchsucht sie erst – hinten scheint eine Art Reisetruhe eingebaut zu sein.“ Und zu Stenmark sagte er: „Lauf mal voraus, Sten! Da vorn links ist ein Einschnitt, vielleicht eine Nebenschlucht, wo wir die Sänfte verstecken können.“
„Aye, Sir.“ Stenmark trabte ab, um nachzusehen.
Matt Davies hatte bereits mit seiner eisernen Hakenprothese die Reisekiste aufgeknackt und schaute mit Jean Ribault und Gary Andrews hinein. Jean Ribault drehte sich grinsend zu Hasard um.
„Ledersäcke, Sir!“ sagte er. „Du hast eine gute Nase.“
Hasard zuckte mit den Schultern, lächelte dann und sagte: „Laß mich raten! Ich tippe auf Silbermünzen mit der Potosi-Prägung.“ Dann wurde er wütend und knurrte: „Diesen Silberscheiß müssen die Indios also auch noch schleppen, wenn sie den Fettsack durch die Gegend tragen.“
Jean Ribault hob den rechten Zeigefinger und drohte. „Silberscheiß ist Vulgärsprache, Sir! Laß das nicht Mister Carberry hören!“
Hasard hob fluchend die Reitgerte des Teniente de Olivella auf und ließ sie durch die Luft pfeifen.
„Ich glaube“, sagte er grimmig, „über diesen ganzen Mist hier kann man sich nur noch vulgär äußern.“ Er holte Luft. „Also, was befindet sich in den Säcken?“
„Silbermünzen mit Potosi-Prägung!“ meldete Matt Davies und fügte hinzu: „Möchte nicht wissen, was der Dicke alles in seinem Landhaus gestapelt hat, wenn er sich täglich dorthin tragen läßt. Die Talerchen hat er doch abgestaubt, der Bastard!“
„Kein Widerspruch“, knurrte Hasard. „Nehmt mit, was ihr tragen könnt. Den Rest werfen wir weg.“
Stenmark kehrte zurück und meldete: „Nebenschlucht mündet an einem Abhang, der ziemlich steil ist. An seinem Fuß liegt ein Tümpel.“
„Also hinein mit der Sänfte“, sagte Hasard. „Packt an, Männer! Dan bleibt als Wache hier.“
Sie holten sechs Ledersäcke aus der Reisekiste, die eine Schatzschatulle war, verteilten sich an den Holmen, lüfteten die Sänfte an und trugen sie an den Abhang der Nebenschlucht. Von dort wurde sie nach unten gestoßen. In der Reisekiste befanden sich noch weitere sechs Ledersäcke. Die Sänfte klatschte in den Tümpel und ging blubbernd auf Tiefe.
„Der Schatz im Silbersee“, brummte Carberry und blickte sinnig auf die fast schwarze Wasserfläche, die sich wieder beruhigte. „Wer ihn findet, möge auf uns einen Rum trinken – wenn’s kein Don ist. Und wenn’s ein Don ist, möge er später in der Hölle braten.“
„Amen“, sagte Matt Davies. „Verdammt schwer war diese Sänfte, was?“
„Das erzähl mal dem dicken Froscharsch“, sagte Carberry.
Sie kehrten zu ihren fünf Gefangenen zurück.
„So allmählich wachen sie auf“, sagte Dan O’Flynn, „und sind überhaupt nicht fröhlich, daß ihr Wachdienst beendet ist. Und unser Dicker ist nur am Bibbern.“
Hasard nickte nur. Er hatte immer noch die Reitgerte bei sich und blieb vor dem Teniente stehen, der zu ihm hochstarrte und verwirrt sagte: „Sie – Sie sind doch der Pilger!“
Hasard ignorierte die Frage, musterte die vier anderen Soldaten, den dicken Gouverneur und schließlich den Teniente.
Kühl sagte er: „Sie haben sich als Gefangene zu betrachten, Señores. Ihre Überlebenschance hängt von Ihrem Verhalten ab. Sollten Sie sich renitent zeigen oder versuchen zu fliehen, dann haben Sie keine Rücksichtnahme zu erwarten – so wenig Rücksicht, wie Sie das gegenüber den Indios tun, die Ihr Teniente als faule Hunde, dreckiges Pack und verlauste Affen bezeichnete, wobei er sich dieser Reitgerte bediente. Hören Sie genau zu: Für meine Männer und mich sind sie der letzte Dreck. Die Indios stehen weit über Ihnen …“
„Unverschämtheit!“ schrie der Gockel-Teniente und bäumte sich auf. „Was erlauben Sie sich, Sie Pilger-Strolch? Ich lasse mich nicht beleidigen! Ich bin Offizier und Edelmann und nicht mit einem Wilden zu vergleichen. Ich verlange Genugtuung! Sofort! Auf der Stelle!“
„Das können Sie haben“, sagte Hasard akzentuiert und eiskalt. Er nickte Carberry zu. „Lös seine Fesseln, Ed, und gib ihm seinen Degen.“
Carberry nickte schweigend, löste die Fesseln und warf dem Teniente den Degen vor die Füße.
Die Männer wichen zurück.
Hasard nahm die Reitgerte in die linke Hand, zog mit der Rechten das Entermesser und trat ein paar Schritte zurück, belauert von dem Teniente. Der griff nach dem Degen und sprang auf. Und sofort stürmte er auf Hasard los.
Hasard wich zur Seite, leicht und geschmeidig und locker. Aber als der Teniente an ihm vorbeistürmte, zog er ihm die Reitgerte über die Schulter. Es war ein peitschender Schlag, und der Teniente brüllte auf.
„Hier wird nicht gejammert!“ rief Hasard höhnisch. „Das beleidigt die Ohren des Gouverneurs, du Mißgeburt eines Affen!“
Es waren genau die gleichen Worte, die der Teniente benutzt hatte – gegenüber dem mißhandelten Indio.
Mit einem Wutschrei griff der Teniente erneut an. Hasard hatte Reitgerte und Entermesser gewechselt. Jetzt befand sich die Reitgerte in seiner Rechten. Und er glitt wieder zur Seite, fetzte dem Teniente jedoch dieses Mal die Gerte quer übers Gesicht. Wie bei dem Indio quoll ein Striemen auf.
Der Teniente schrie gellend und wischte sich übers Gesicht.
„Nicht jammern – kämpfen!“ höhnte Hasard. „Sie fühlten sich doch beleidigt, Sie Affe! Was ist? Geben Sie schon auf, nur weil Sie zweimal von Ihrer eigenen Gerte getroffen wurden, mit der Sie auf wehrlose Indios eingedroschen haben, die Ihren verdammten Gouverneur tragen mußten? Wie schmeckt denn die Gerte? Gut, nicht wahr? Keine Sorge, ich werde Ihren Appetit stillen, Olivella! Ich, der Pilgerstrolch, Sie mieser Edelmann!“
Die Soldaten glotzten.
Das Gesicht des Dicken hatte die Farbe von Spinat angenommen. Er schnatterte mit den Zähnen, seine Halswampe zitterte wie Pudding, über das grüne Gesicht perlte Schweiß.
Hasard sprang vor, und wieder schlug er mit der Reitgerte zu. Jetzt schrie auch der Dicke auf – unisono mit seinem Teniente, der sich für den Nabel der Welt hielt und dabei ein Sadist war. Carberry hielt dem Dicken die rechte Faust unter die Nase, und da verstummte er.
Der Teniente hüpfte herum und preßte beide Hände vors Gesicht. Den Degen hatte er fallen lassen. Hasard beförderte die Waffe mit einem Fußtritt zu ihm hin. Angewidert warf er die Reitgerte weg. Das Entermesser wechselte in seine Rechte.
„Vorwärts, Señor Affe!“ knurrte er. „Bringen wir’s zu Ende, bevor ich das Kotzen vor Ihrer Großmäuligkeit kriege!“
Undeutlich brabbelte der Teniente: „Und Sie stoßen mich nieder, wenn ich meinen Degen aufhebe!“
„Ich heiß ja nicht Olivella“, sagte Hasard eisig und trat mehrere Schritte zurück.
Der Teniente bückte sich rasch, griff nach dem Degen und attackierte. Mit Gebrüll, versteht sich. Vielleicht hatte man ihm auf der Fechtschule in Toledo gesagt, das Gebrüll wirke auf den Gegner demoralisierend, und er bekäme das große Zittern.
Im Falle dieses Gegners traf das nicht zu. Was indessen zitterte, war dessen Entermesser, das schwirrende, silbrige Reflexe durch die Luft zeichnete. Und dann war da plötzlich dieser tiefe Schmerz in der Brust. Die Sonne gleißte auf einer Klinge. Sie blendete, und der Teniente schloß die Augen vor dem grellen Licht. Der Schmerz wurde scharf, riß ab, und es wurde dunkel.
Der Teniente sank zu Boden. Den Himmel über sich sah er nicht mehr. Wenn er eine Seele gehabt hatte, dann wanderte sie jetzt auf dem schmalen Grat dorthin, wo sich die Guten und die Bösen trennten. Die einen gingen ins Helle, die anderen versanken im Dunkel. Die Helligkeit war nicht für den Teniente geschaffen.
Hasard starrte schweigend auf ihn hinunter. Er hatte den Kopf gesenkt und dachte an den Indio, den die Reitgerte zweimal an derselben Stelle getroffen hatte, an den Indio, der gedemütigt und verhöhnt worden war, an den Indio, über dessen blutigen Rücken der Teniente meckernd gelacht hatte. Und er dachte an die Indios im Berg, an die Geschundenen und Gemordeten.
Der Wind strich wehklagend durch die Schlucht.
Hasard hob den Kopf, verstaute sein Entermesser, beugte sich zu dem Teniente, drehte ihn etwas und packte ihn am Genick. Carberry wollte ihm helfen, aber Hasard winkte ab.
„Das ist meine Sache, Ed“, sagte er leise. „Klart hier inzwischen auf. Nichts darf darauf hindeuten, was in der Schlucht passiert ist.“
„Aye, Sir“, murmelte der Profos.
Hasard schleppte den Teniente in die Nebenschlucht, legte ihn in eine Felsspalte, sammelte Steine und häufte sie über den Toten. Dann trat er noch einmal an den Steilhang und schaute zu dem Tümpel hinunter. Von der Sänfte war nichts zu sehen.
Die Männer waren abmarschbereit, als er zurückkehrte.
„Was – was geschieht jetzt?“ fragte der Dicke ängstlich.
„Wir marschieren zu unserem Standquartier, das wir im Cerro Rico aufgeschlagen haben“, erwiderte Hasard kühl.
„Ich auch?“ fragte der Dicke entsetzt.
„Natürlich. Oder bilden Sie sich ein, wir tragen Sie?“
„Ich – ich kann nicht laufen“, jammerte der Dicke. „Ich bin gehbehindert. Der Arzt hat mir Schonung verordnet. Ich habe ein schwaches Herz und leide unter Kurzatmigkeit.“
„Was meinen Sie wohl, was mich das interessiert“, sagte Hasard eisig. „Es interessiert mich so wenig, wie es Sie interessiert, ob die Indios in Ihrem verfluchten Berg qualvoll krepieren. Ein Schlächter und Schinder wie Sie hat kein Mitleid verdient, ganz abgesehen davon, daß Sie nur simulieren, weil Sie zu faul sind, ein paar Schritte zu laufen.“ Hasard schaute zum Profos. „Ist die Reitgerte noch da, Ed?“
„Hier, Sir!“ Carberry zog die Gerte mit dem schönen silbernen Griffstück aus dem Leibgurt und ließ sie genußvoll durch die Luft pfeifen, so daß der Dicke zusammenzuckte.
„Wenn er nicht laufen will“, sagte Hasard langsam und deutlich, „dann habe ich nichts dagegen, daß er einmal selbst spürt, wie es ist, wenn die Gerte über seinen Rücken tanzt. Was den Indios recht zu sein hatte, sollte ihm billig sein.“
„Das – das ist barbarisch!“ sagte der Dicke ächzend.
„Da stimme ich Ihnen zu, Señor“, sagte Hasard. „Und ich beglückwünsche Sie zu dieser Erkenntnis, auch wenn sie reichlich spät erfolgt und offenbar für die Indios keine Gültigkeit hatte. Vorwärts, Männer!“
Für Don Ramón de Cubillo wurde der Marsch zu einem Alptraum. Die Soldaten verhielten sich fügsam. Sollten sie tatsächlich „harte Burschen“ sein, wie Pater Augustin gesagt hatte, dann war ihnen wohl inzwischen klargeworden, daß diese zehn Männer noch härter waren – gewissermaßen aus Eisen.
4.
Es dunkelte bereits, als sie zu ihrem Standquartier auf der Südseite des Silberberges zurückkehrten. Wieder war ihnen niemand begegnet. Die Einsamkeit und Verlassenheit der Bergwelt außerhalb von Potosi waren total.
Die vier Soldaten – weiterhin gefesselt – wurden in einem Nebenstollen untergebracht. Sie waren gründlich durchsucht worden. Sogar ihre Stiefel hatten sie ausziehen müssen – mit Erfolg, denn in den Stulpen hatten Messer gesteckt.
Pater David meldete keine Vorkommnisse, was die Abgeschiedenheit der Südseite des Berges bestätigte.
Die Gefangenen erhielten zu essen und zu trinken.
Dann nahm sich Hasard den dicken Gouverneur vor, diese wabbelige Masse Fett in einem verweichlichten, von Ausschweifungen und Wohlleben geschwächten Körper. Tatsächlich wirkte dieser Mann jetzt wie eine glitschige Qualle, die eine Welle auf den Strand getragen hat, von wo sie sich aus eigener Kraft nicht mehr fortbewegen kann.
Er war fertig, der Señor Gouverneur, der offenbar zum ersten Male in seinem Leben mehr als zehn Meilen auf seinen Watschelfüßen zurückgelegt hatte. Er ächzte, stöhnte und winselte.
Als, Carberry ihm mit einem freundlichen Grinsen die Reitgerte zeigte, verstummte er und schluckte nur noch.
Hasard fragte: „Wann werden Sie in Potosi zurückerwartet, Cubillo?“
„Morgen“, erwiderte der Dicke weinerlich und schielte zu der Reitgerte. „Denn da habe ich eine Ratsversammlung anberaumt.“
„Ah, eine Ratsversammlung!“ Hasard strich sich nachdenklich über das bärtige Gesicht. „Was soll denn da beraten werden?“
Der Dicke preßte das Froschmaul zusammen. Dann wurde er trotzig und sagte böse: „Das geht Sie gar nichts an!“
Hasard zog die Augenbrauen hoch. „Vorsichtig, Freundchen. Hier bestimme ich, was mich etwas angeht. Falls Sie das noch nicht begriffen haben, können wir dem sehr schnell abhelfen.“ Er nickte Carberry zu.
Carberry übergab die Reitgerte Matt Davies, zog ein Messer und wetzte es über einem Stein.
Er sagte: „Sir, ich schlage vor, ich tätowiere ihm ein Symbol auf den dicken Arsch. Was hältst du davon?“
„Hm, gar nicht schlecht. An was für ein Symbol hattest du gedacht?“
Carberry wetzte mit Eifer. „An ein Herz, Sir – äh –, auf die linke Backe ein Herz und auf die rechte Backe eine Blume. Oder soll ich auf beide Backen einen Totenkopf tätowieren? Das ist auch ein schönes Motiv und sehr beliebt.“ Er prüfte die Schärfe der Klinge und nickte zufrieden.
„Ich bin für den Totenkopf“, sagte Hasard entschieden.
„Nein …“, flüsterte der Dicke und hatte wieder das Spinatgesicht.
„Also? Über was soll beraten werden?“ fragte Hasard.
„Über – über Maßnahmen, wie dem Mangel an Arbeitskräften für den Silberabbau abgeholfen werden kann“, sagte der Dicke mit schwacher Stimme.
„Soso! Und wie soll dem Mangel abgeholfen werden? Sie haben doch sicherlich schon eine Idee, nicht wahr?“
Der Dicke druckste herum. Als Carberry mit dem Messer hantierte, sagte er hastig: „Ich – ich habe geplant, in Potosi Zwangsrekrutierungen vornehmen zu lassen.“
„Wer sollte rekrutiert werden?“ fragte Hasard hart.
„Ah – Soldaten, Handwerker, niedere Bürger, Stadtstreicher und so weiter.“
„Und Padres, nicht wahr?“ Das fragte Pater Aloysius mit scharfer Stimme.
Der Dicke zuckte zusammen und jammerte: „Was soll ich denn tun? Wenn der Silberabbau zum Erliegen kommt, bin ich geliefert. Man wird mich vor ein königliches Gericht zerren und Rechenschaft verlangen.“
„Vor ein Gericht gehören Sie allerdings“, sagte Hasard grimmig, „aber nicht, weil der Silberabbau stockt, sondern weil Sie Ihren König beklauen und sich selbst die Taschen vollstopfen. Ich schätze, in Ihrem Landhaus befinden sich Silberschätze, über die Ihr Philipp in Entzücken geraten würde.“
„Woher wissen Sie das?“ schrie der Dicke kreidebleich und kassierte umgehend eine Maulschelle wegen „ungebührlichen Verhaltens und lauten Schreiens“, wie sich Carberry ausdrückte.
„Sie scheinen Ihre Silbersäcke vergessen zu haben, die Sie in der Sänfte mitführten“, sagte Hasard verächtlich. „Von daher ist nicht schwer zu erraten, daß Sie im Laufe der Zeit Unmengen an Silber gehortet haben müssen. Sie haben es gescheffelt, Sie Gauner. Und Sie zittern nicht, weil in der Silberschatulle Ihres Königs eine Ebbe bevorsteht, sondern weil der Silberstrom nicht mehr durch Ihre Taschen fließen konnte. Sogar jetzt, in dieser Situation des Mangels an Arbeitssklaven, schaffen Sie noch Silber beiseite! Das muß man sich mal vorstellen!“
Die Qualle sackte noch mehr in sich zusammen – Beweis dafür, wie sehr Hasard recht hatte.
„Mann! Wir sollten dieses Landhaus auseinandernehmen!“ stieß Jean Ribault hervor.
Hasard winkte ab. „Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Bringt ihn in einen anderen Nebenstollen und verpaßt ihm einen Knebel, damit wir das Gejammere nicht mehr zu hören brauchen.“
„Ich bin ruiniert!“ röchelte der Dicke.
Der Profos grunzte befriedigt. „Wie mich das freut, Fettmops! Noch fröhlicher wäre ich natürlich gestimmt, wenn ich dir deinen Speckhals umdrehen dürfte. Na, vielleicht erlaubt mir das mein Admiral, wenn hier alles vorbei ist.“
„Er ist Admiral?“ fragte der Dicke bibbernd.
„Natürlich. Dachtest du, er sei Sargtischler oder Lampenputzer? O nein! Er ist Großadmiral aller vereinigten chinesischen, babylonischen und alemannischen Flotten, die unter dem Großkreuz des Ordens der schrägen Isabella segeln und erst kürzlich ihr Banner auf der Rückseite des Mondes aufpflanzten. Klar?“
„N-nein“, flüsterte der Dicke mit schreckgeweiteten Glubschaugen. Es war ja auch sehr verwirrend, in wessen Hände er da gefallen war. „Schrä-schräge Isabella – wer ist das?“ stotterte er.
„Die Nichte der Hure von Babylon“, sagte Carberry mit dumpfer Stimme und rollte entsetzlich mit den Augen.
Die Männer mußten sich umdrehen, um ihr Grinsen zu verbergen. Es war ja auch mal wieder starkes Profosgeschütz, was der gute Carberry auffuhr.
„Ed!“ mahnte Hasard sanft. „Verfrachte ihn in einen Nebenstollen.“
„Jawohl, Großmeister!“ Und schon fuhr Carberry den Dicken an: „Hoch mit dir, du Schmalzfaß! Oder muß ich erst böse werden?“
Der Dicke quälte sich hoch, wurde von Carberry in einen Nebenstollen dirigiert, durfte sich hinlegen und wurde geknebelt.
Als der Profos zu den Männern zurückkehrte, rieb er sich die Pranken und sagte: „Der ist eingestimmt, darauf könnt ihr euch verlassen. Oder was meinst du, Sir? Soll ich noch mehr aufdrehen?“
„Ich glaube nicht, Ed“, sagte Hasard lächelnd. „Schätze, das genügt. Danke, daß du mich zum Großadmiral ernannt hast.“
„Hab’ ich gern getan, Sir“, sagte der Profos treuherzig. „Also, jetzt haben wir den Dicken vereinnahmt. Und wie geht’s weiter?“
„Darüber wollte ich mit euch sprechen“, erwiderte Hasard. „Was mir wichtig war, habe ich erfahren: Don Ramón wird erst morgen in Potosi zurückerwartet, die Suche nach ihm wird frühestens losgehen, wenn diese Ratsversammlung beginnt. Bis dahin wird ihn niemand vermissen, denn ich schätze, er hat sich verbeten, in seinem Landhaus gestört zu werden. Was ich plane, ist folgendes: Er wird morgen seine Ratsversammlung abhalten, jedoch in unserer Begleitung. Ich werde ihm diktieren, was er seinen Señores zu sagen hat. Damit diese Señores aber ‚eingestimmt‘ sind und wissen, daß hier ein kompromißloser und harter Gegner am Werk ist, werden wir heute nacht den Pulverturm sprengen. Das hat auch den Nebeneffekt, daß wir sie im gewissen Sinne entwaffnen, denn wo kein Pulver ist, kann nicht mehr geschossen werden. Ferner wird ihnen für längere Zeit das Pulver fehlen, das sie brauchen, um sich ihre Stollen in den Berg zu sprengen. Wir selbst allerdings werden uns mit Pulver eindecken, und zwar für unseren Rückzug aus Potosi. Da könnte man beispielsweise mit einer Sprengung einen Bergpfad zum Einsturz bringen.“ Hasards Blick wanderte über die Männer. „Hat jemand Bedenken, Einwände oder einen anderen, besseren Vorschlag?“
Die Männer starrten ihn stumm an – und grinsten.
Dann jedoch sagte Dan O’Flynn: „Ist das nicht riskant, den Kerl zur Ratsversammlung zu begleiten?“
Hasard schüttelte den Kopf. „Pater Augustin, mit dem wir die Geiselnahme erörterten, meinte, auch als Geisel habe Don Ramón Befehlsgewalt, und man werde ihm gehorchen. Im übrigen soll ja gerade die Sprengung des Pulverturms die Señores einschüchtern. Ich werde ihnen dazu ein paar freundliche Worte sagen und erklären, die Sprengung sei ein Werk meiner Truppen gewesen, die zu diesem Zeitpunkt auch die Stadt umstellt hätten.“
„Phantastisch!“ sagte Jean Ribault begeistert. „Ich gestehe, daß mir Dans Bedenken auch kurz durch den Kopf gingen, aber der Bluff mit den Truppen sticht. Grandios!“
Dieser Meinung waren die anderen Männer auch.
Hasard bestimmte Jean Ribault, Karl von Hutten, Pater Aloysius, Dan O’Flynn, Carberry und Matt Davies zum Unternehmen Pulverturm. Sie nahmen vier Maultiere mit.
Der Pulverturm – ein Gemäuer aus schweren, roh behauenen Felsbrocken – stand am südöstlichen Stadtrand zwischen Potosi und Cerro Rico. Das hatte seinen guten Grund, denn ein Pulverturm inmitten einer Stadt war Teufelswerk. Kein spanischer Baumeister würde so verrückt sein, diesen Bau in einer Stadt zu errichten. Stets befand er sich am äußeren Rand der Stadt, aber natürlich innerhalb der Stadtmauer.
Nur – im Falle der Stadt Potosi hatten die Baumeister auf eine Mauer verzichtet. Die Legende berichtet, daß einer dieser Señores lachend gesagt hätte: Eine Mauer, Leute? Die könnt ihr euch sparen! Eure Mauern sind die Felsgrate auf Hunderte von Meilen rings um eure Stadt! Und dazwischen liegen Stadtgräben, nämlich Schluchten und tiefe, unbegehbare Täler, die unüberbrückbarer sind als das Wasser eines Stadt- oder Burggrabens!
Sicher, der Señor Baumeister hatte recht gehabt, dachten sie doch alle mit Schaudern an die „Straße“ nach Lima oder Arica, die über höllische Pässe, schwingende Hängebrücken über tosenden Wildbächen oder mörderischen Wüsten führte. Sie hatten ja alle von Lima oder Arica aus über diese „Straße“ reisen müssen, um die gelobte Silberstadt Potosi zu erreichen.
Einer der Stadtgründer hatte sogar stolz erklärt: Wir bauen die erste Stadt dieser Welt ohne Mauern! Denn nie wird ein Feind wagen, zu unserer Stadt vorzudringen!
Wenn wir uns nicht täuschen, werden die anderen Señores damals, als sie mit ihren ersten Prunkbauten beschäftigt waren, zu diesem markigen Spruch beifällig genickt und gemurmelt haben: recht hat er, wahr gesprochen!
Und der Verlauf der letzten Jahrzehnte seit der Stadtgründung hatte die These von der Unangreifbarkeit der Stadt ohne Mauer bestätigt. Nie war ein Feind zur Stadt vorgedrungen. Nie!
Aber Cartagena war überfallen worden, Panama, Havanna, Porto Bello, Vera Cruz – Küstenstädte, befestigt mit Mauern und dennoch dem wilden Zugriff von Piraten preisgegeben.
Aber Potosi lag am Ende der Welt.
Sie würden sich noch wundern, diese reichen, satten und selbstzufriedenen Bürger der Stadt.
Da lag also dieser Pulverturm abseits der Stadt – aus Sicherheitsgründen, die jedem Bürger verständlich waren. Es wäre ja auch ungemütlich gewesen, auf einem Pulverfaß zu sitzen. Völlig klar.
Nur war – hatte daran niemand gedacht? – diese abseitige Lage des Turms auch geradezu ideal für Bösewichter, welche die Absicht hatten, die Bergwelt mit einem Knall zu erschüttern. In der Stadt hätten sie keine Chance gehabt, sich dem Pulverturm auch nur bis auf zehn Schritte zu nähern – in der Dunkelheit der Nacht, versteht sich.
Draußen verhielt sich das anders. Immerhin, zwei Posten bewachten den Pulverturm. Aber wo seit Jahrzehnten nichts passiert ist, da werden solche Posten zu einer reinen Farce. Da witzelt man sogar darüber, weil solche Posten zu Einrichtungen geworden sind, deren Zweckmäßigkeit kein Mensch mehr versteht. Genausogut kann man jahrzehntelang eine Schatztruhe bewachen, deren Inhalt aus Luft besteht. Es ist dann eine „symbolische“ Wache um des Wachegehens willen.