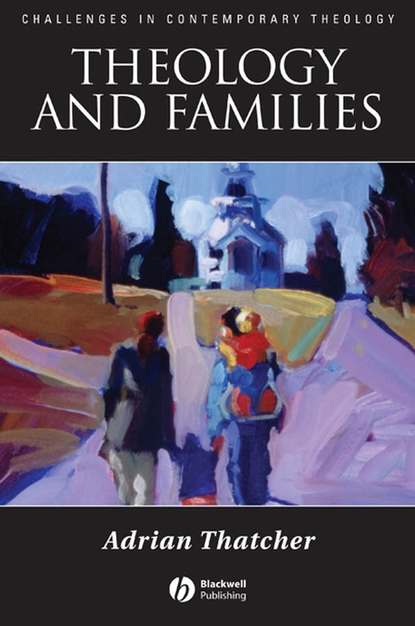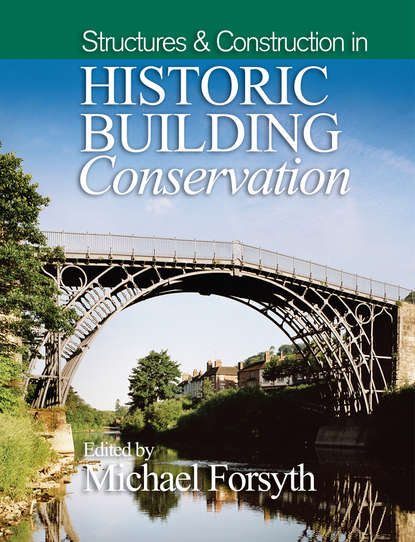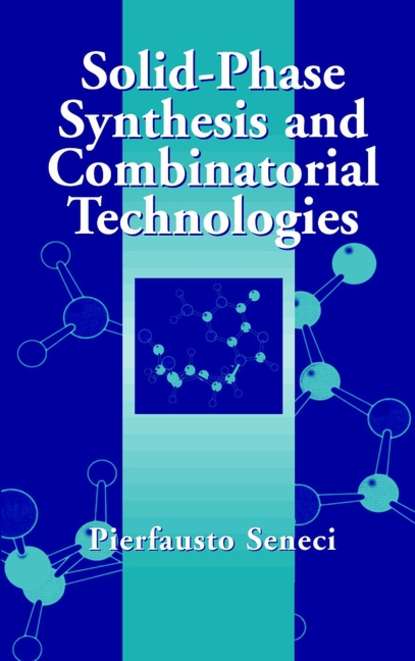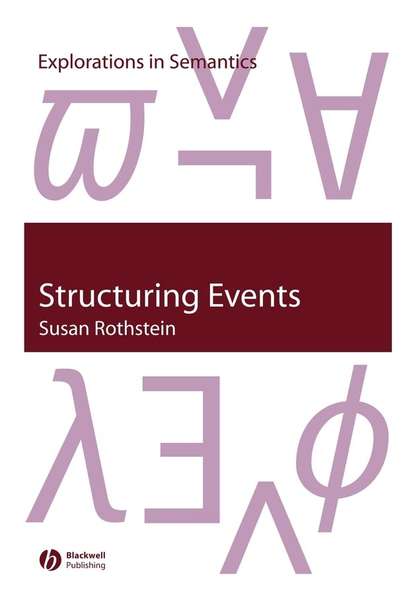Seewölfe Paket 23

- -
- 100%
- +
Hätte Margarita davon gewußt, dann hätte ihr Herz für den verwegenen schwarzhaarigen Mann geschlagen. Ihr taten die Indios leid. Sie hatten niemandem etwas getan, waren friedlich und lebten zurückgezogen in ihren Dörfern. Dafür wurden sie getreten, geschlagen und ermordet.
Die Kutsche rollte davon. Diego de Xamete befand sich auf seiner üblichen Rundfahrt. Er kassierte seine Schmiergelder ab. Margarita wußte mit ziemlicher Sicherheit, von wem er Geld erhielt und wie hoch die Summen waren. Die meisten wohlhabenden Bürger hatten Dreck am Stecken, keiner verfügte über eine blütenweiße Weste. De Xamete wußte dies auf seine Art auszunutzen. Sein Schweigen war Gold und Silber wert.
Aber jetzt war er gezwungen, einiges von seinen „Einkünften“ wieder zu opfern. Silberlinge mußten rollen, denn Don Ramón de Cubillo, der Provinzgouverneur von Potosi, hatte angedroht, daß der Amtssessel des Bürgermeisters von Arica wackeln werde, falls de Xamete nicht in der Lage sei, in kurzer Zeit möglichst viele neue Sklaven zu beschaffen. Potosi brauchte Indios – dringend. Sonst ließ die Produktion der Mine und der Münzpresse nach. Das konnte man sich auf keinen Fall leisten.
Diego de Xamete also hatte den glorreichen Einfall gehabt, auf die Ergreifung jedes „Indio-Affen“ ein Kopfgeld auszusetzen. Dafür zahlte er die Silberlinge gern, denn sie sorgten ja dafür, daß er im Amt blieb und seine Pfründe nicht versiegten.
Die Investition lohnte sich. Täglich schleppten die Soldaten neue Gefangene nach Arica, und aus diesem Grund hatten sie Silberlinge in den Taschen, die sie wiederum in den Kneipen und Kaschemmen und den Hurenhäusern auf ihre Weise umsetzten.
Der erfolgreichste Kerl von allen war der Sargento Zeno Manteca. Margarita betrachtete ihn, wie er über die Plaza spazierte. Ein übler Halunke, skrupellos und gewalttätig. Am liebsten hätte sie ihm in sein hakennasiges Gesicht gespuckt. Auch das konnte sie sich nicht erlauben. Manteca konnte außerordentlich gefährlich werden, auch Frauen gegenüber. Er war unberechenbar, und von einem Augenblick auf den anderen konnte seine Stimmung umschlagen.
Er war ein Großmaul, dieser Manteca. Er hatte eine Hakennase, ein spitzes, vorspringendes Kinn und eng zusammenstehende Augen. Ein Galgenstrick, dachte sie. Sie haßte ihn so innig wie den Bürgermeister, und sie wünschte es ihnen, daß irgend jemand ihnen früher oder später das schmutzige Handwerk legte.
Während sie sich ankleidete und für den Tag zurechtmachte, wanderten ihre Gedanken wieder zu der Hacienda in Andalusien ab. Mit der Erfüllung dieses Traumes würde es noch einige Zeit dauern, das wußte sie selbst. Daß aber ihre frommen Wünsche, die den Señor Bürgermeister Diego de Xamete und den Sargento Zeno Manteca betrafen, schon bald Wirklichkeit werden sollten, konnte sie beim besten Willen nicht ahnen.
Am Mittag dieses Tages herrschte etliche Meilen von Arica entfernt in einer Felsenbucht bei Tacna einiger Betrieb. Zwei Schiffe lagen vor Anker, eine Dreimastkaravelle namens „Estrella de Málaga“ und eine Dreimastgaleone namens „San Lorenzo“. Jollen bewegten sich zwischen dem Ufer und den Schiffen hin und her. Der letzte „Aufräumtrupp“, den Ben Brighton und Jan Ranse, die Kommandanten der Segler, in das Tal von Tacna hinauf geschickt hatten, kehrte an Bord zurück. Unter den Männern befand sich auch Roger Lutz, der von seinen Kameraden am Ufer und an Bord mit grinsenden Gesichtern empfangen wurde.
Dicker Qualm stieg vom Ufer auf. Mac Pellew und die Zwillinge hatten die Idee, eine Räucherei für die reichlich aus dem Wasser der Bucht gefischten Anchovetas zu bauen, in die Tat umgesetzt. Fast unablässig nahmen sie die Fische aus und hängten sie in den aus Steinen errichteten Räucherofen, der nach anfänglichen Schwierigkeiten und einigen Experimenten hervorragend zog.
Mac Pellew heizte die Glut an. Albert, der vermeintliche Bucklige von Quimper, leistete ihnen Gesellschaft und verdrückte still und friedlich „Kostproben“ – den vierten Anchoveta an diesem Mittag. Als er jedoch Roger Lutz entdeckte, der gerade an ihnen vorbei auf eine der Jollen zuschritt, ließ er die gerade abgeknabberte Gräte sinken und setzte sein breitestes Grinsen auf.
„Na, wen haben wir denn da?“ rief er. „Der verlorene Sohn kehrt zurück! Wir dachten schon, du musterst ganz ab, mein Freund!“
Roger blieb stehen und blickte ihn an. „Spar dir deine dämlichen Kommentare. Ein Mann wie ich mustert nie ab.“
„Hast du denn schön aufgeklart bei den Padres da oben?“ fragte Albert und kicherte.
„Das weißt du doch“, entgegnete Roger. „Es ist nicht eine einzige Spur mehr von den Zerstörungen zu sehen. Ferris hat ja sogar das zerschlagene Kruzifix repariert.“
„Klar“, sagte Philip junior. „Er hat es in pingeliger Kleinarbeit restauriert, das hat er uns erzählt.“
„Und er hat auch berichtet, wie sehr Roger geschuftet hat“, sagte sein Bruder mit strahlendem Lächeln.
„Ach, das ist nicht der Rede wert“, sagte der Franzose. Fast wurde er verlegen.
Albert konnte seinen Mund nicht halten. „Na ja, er ist für die Plackerei ja auch reichlich entlohnt worden, nicht wahr? In Naturalien! Oder wie?“
Roger trat auf ihn zu. „Jetzt ist aber Schluß, du Giftmorchel! Halt die Klappe, oder ich steck’ dich mit dem Hintern in den Ofen!“
Albert wich zurück. „Aber, aber! Kannst du keinen Spaß mehr verstehen?“
„Nicht in dem Punkt.“
„Hört auf“, sagte Mac Pellew. Er hustete, weil er etwas Rauch eingeatmet hatte. „Ihr seid doch schließlich Landsleute.“
„Landsmann oder nicht“, sagte Roger. „Wer noch eine dumme Bemerkung über meine Privatangelegenheiten von sich gibt, kriegt was an die Ohren.“ Damit wandte er sich ab und ging zu der Jolle, wo die anderen bereits auf ihn warteten.
Es hatte sich herumgesprochen, daß Roger Lutz im Tacna-Tal zarte Bande zu einer jungen Indiofrau geknüpft hatte, die Witwe war. Ihr Mann war nachweislich in den Minen von Potosi umgekommen. Roger hatte tatsächlich hart im Klostergelände geschuftet, und aus diesem Grund hatte Pater Franciscus beide Augen zugedrückt, als er bemerkte, was sich da tat.
Roger hatte die ganze Zeit über – während die Trupps sich ablösten – oben im Tal bleiben dürfen. Es war eine schöne Zeit für ihn gewesen, er würde sie nicht vergessen. Anacoana – so hieß die junge Witwe – war eine hübsche, zärtliche und kluge Frau. Sie konnte gut Spanisch, und er hatte sich ausgezeichnet mit ihr verständigen können, in allen Bereichen.
Die Jollen brachten die Männer an Bord der „Estrella de Málaga“. Auch die, die sich noch auf der „San Lorenzo“ befanden, setzten zu der Karavelle über. Ben Brighton hatte eine Besprechung anberaumt. Sie enterten an der Jakobsleiter auf und versammelten sich auf der Kuhl.
Roger hieb seinem Freund Grand Couteau, den er jetzt wiedertraf, kräftig auf die Schulter. Wie Roger hatte auch Grand Couteau zu dem ersten Trupp gehört, der sich in das Tal hinaufbegeben hatte, doch er war dann, bei der ersten Ablösung, zur Ankerbucht zurückgekehrt.
„Wie ist es dir denn so ergangen?“ fragte Grand Couteau, als sie sich zum Backbordniedergang zurückzogen, der die Kuhl mit der Back verband. „Man hört ja die tollsten Geschichten von dir.“
„Das ist eine Frau“, schwärmte Roger. „Von der könnte sich so manche Französin eine Scheibe abschneiden.“
„Na, nun übertreibe mal nicht.“
„Es ist die reine Wahrheit.“
„Gut für dich“, brummte Grand Couteau. „Aber alles hat ja mal ein Ende, leider. Es geht nach Arica, wir wollen den Dons ein bißchen ans Leder.“
„Das trifft sich gut“, sagte Roger, und plötzlich war er sehr ernst. Er nestelte etwas aus seinem Wams hervor, ein zusammengefaltetes Stück Pergament. Er öffnete es und zeigte dem erstaunten Grand Couteau die Zeichnung eines häßlichen Spaniers, der einen Helm trug.
„Hölle und Teufel!“ entfuhr es Grand Couteau. „Wer ist denn das? Und wer hat das gemalt?“
„Anacoana.“
„Deine Indio-Frau?“
„Ja. Dieser Kerl hier, ein spanischer Sargento, hat vor zwei Jahren ihren Mann aus dem Tal von Tacna verschleppt. Damals hat sie sich das Gesicht des Hundes sehr genau eingeprägt, unauslöschlich, verstehst du?“
„Ja. Es will mir aber nicht in den Kopf, wie man aus dem Gedächtnis so ein Gesicht zeichnen kann.“
„Sie hat eben ein Talent in dieser Richtung“, sagte Roger. „Ich habe auch Pater Franciscus nach diesem Kerl befragt, und er hat mir bestätigt, daß es sich um einen Sargento gehandelt hat. Aus Arica.“
Grand Couteau stieß einen leisen Pfiff aus. „Das wird ja immer interessanter. Nun sieh dir diesen Hurensohn an. Ein übler Typ, nicht wahr?“
„Ja. Damals tauchte er mit einem Trupp von acht Soldaten auf und requirierte zehn Indios für die Minen von Potosi.“
„Diese Schweine“, sagte Grand Couteau. „Man sollte sie alle rauswerfen aus diesem Land.“
„Unter den Requirierten befand sich auch Anacoanas Mann“, fuhr Roger fort. „Der Sargento schlug ihn vor Anacoanas Augen zusammen.“
„Hoffentlich finden wir den in Arica wieder. Das gäbe ein feines Fest.“ Grand Couteau blickte den Freund mit grimmiger Miene an. „Ich schätze, da melden wir uns als erste freiwillig, was?“
Roger entgegnete: „Pater Franciscus hat mir alle Einzelheiten dieses Gesichts bestätigt. Die Zeichnung sei haargenau, hat er gesagt. Schau dir die Hakennase an.“
„Ich werde sie ihm breitschlagen“, sagte Grand Couteau. Er war ein kleiner Mann, aber schnell und wendig. Und er war ein Meister im Umgang mit dem Messer, daher sein Name, der seinen Kameraden als der einzig richtige geläufig war.
„Das spitze Kinn und die eng zusammenstehenden Augen“, sagte Roger. „Das sind Details, die man sich leicht merkt und an denen man ihn erkennt.“
Jan Ranse trat zu ihnen. „He, ihr beiden! Was habt ihr zu bereden? Ist das ein Geheimnis?“
„Eigentlich nicht“, erwiderte Roger und zeigte ihm die Zeichnung. Dann berichtete er, was er gerade seinem Freund erzählt hatte.
Jan Ranse hörte sich alles schweigend an. Er konnte Roger Lutz gut leiden und verstand, was ihn bewegte. Überhaupt, Roger war ein feiner Kerl und guter Kamerad, mit dem man durch dick und dünn ging und der für jeden seinen Kopf gegeben hätte.
Deshalb hatten die Männer der „San Lorenzo“ – auch Jan – ebenfalls beide Augen zugedrückt, was das Liebesabenteuer ihres Franzosen betraf, sehr wohlwollend sogar, denn jeder konnte bestätigen, daß Roger wirklich wie ein Kesselflicker im Tal gearbeitet hatte.
Und ein bißchen hatten sie auch an sein mißlungenes Liebesabenteuer mit der Dame Juana gedacht, bei dem beide im Wasser gelandet waren, als man auf dem Weg nach Arica der Galeone der Komödianten begegnet war. Anschließend hatten die Mannen ihren armen Roger verdroschen.
Nicht, daß sie deswegen so etwas wie Reue empfanden, aber Roger Lutz war eben Roger Lutz. Ein prächtiger Kerl, ein richtiger Draufgänger, und die Frauen flogen ihm zu. Man durfte das alles eben nicht so eng sehen, wie Jan zu sagen pflegte.
Ben Brighton hatte auch nur still gelächelt, als ihm gemeldet worden war, Roger hätte oben, im Tal, noch zu tun und brauche nicht abgelöst zu werden. Jetzt aber war es unvermeidlich gewesen: Die Arbeit war getan, und alle waren an Bord zurückbeordert worden.
Ben trat an die Schmuckbalustrade des Achterdecks der „Estrella“ und sagte: „Männer, ich möchte mich jetzt dem Problem Arica zuwenden. Wir hatten bereits darüber gesprochen, daß es nur richtig sei, die Dons mit einem Besuch zu beehren. Wir können auf diese Weise einen guten Treffer landen und Hasard und dem Potosi-Trupp den Rücken freihalten, falls die Dons in Arica jemals auf die Idee verfallen sollten, nach Potosi zu marschieren, beispielsweise mit einem Trupp Sklaven und Soldaten.“
„Oder falls sie aus Potosi alarmiert werden, wenn dort etwas schiefläuft“, sagte Big Old Shane. „Das sollten wir auch nicht vergessen.“
„Ich melde mich freiwillig für das Unternehmen Arica!“ rief Roger Lutz.
„Ich auch!“ fügte Grand Couteau mit lauter Stimme hinzu.
Ben hob beide Hände. „Langsam, langsam. Als erstes sollten wir besprechen, wie wir die Stadt und den Hafen am besten in Angriff nehmen.“
„Ja“, sagte Jan Ranse, dann, etwas leiser und zu Roger gewandt: „Dir spukt wohl nur noch der miese Sargento im Kopf herum, was?“
„Genau das. Und weißt du auch warum?“
„Weil er Anacoanas Mann geschlagen und verschleppt hat.“
„Und warum hat er ihn deiner Meinung nach geschlagen?“ fragte Roger. „Warum ging der arme Teufel auf diesen Hund los?“ Seine Augen wurden etwas schmaler. „Ich will es dir verraten. Pater Franciscus hat es mir berichtet, ein wenig verklausuliert zwar, aber doch deutlich genug. Anacoanas Mann hat den Sargento angesprungen, weil der im Begriff gewesen war, ihr Gewalt anzutun.“
„So ein Schwein“, sagte Grand Couteau.
„Für mich gibt es kein größeres Verbrechen“, sagte Roger. „Kerle, die mit Gewalt Liebe erzwingen wollen, sind für mich der letzte Dreck. Er wird das noch schwer bereuen, der Señor Sargento, wenn ich ihn erwischen sollte.“
2.
Ben Brighton begann, das Vorhaben gegen Arica eingehender mit seinen Männern zu erörtern. Daß sich genügend Freiwillige finden würden, stand außer Zweifel. Wäre es nach den Crews beider Schiffe gegangen, dann wären sie alle nach Arica aufgebrochen. Das aber war praktisch und auch vom strategischen Standpunkt her völlig unmöglich. Ben wußte genau, daß er den Trupp, der bis zu dem Hafen der Spanier vorstoßen würde, möglichst klein halten mußte, damit dieser auf keinen Fall Aufsehen erregte, ehe er die wichtigsten Details erkundet hatte.
Zur Zeit betrug die zahlenmäßige Stärke der beiden Schiffsmannschaften neununddreißig Mann. Hinzu kam Araua als das einzige weibliche Wesen an Bord der „Estrella de Málaga“ – und außerdem das „Viehzeug“, wie Carberry zu sagen pflegte: Plymmie, Arwenack, Sir John und die Legehennen im Verschlag der Back der „Estrella“.
Der Potosi-Trupp, der Ende November seinen langen Marsch begonnen hatte, bestand aus Hasard, Dan O’Flynn, Ed Carberry, Matt Davies, Gary Andrews, Stenmark, Pater David, Jean Ribault, Karl von Hutten, Fred Finley und Mel Ferrow. Außerdem begleitete den Trupp ein gewisser Pater Aloysius, der aus einem fernen, unbekannten Land namens Tirol stammte und als Bergführer offenbar hervorragend geeignet war.
Ein Dutzend Männer, die auch für das Arica-Unternehmen sehr gut geeignet gewesen wären, fiel also aus, und Ben hatte sich sehr genau zu überlegen, wen er losschickte.
„Hol’s der Henker“, sagte Mac Pellew, der als letzter an Bord der Karavelle aufenterte. „Nach Arica geht’s also? Wann denn? Heute nacht? Schießen wir dort alles in Schutt und Asche?“
„Du redest mal wieder totalen Unsinn“, sagte Smoky. „Und du kriegst immer alles in den falschen Hals.“
„Da geht es wieder los“, sagte Mac mit todtraurigem Gesicht. „Auf mir könnt ihr ja rumhacken, nicht?“
„Wir segeln nicht nach Arica“, sagte Smoky. „Wir gehen zu Fuß hin. Das ist ja wohl klar.“
„Klar ist das gar nicht“, sagte Mac beleidigt.
„Trübe ist es in deinem Kopf, Mac“, sagte Batuti grinsend. „So trübe wie in deiner Suppe.“
„Bitte sehr“, erklärte der Kutscher. „Für die Suppen bin ich verantwortlich.“
„Na, schon gut“, sagte Smoky. „Aber halte dir eins vor Augen, Mac. Wir wollen in Arica nicht als Verrückte wüten und uns sämtliche Kriegsschiffe an den Hals holen, ehe Hasard und seine Gruppe wieder zurück sind. Wir wollen heimlich vorgehen. Und wenn was passiert, dann sollen die Dons anschließend rätseln, wer ihnen das angetan hat.“
„Fein“, sagte Mac mit dem Versuch eines Grinsens, das selbst Plymmie zum Heulen gebracht hätte. „Nun weiß ich Bescheid. Wie nett, daß ihr mich immer auf dem laufenden haltet.“
„Du riechst so rauchig“, sagte Batuti. „Und du hast einen Anchoveta im Hemd, Mac.“
„Was? Einen was habe ich? Wo?“
„Im Hemd“, sagte nun auch Smoky. „Da, es stimmt wirklich. Du meine Güte, Mac.“
Mac blickte an sich hinunter. Tatsächlich – aus seinem Hemdausschnitt glotzte ein noch nicht geräucherter Fisch hervor. Ziemlich verlegen stopfte Mac ihn sich ganz ins Hemd, so daß er nicht mehr zu sehen war.
„So was“, brummelte er. „Wie konnte denn das passieren?“ Dann verschwand er in der Kombüse. Er hatte vorerst wieder mal die Nase voll. Das Schott knallte hinter ihm zu.
„Was ist da vorn los?“ fragte Ben. „Hört ihr alle her? Ich bitte mir Ruhe aus!“
„Aye, Sir“, sagte Philip junior. „Aber Mac Pellew fehlt noch, er ist eben mal in die Kombüse gegangen und lädt Anchovetas ab.“
„Er soll dabeisein“, sagte Ben, „wie ihr alle, außerdem habe ich keine Lust, alles zweimal zu sagen.“
Batuti hieb grinsend mit der Faust gegen das Kombüsenschott. „Mac, komm raus, Mann!“
Mac öffnete das Schott mit einem Fluch. „Was ist jetzt wieder los? Man hat mir vorgeworfen, daß ich stinke.“
„Nach Rauch und nach Fisch“, sagte Bill vergnügt.
„Das lasse ich mir nicht nachsagen!“ stieß Mac erbost aus.
„Hör auf“, sagte Ben. „Waschen kannst du dich nachher immer noch. Jetzt hör erst mal her.“
„Aye, Sir!“
„Folgendes“, sagte Ben. „Wir müssen als erstes Arica genau erkunden und feststellen, wo wir die Dons am empfindlichsten treffen können.“
„Doch wohl an ihren Pulverlagern“, sagte Shane mit grollendem Baß. „Wenn die in die Luft fliegen, gibt’s ein hübsches Feuerwerk. Eigentlich sollten wir damit bis zum Jahreswechsel warten, aber so lange Zeit haben wir wohl nicht, schätze ich.“
„Die Munitionsdepots sind das Ziel Nummer eins“, sagte Ben.
„Und die Vorratslager am Hafen?“ fragte Ferris Tucker.
„Die natürlich auch. Weiter: Wir müssen in Erfahrung bringen, welche Schiffe im Hafen liegen, wie sie bewacht sind und welche Stärke die Hafenbatterien haben.“ Ben hielt kurz inne, dann fuhr er fort: „Kurzum, alles, was für uns wichtig ist, muß ausgekundschaftet werden. Dazu sollte ein Trupp nach Arica einsickern, der sich damit befaßt.“
„Sehr gut“, sagte Jan Ranse, der jetzt am Großmast stand. „Und unser Trupp soll sich dann still und friedlich wieder zurückziehen, wie ich annehme?“
Ben grinste. „Wenn die Situation es erfordert, ja. Ich stelle mir da Gefahren wie das Anrücken einer Stadtgarde oder verschärfte Kontrollen vor.“
„Völlig klar“, sagte Smoky. „Wir dürfen kein übermäßiges Risiko eingehen.“
„Aber nehmen wir mal an, die Situation erfordert ganz was anderes“, sagte Le Testu. „Beispielsweise sofortige Aktion. Was dann?“
„Der Trupp wird eigenständig handeln“, erwiderte Ben. „Er hat freie Hand. Er wird aus Männern bestehen, die sich schnell auf jede Lage einzustellen verstehen und Entscheidungen von einem Moment auf den anderen treffen können.“
„He, Gordon“, sagte Albert zu Gordon McLinn. „Du wirst, glaube ich, nicht nach Arica gehen.“
McLinns Schläfenadern schwollen an. „Wie meinst du das? He, was soll das heißen?“
„Beruhige dich“, entgegnete Roger Lutz gelassen. „Es bedeutet, daß Albert noch vor dem Dunkelwerden im Räucherofen landet, wenn er seine freche Klappe nicht halten kann.“
„Sollte es sich ergeben, dann ist gegen eine Sabotageaktion nichts einzuwenden“, sagte Ben. „Aber nur, wenn die absolute Sicherheit des Trupps gewahrt bleibt und für Anonymität und Tarnung gesorgt ist.“
„Dafür wird gesorgt!“ rief Smoky. „Wann marschieren wir los?“
„Der Trupp wird eine Jolle benutzen“, sagte Ben.
„Ha!“ stieß Mac Pellew hervor. „Da hast du’s! Du kriegst auch immer alles in den falschen Hals, Mister Smoky!“ Er wollte lachen, aber es klang eher wie ein Jaulen.
„Na gut“, sagte Smoky. „Also auf nach Arica per Jolle!“
„Noch ein Wort zu der möglichen Sabotageaktion“, sagte Ben. „Unser Ziel sollte es dabei sein, den Spaniern jede Möglichkeit zu nehmen, mittels ihrer Feuerwaffen aktiv zu werden.“
„Feuerwaffen“, sagte der Kutscher nachdenklich. „Das impliziert Kanonen, Gewehre und Pistolen.“
„Was hast du gesagt?“ fragte Paddy Rogers. „Was für ein Wort war das?“
„Implizieren bedeutet soviel wie einschließen.“
„Wer soll eingeschlossen werden?“ fragte Paddy mit verdutzter Miene. „Die Dons? In Arica?“
„Du wirst auch nicht mit nach Arica segeln“, murmelte Albert, doch er enthielt sich eines lauten Kommentars, weil Roger Lutz bereits wieder zu ihm blickte.
„Also“, sagte Ferris. „Wo kein Pulver ist, kann kein Blei und Eisen fliegen. Ist das richtig?“
„Ich bewundere deinen Scharfsinn“, sagte Ben.
„Alles klar“, sagte Al Conroy. „Ein tüchtiges Stück Arbeit wäre es, den Dons das ganze Pulver unter dem Hintern in die Luft zu jagen. Oh, das würde ich mir schon zutrauen.“
„Wer führt nun den verdammten Erkundungstrupp?“ fragte Luke Morgan ungeduldig. „Und wer gehört ihm an? Ich melde mich natürlich auch freiwillig.“
Ben zwinkerte plötzlich den Männern der „San Lorenzo“ zu.
„Wäre das nicht mal eine Sache für euch?“ fragte er.
„Das wäre nicht schlecht“, erwiderte Jan Ranse. „Ich hätte nichts dagegen einzuwenden.“
„Wir auch nicht!“ rief Roger Lutz und Grand Couteau wie aus einem Mund.
„Aber als Experten sollten Ferris Tucker und Al Conroy mit dabeisein“, fügte Ben noch hinzu.
„Recht so!“ rief Piet Straaten. „Los, auf geht’s, wie besorgen es den Dons! Das haben sie schon lange verdient! Und vielleicht halten sie in Arica Indios gefangen, die befreit werden müssen!“
„Wir können gleich aufbrechen!“ schrie Donald Swift.
„Augenblick mal“, sagte Shane zu Ben. „Ist das dein Ernst?“
„Ja.“
„Und wir sollen hierbleiben und Daumen drehen?“
„Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich zu betätigen“, entgegnete Ben lachend. „Beispielsweise könnten wir die ‚Estrella‘ aufklaren.“
Shanes Miene war verkniffen. „Was gibt es denn hier noch aufzuklaren? Der Kahn blitzt vor Sauberkeit, das Rigg ist in Ordnung. Wir werden uns höllisch langweilen, das schwöre ich dir.“ Er war wirklich enttäuscht und verbarg es nicht. Inständig hatte er gehofft, mit Ferris Tucker und einigen anderen nach Arica aufbrechen zu können – eine Abwechslung in der Monotonie des langen Wartens auf Hasards Trupp.
Aber Ben Brighton ließ sich nicht beeinflussen. Er war der Kommandant an Bord der „Estrella“, alle hörten auf seinen Befehl. Was Arica betraf, so hatte er seine Entscheidung bereits getroffen, und er wich nicht mehr davon ab – aus einigen plausiblen Gründen.
Es sollten und durften nicht immer die Männer des Seewolfs sein, die „bestimmte Arbeiten“ verrichteten. Man sollte auch den „Vengeurs“, wie Jean Ribaults Männer von den Arwenacks genannt wurden, ruhig einmal den Vortritt lassen. Von dieser Voraussetzung ging Ben jetzt aus. Er sprach es natürlich nicht offen aus, zeigte sich aber als geschickter und diplomatisch begabter Schiffsführer, der von seinem Kapitän Hasard eine Menge gelernt hatte.
Jetzt waren eben mal die Vengeurs an der Reihe. Außerdem brauchten sie auch eine Motivation, denn sie waren in der letzten Zeit ein wenig verunsichert worden.
Da war die Sache mit ihrem Koch Eric Winlow gewesen, die ihnen immer noch in den Knochen steckte. Für Winlows Schlamperei waren sie von den Arwenacks, vor allem von Carberry, ziemlich verhöhnt worden.
Und auch die Geschichte mit Roger Lutz und der Galeone der Komödianten war alles andere als eine ruhmreiche Begebenheit gewesen. Irgendwie brauchte die Crew eine Selbstbestätigung, und Ben wollte ihnen eine entsprechende Chance dafür geben.
Ferris Tucker nahm Shane auf dem Achterdeck beiseite.
„Hör mal“, sagte er halblaut. „Reg dich nicht auf, wir werden das Kind auch ohne dich schaukeln.“
„Das glaube ich dir gern“, erwiderte der graubärtige Riese. „Und was tue ich? Ich stehe mir hier inzwischen die Beine in den Bauch.“
„Stehen solltest du schon, aber über den Dingen.“
„Findest du? Du hast gut reden. Du bist ja mit dabei.“
„Das spielt keine so große Rolle“, sagte Ferris. „Aber denk auch mal an die Sache mit Carrero.“
„Ja?“
„Den haben wir gestellt, und Montbars hätte sich am liebsten in den Hintern gebissen, als er ihn mit der Jolle entwischen ließ.“
„Ist schon gut“, sagte Shane. „Und ich bin ja auch kein Narr. Die Burschen sollen ruhig mal wieder unter Beweis stellen, was in ihnen steckt, es kann nicht schaden.“