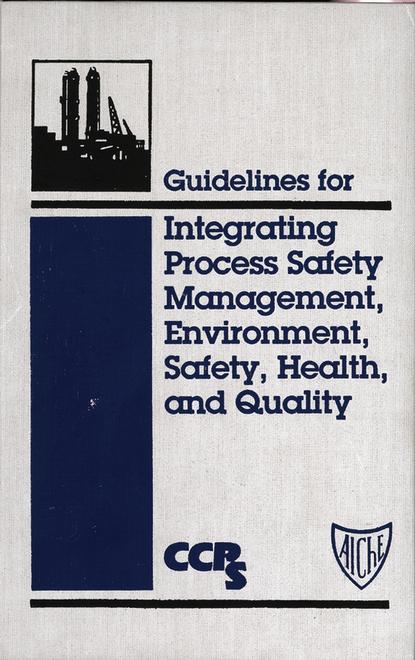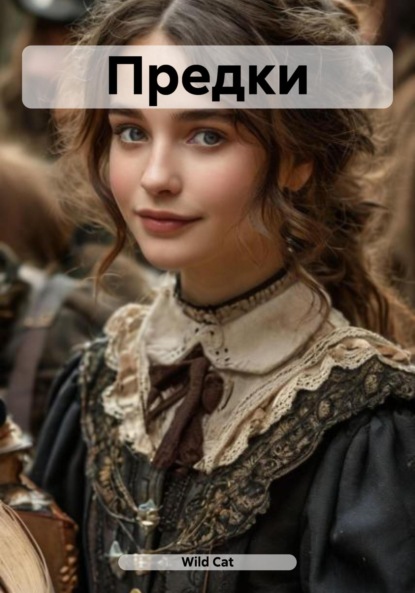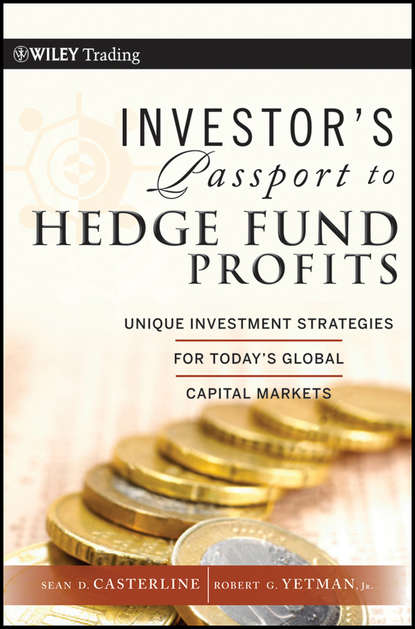Seewölfe Paket 23

- -
- 100%
- +
„Ich finde, die lieben Tierchen sind noch besser als Heringe“, sagte Shane, nachdem er die letzten Gräten seiner Ration abgelutscht hatte. „Wie viele davon können wir mitnehmen, Ben?“
„Ich würde gern die Proviantkammer füllen“, erwiderte Ben. „Aber frischer Fisch wird natürlich schnell schlecht.“
„Wir können ihn einsalzen.“
„Oder einlegen“, sagte Ben. „Besser noch wäre es, ihn zu räuchern. Wir sollten an Land eine Räucherei einrichten.“
„Meinst du das im Ernst?“
„Ja. Auch das wäre eine willkommene Abwechslung.“
„Im Trott des Wartens, ja“, brummte der graubärtige Riese. „Keine schlechte Idee.“
Sie aßen weiter, tranken dazu Wein und Brandy und legten die Details zurecht: wo die Räucherei gebaut werden sollte, welches Material man sich besorgen würde und wer als „Räuchermeister“ in Aktion treten sollte. Mac Pellew wäre der richtige Mann gewesen, aber da der Kutscher nicht an Bord war, war er eigentlich in der Kombüse unentbehrlich.
„Wie wär’s mit Blacky?“ fragte Shane.
„Der läßt die Fische verräuchern“, sagte Ben.
Araua, die sich inzwischen zu ihnen gesellt hatte, lachte. „Das ist ja wirklich ein Problem. Ich melde mich freiwillig. Ich kann Fische backen, braten und räuchern.“
„Aber du verräucherst dir dein schönes Haar“, sagte Ben. „Nein, das ist nichts für dich.“
„Baxter ist der richtige Mann“, sagte Shane. „Der hat keine Haare und kann sich nichts versengen oder verräuchern.“
Sie lachten zusammen. Die Stimmung war prächtig und hätte besser nicht sein können. An und für sich hatten sie nicht gedacht, daß der erste Tag nach der „Abreise“ des Potosi-Trupps so gut verlaufen würde. Die Stunden verstrichen recht schnell, allmählich wurde es dunkel. Was aber die Nacht für sie bereithielt, ahnte keiner von ihnen.
Luis Carrero hockte wieder in seinem Verlies. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und atmete erst einmal tief durch. Dann tastete er mit den Fingern nach dem Belegnagel, der hinten unter seinem Hemd steckte, und grinste. Soweit hatte er es geschafft. Jetzt folgte der zweite Teil des Unternehmens.
Irgendwie mußte es ihm gelingen, sich der Handfesseln zu entledigen. Daß er keine Ketten mehr trug, war bereits ein erheblicher Vorteil. Sie hatten ihn derart behindert, daß er nicht einmal durch die Vorpiek hatte kriechen können. Jetzt änderte sich einiges an seiner Lage – und sein Trübsinn und seine Niedergeschlagenheit waren wie weggewischt.
Die Hoffnung auf Flucht war wieder da. Es gab eine Rettung – und er würde nicht sterben, wie diese Bastarde ihm prophezeit hatten. Nein, er würde nicht an der Rah baumeln, und sie würden seinen leblosen Leib auch nicht wild lachend in die See werfen.
All die Schreckensvisionen von seinem eigenen Ende, die ihm die Angst und die Verzweiflung in Alpträumen und Trugbildern vorgegaukelt hatten, verblaßten. Er schöpfte wieder Mut und Selbstvertrauen.
Nicht sie würden triumphieren – diese elenden Bastarde –, sondern er würde der stolze Sieger sein, stolz wie ehemals, als er mit seinen Bluthunden durch Potosi zog und jedermann Furcht einflößte und Respekt abverlangte.
Er, Luis Carrero, allein gegen diese Horde von Schlagetots und Galgenstricken! Ja, er traute sich das zu. Der schwarzhaarige Hurensohn Killigrew war nicht an Bord, der Profos und ungefähr ein Dutzend der Bande schienen allein auf der „Estrella de Málaga“ zu fehlen.
Drüben, auf der „San Lorenzo“, war die Crew ebenfalls nicht mehr vollständig, soviel hatte Carrero bei seinem kurzen Decksaufenthalt erkennen können. Zum Beispiel hatte er diesen dreisten Franzosen nicht gesehen, der sich Ribault nannte.
Für das Fehlen dieser Kerle gab es nur eine Erklärung. Sie hatten sich auf den Marsch nach Potosi begeben. Warum sie ihren Gefangenen nicht mitgenommen hatten, wie es geplant gewesen war? Carrero machte sich keine Gedanken mehr darüber. Es war ihm gleichgültig. Er würde dieses Teufelsschiff verlassen, nach Potosi zurückkehren – dabei vielleicht einen Umweg über Arica einlegen – und Alarm schlagen.
Dann würde er mit de Cubillos Hilfe eine Streitmacht auf die Beine stellen und die Engländer jagen – quer durch das Gebirge und bis an die See, und wenn es sein mußte, über das Meer bis nach Panama hinauf.
Er würde sie fassen und sich an ihnen rächen. Ihr Ende waren die Minen des Cerro Rico, dort würden sie mit den Indios zusammen schuften. Dort hatte Carrero noch jeden aufsässigen Hundesohn weichgeklopft. Es gab keinen, der standgehalten hatte.
Alle diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als er nun das tat, was ihm vorher wegen der Ketten versagt gewesen war. Er ließ sich auf den Knien nieder, schob sich durch die Vorpiek und begann, sie Stück für Stück zu untersuchen, so gut es ging. Natürlich waren die Voraussetzungen immer noch ungünstig, aber er gab sich alle Mühe, das Beste daraus zu machen.
Es war stockdunkel, und er konnte nur herumtasten. Zweimal stieß er sich den Kopf, und es gab dabei dumpfe Geräusche. Er verharrte und lauschte. Hatte der Posten, der vor dem Schott stand, etwas gehört? Ahnte er etwas? Nein. Nichts rührte sich. Der Mann schien keinen Verdacht zu schöpfen. Warum sollte er es auch tun?
Er wußte ja nicht, daß Carrero einen Koffeynagel an sich gebracht hatte. Und wenn der Spanier durch sein Gefängnis kroch, war das im Grunde nur allzu verständlich. Wer schon einmal in der Vorpiek gesessen hatte, wußte, wie eng und stickig es dort war.
Carrero setzte sein Werk fort. Seine Füße waren nicht gefesselt, er konnte die Beine also gut bewegen. Aber das nutzte ihm im Grunde nicht viel. Für die Inspektion brauchte er seine Finger – und da ihm die Hände auf den Rücken gebunden waren, war es eine schweißtreibende Arbeit, alles abzutasten.
Schließlich fand er, was er suchte: einen Nagel in einem Spant. Der Nagel befand sich sogar in Hüfthöhe. Besser hätte es gar nicht sein können. Carrero grinste triumphierend. Am liebsten hätte er einen Schrei ausgestoßen.
Egal, aus welchen Gründen die einstige Besatzung der „Estrella de Málaga“ diesen Nagel in den Spant getrieben hatte. Vielleicht war einmal irgend etwas daran befestigt gewesen. Was kümmerte es ihn, Carrero? Der Nagel diente ihm nur zu dem einen Zweck – die Handfesseln aufzuscheuern. Alles andere interessierte ihn nicht.
Er grinste immer noch. Er ließ sich wieder nieder und lehnte sich gegen die Schiffswand. Das Öffnen der Fesseln verlegte er aus Sicherheitsgründen auf die Nacht. Es war jetzt Abend geworden. Die Kerle würden ihm seine Mahlzeit bringen, und die mußte er zu sich nehmen, ohne daß sie etwas von dem, was er plante, ahnten. Mit anderen Worten: Er mußte sie in Sicherheit wiegen. Sie sollten nach wie vor davon überzeugt sein, daß er ein erschöpfter, erledigter Mann sei. Es paßte hervorragend zu seinem einfachen, aber – wenn alles klappte, wie er sich das vorstellte – genialen Plan.
Hunde, dachte er, ihr werdet euch noch wundern! Eine Welle der Genugtuung und des Siegesgefühls durchlief ihn. Er mußte handeln, solange die Stärke der Mannschaften reduziert war. Hier lag seine Chance, und die würde er ausnutzen.
4.
Bevor das Schott der Vorpiek geöffnet wurde, sorgte Luis Carrero dafür, den Belegnagel zu verstecken. Es gelang ihm, die Gräting ein wenig zu lockern und ihn darunterzuschieben. Jetzt mußte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie ihn entdeckten.
Schritte näherten sich.
„Batuti, mach mal auf“, sagte eine Stimme. Sie gehörte diesem anderen Hakenmann, der offenbar auf den Namen Bowie hörte. „Ich habe gebratenen Fisch und Wasser für unseren Don Luis.“
„Na, dann los“, brummte der Gambia-Mann. Eigentlich hätte er lieber mit Shane Pulver- und Brandpfeile angefertigt, als hier Posten zu gehen. Aber er fügte sich in sein Schicksal.
Batuti schob den Riegel des Schotts zur Seite und öffnete. Jeff Bowie setzte den Essensnapf und den Wasserkrug auf den Planken ab und hängte die Öllampe, die er mitgebracht hatte, an einen Haken an einem der Deckenbalken. Die Lampe schwankte ein bißchen hin und her und verbreitete rötlich-dämmriges Licht.
Jeff bückte sich und trat zu dem Gefangenen, Batuti zog seine Pistole und spannte den Hahn. Es knackte, aber Carrero wandte nicht den Kopf. Er schien ins Leere zu blicken, völlig apathisch und entrückt.
„Carrero“, sagte Jeff. „Ich nehme dir jetzt die Fesseln ab, damit du essen kannst.“
„Ja“, sagte Carrero. „Ja.“
„Sei hübsch brav und versuche keine Dummheiten.“
„Keine Dummheiten.“
Jeff löste die Handfesseln, kehrte zu Batuti zurück und schob dem Spanier den Essensnapf und den Wasserkrug zu. Er stellte sich neben den Gambia-Mann, und sie unterhielten sich leise miteinander.
Carrero griff mit seltsam eckigen, beinah linkisch wirkenden Bewegungen nach dem Fisch und aß ein wenig davon. Dann trank er Wasser in großen, gierigen Schlucken.
Jeff wartete noch eine Weile, aber Carrero ließ die Hälfte der Anchovetas unberührt im Napf liegen. Jeff zuckte mit den Schultern, legte dem Mann die Fesseln wieder an und trug das Geschirr aus der Vorpiek. Er übergab es Batuti, nachdem dieser das Schott geschlossen und zugeriegelt hatte, und der Gambia-Mann schob grinsend damit, ab.
„Danke für die Ablösung“, sagte er.
„Gern geschehen“, sagte Jeff und lehnte sich gegen die Wand. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Bis Mitternacht war er mit der Wache an der Reihe, dann löste ihn Luke Morgan ab. Bis dahin hieß es, sich in Geduld zu fassen – es gab keinen langweiligeren Posten als diesen. Da hatten es sogar die Männer besser, die drüben, auf der Felsnase, ihren Dienst versahen. Die hatten wenigstens die frische Luft und konnten dem leisen Rauschen des Wassers lauschen.
Carrero überlegte unterdessen, ob er richtig gehandelt hatte. Eigentlich hatte er einen Bärenhunger, und der Magen knurrte ihm immer noch. Aber er hatte absichtlich so getan, als habe er keinen Appetit. Er spielte den Leidenden, Entmutigten. Er hatte kaum noch die Kraft, die Hand an den Mund zu heben. Bei dieser Rolle mußte er bleiben.
Aber später, auf der Flucht, würde ihm der Hunger zusetzen. Wann erhielt er wieder etwas zu essen? Er wußte es nicht. Aber das mußte er auf sich nehmen. Wenn es ganz schlimm war, würde er Wurzeln essen. Oder Dreck. Lieber das, als noch weiter diesen Höllenhunden ausgeliefert zu sein.
Am Mittag, bei seinem Spaziergang auf das Hauptdeck, hatte er die Himmelsrichtung einigermaßen genau festgestellt. Er würde sich nach Süden absetzen, dorthin, wo Arica liegen mußte. Dies hatte er sich inzwischen in den Kopf gesetzt, denn es war besser, zunächst nach Arica zu laufen, als sich auf den langen Marsch nach Potosi zu begeben.
Im übrigen hatte er festgestellt, daß draußen – vor der Bucht – ein Fluß verlief. Fast war er sich sicher, daß es sich um den Rio Tacna handeln mußte. Folglich lag Arica südlich.
Dies war Luis Carreros Plan: Um Mitternacht, beim neuerlichen Wachwechsel, würden die beiden Posten, der abgelöste und der neue, seine Fesseln gemeinsam überprüfen. Danach hatte er wieder Ruhe bis vier Uhr morgens, wenn wiederum die gleiche Prozedur begann. Er hatte beschlossen, nach der Prüfung um Mitternacht die Fesseln zu lösen, den Posten in die Vorpiek zu locken, ihn niederzuschlagen und zu fliehen.
Er wollte sich mit der Jolle absetzen, die längsseits vertäut war. Das mußte zu schaffen sein. Bis zum Ufer war es nicht weit, und vielleicht waren die Ankerwachen der Schiffe nicht so scharf, weil sie mit keiner Bedrohung von außen zu rechnen hatten. Wenn er viel Glück hatte, schliefen sie sogar. Das wagte er nicht zu hoffen, aber er rechnete sich einige Chancen aus, das Ufer ungehindert zu erreichen.
Er entspannte sich und schloß die Augen. Bis Mitternacht mußte er Energien schöpfen – danach begann die Arbeit. Er atmete tief durch und versuchte zu schlafen. Es gelang ihm tatsächlich. Es war mehr ein Dahindämmern, jedes Geräusch riß ihn wieder hoch. Aber er ruhte sich doch aus. Allein darauf kam es ihm jetzt an.
Mitternacht nahte, und wieder ertönten Schritte, die vor dem Schott verharrten. Der neue Posten war da. Es war Luke Morgan. Er wechselte ein paar Worte mit Jeff, dann öffneten sie das Schott der Vorpiek und befaßten sich mit ihrem Gefangenen. Jeff hielt die Öllampe hoch, Luke überprüfte die Handfesseln des Mannes.
„Alles in Ordnung“, sagte Luke.
„Ich habe auch nichts anderes erwartet“, sagte Jeff. „Gibt es an der Küste was Neues?“
„Nichts.“
„Nicht die Spur?“
„Bist du so versessen darauf, daß was passiert?“ fragte Luke.
„Das bin ich nicht“, entgegnete Jeff. „Nur finde ich, daß es hier allzu ruhig ist.“
„Mal nicht den Teufel an die Wand. Wir können uns nicht beklagen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, schieben wir hier einen wirklich ruhigen Lenz, bis Hasard und der Trupp aus Potosi zurück sind.“
„Ich wäre lieber nach Potosi gegangen, wenn du mich fragst.“
„Das wären wir alle“, sagte Luke. „Aber darüber haben wir schon genug diskutiert.“
„Mann, ich will mich doch nur mit dir unterhalten.“
„Hau dich aufs Ohr“, sagte Luke grinsend. „Und denk an die Anchovetas. Morgen wird wieder geangelt – gefischt, meine ich.“
„Die Kinderarbeit können wir den Zwillingen überlassen“, brummte Jeff. „Mann, ich melde mich lieber bei Ferris und helfe ihm bei den Höllenflaschen.“
„Wie du willst. Ben hat sicher nichts dagegen.“
„Also dann – viel Spaß, Luke“, sagte Jeff.
„Ich werde die Zeit schon ’rumkriegen“, sagte Luke.
Das Schott der Vorpiek krachte zu, der Riegel wurde vorgeschoben. Luis Carrero grinste, aber am liebsten hätte er vor Freude geschrien. Ihr Narren, dachte er, ihr wißt ja nicht, was euch blüht.
Carrero begann sofort zu arbeiten. Lautlos bewegte er sich durch die Vorpiek, verharrte wieder, lauschte und setzte dann, als er sicher war, daß der Mann vorm Schott nichts bemerkte, seinen Weg fort. Er erreichte den Nagel, setzte sich hin und drehte sich so, daß er die gefesselten Hände an den Nagel bringen konnte.
Dann begann er, seine Hände reibend zu bewegen. Das Tauwerk glitt über den Nagel. Aber es war solide – und es dauerte einige Zeit, bis sich die ersten Fasern zu lösen begannen.
An der erforderlichen Geduld, Zähigkeit und Ausdauer mangelte es dem Spanier nicht. Lange genug hatte er tatenlos in dem engen, stickigen Verschlag brüten müssen. Und wenn er Stunden an den Fesseln herumsäbeln mußte, bis sie nachgaben – er würde nicht kapitulieren.
Etwa nach einer Viertelstunde hielt er für kurze Zeit inne und fing an, Schnarchgeräusche zu imitieren, nicht zu laut, aber für den vor dem Schott stehenden Luke Morgan deutlich zu vernehmen. Carrero nahm seine Tätigkeit wieder auf, schnarchte aber noch einige Zeit weiter. Das Tauwerk schabte über den Nagel, hin und her, und er hatte den Eindruck, daß es etwas rissig geworden war. Seine Haut wurde inzwischen auch in Mitleidenschaft gezogen. Er spürte, wie sie zu brennen und zu schmerzen begann.
Weiter, dachte er, nicht aufhören. Und wenn die Haut in Fetzen geht – weiter!
In unregelmäßigen Zeitabständen wiederholte er die Schnarchgeräusche. Nach ungefähr einer Stunde intensiver Arbeit hatte er die Hände endlich frei. Er ließ die Arme herunterbaumeln, lehnte sich gegen die Wand und atmete tief durch. Dann massierte er vorsichtig die Handgelenke. Sie taten immer noch weh. Er hatte sie blutig geschrammt, wie ihm schien – aber was bedeutete das schon?
Er wartete ab. Jetzt nicht zu hastig vorgehen, prägte er sich immer wieder ein, Geduld haben. Noch ein wenig Zeit verstreichen lassen.
Carrero schnarchte wieder ein bißchen und stieß auch hin und wieder einen Seufzer aus wie ein Mann, der von nicht gerade angenehmen Träumen geplagt wird. Dann verstummte er wieder – und wartete weiterhin ab.
Als es nach seiner Schätzung auf zwei Uhr zuging, begann er erneut zu schnarchen, diesmal jedoch stärker als zuvor. Das gehörte zu seiner Taktik.
Er hatte inzwischen den Belegnägel aus dem Versteck zum Vorschein geholt und bewegte ihn prüfend in der Hand. Hartes Holz, dachte er, vielleicht Steineiche. Für spanische Schiffe wie die „Estrella de Málaga“ wurden nur die besten Hölzer verwendet: Eiche, Steineiche, Edelkastanie, Nußbaum und Pinie. Es waren allesamt knochentrockene und harte Materialien, mit denen man einem Mann gut und gern den Schädel einschlagen konnte.
Carrero grinste jetzt. Er schnarchte immer lauter, nahm den Belegnagel in die rechte Hand und klopfte damit an die äußere Bordwand. Das gab dumpfe, pochende Laute.
Luke Morgan horchte auf. Was war das? Er war ein bißchen dösig geworden. Für kurze Zeit wäre er um ein Haar eingeschlafen, hatte sich aber immer wieder einen Ruck verliehen. Die Augen durften ihm nicht zufallen.
Wenn der Spanier auch keine Chance hatte, aus seinem Verlies zu entwischen – es war eine Schande für einen Arwenack, auf Wache einzupennen. Und die Blamage war noch größer, wenn man ihn dabei ertappte. Nein, das durfte sich keiner erlauben. Notfalls gab man sich lieber selbst eine Ohrfeige, als den Dienst zu vernachlässigen, was immer auch geschah.
Es hämmerte dumpf im Schiffsbauch, und der Kerl in der Vorpiek schnarchte wie ein Besessener. Aber was hatte das eine mit dem anderen zu tun? Luke war ein wenig verwirrt.
Luis Carrero lag inzwischen in Schlafstellung auf der Gräting der Vorpiek, die Hände auf dem Rücken, leicht zusammengekrümmt und die Front dem Schott zugewandt. Er stellte das Schnarchen kurz ein – und fing im nächsten Moment wieder damit an, noch lauter diesmal. Zwei- bis dreimal klopfte er wieder mit dem Koffeynagel gegen die äußere Wand, dann hörte er auf, schnarchte aber weiter.
Komm schon, du Ratte, dachte er. Wie lange brauchst du, um mißtrauisch zu werden? Stunden? Hölle das dauert mir zu lange. Warum, zum Teufel, kommst du nicht?
War der Bastard von einem Engländer am Ende eingeschlafen? Carrero wagte nicht, daran zu denken. Wenn der Posten ihn nicht hörte, war sein ganzer Plan, den er sich zurechtgelegt hatte, hinfällig. Dann konnte er auch nichts Neues ersinnen, denn es gab keine Alternative. Alles hing davon ab, daß der Mann dort draußen versuchte, dem Klopfen auf den Grund zu gehen.
Carrero setzte mit dem Schnarchen aus. Er hämmerte den Belegnagel gegen die Beplankung – viermal in kurzen Abständen. Wenn jetzt nichts passiert, ist alles verloren, dachte er.
Luke Morgan lauschte dem Schnarchen und dem Pochen. Verdammt, dachte er, was hat das zu bedeuten? Das Schnarchen beunruhigte ihn nicht, wohl aber das Klopfen. Es klang so, als klopfe von draußen jemand an die Bordwand, nicht laut, aber doch gut hörbar.
Was das wohl war? Wieder trat Stille ein. Dann ertönte wieder das Schnarchen aus der Vorpiek – und plötzlich war erneut das Pochen da, dumpf und unheimlich.
Luke nahm die Öllampe vom Haken, trat auf das Schott zu und schob den Riegel zur Seite. Er zog das Schott auf. Es knarrte ein wenig in seinen Angeln. Luke bückte sich und hielt die Lampe etwas tiefer. Der Lichtschein fiel etwas flackernd ins Innere und erhellte die Gestalt des Spaniers.
Carrero schnarchte wieder, jetzt verhalten. Das Klopfen hatte aufgehört. Luke betrachtete den Mann eine Weile, dann schien er überzeugt zu sein.
Der schläft, dachte er.
Ganz sicher war er aber doch noch nicht. Er wollte es genau wissen. Schlief der Kerl oder hielt er ihn nur zum Narren? Und wenn das Pochen von ihm herrührte, was bezweckte er damit?
Carrero schnarchte friedlich vor sich hin. Luke beugte sich über ihn.
„He!“ zischte er.
Carrero antwortete nicht.
Lukes Mißtrauen war immer noch nicht gewichen. Hier stimmt was nicht, sagte er sich – und dann stellte er die Öllampe auf einen Decksbalken. Er hatte vor, sich etwas gründlicher in der Vorpiek umzuschauen.
Als er sich jedoch halb von Carrero abwandte, wurde dieser plötzlich sehr lebendig. Er zog die Beine an den Leib, gab sich einen Ruck und sprang auf.
Luke hörte ein Geräusch und registrierte auch die Bewegung des Kerls. Er reagierte, fuhr zu ihm herum und wollte zur Pistole greifen. Aber er hatte die Bewegung noch nicht halb vollführt, da krachte etwas auf seinen Kopf – der Koffeynagel. Er hatte das Gefühl, sein Schädel platze auseinander. Stöhnend sackte er in die Knie.
Carrero wollte noch einmal zuschlagen, stellte aber fest, daß es nicht mehr nötig war. Der Engländer brach vor ihm zusammen und streckte sich auf den Planken aus.
Sehr gut, dachte der Spanier, das geschieht dir recht, du Mistkerl.
Er überlegte, ob er ihn töten sollte. Aber dazu war keine Zeit, er mußte sich jetzt höllisch beeilen. In Windeseile zog er sich die Stiefel aus. Die Langschäfter aus weichem Leder – auf sie mußte er jetzt verzichten, denn wenn die Flucht gelingen sollte, mußte er sich absolut lautlos durch das Schiff bewegen.
Er legte die Stiefel auf die Gräting und steckte den Belegnagel in den Hosengurt. Dann begann er, den ohnmächtigen Luke zu untersuchen. Wieder war er versucht, ihn umzubringen. Eine Welle des Hasses durchlief ihn. Hier war die Gelegenheit, sich für alles zu rächen, was sie ihm angetan hatten.
Aber wie denn? An einem einzelnen, unbedeutenden Decksmann sollte er sich rächen? Das konnte alles andere in Frage stellen, und ihm kam es doch viel mehr darauf an, zu fliehen und dafür zu sorgen, daß der schwarzhaarige Hurensohn Killigrew und dessen Kumpane gepackt und nach Potosi in die Minen verschleppt wurden.
Prioritäten setzen, lachte Carrero. Das war jetzt wichtig für ihn. Und er brauchte Waffen. Was hatte dieser Bastard bei sich? Etwa nur die Pistole?
5.
Nein, er hatte auch ein Entermesser. Carrero zog es vorsichtig aus der Scheide und prüfte die Schärfe der Klinge mit dem Daumen. Ausgezeichnet! Die Klinge war spiegelblank und frisch gewetzt, man konnte damit einem Kerl den Kopf abschlagen.
Carrero steckte sich auch die Pistole Luke Morgans zu, dann nahm er ihm das Pulverhorn und die Kugelbüchse ab. Den Belegnagel behielt er natürlich auch. Den konnte er noch gut gebrauchen, wenn es galt, einen jäh auftauchenden Gegner auszuschalten.
Er verließ die Vorpiek und pirschte den schmalen Schiffsgang entlang. Wo befanden sich die Kerle? Lagen sie alle im Logis und schliefen? Sollten sie weiterschlafen – er würde sie nicht weiter behelligen, obwohl er den Drang verspürte, ein volles Faß Pulver in ihren Raum zu rollen und zur Explosion zu bringen.
Aber auch damit gewann er nichts, er riskierte nur sein eigenes Leben. Er hielt sich das Endziel vor Augen: die totale Ausrottung der Bande um Killigrew. So schlich er weiter und befaßte sich in seinen Gedanken mit dem, was ihn an Oberdeck erwartete.
Wie viele Posten versahen dort die Ankerwache? Nur einer? Oder mehrere? Er hatte keine Gelegenheit gehabt, das zu ergründen. Er mußte es eben darauf ankommen lassen. Wenn er Pech hatte, mußte er mehrere Kerle abservieren.
Behutsam stieg er einen Niedergang hinauf. Es war jetzt wieder stockdunkel, der Lichtschein der Öllampe in der offenen Vorpiek reichte nur bis auf wenige Yards in den Gang. Carrero mußte sich vorantasten und höllisch aufpassen, daß er kein Geräusch verursachte.
Wenn ihm beispielsweise etwas im Weg lag, würde er mit Sicherheit darüber stolpern. Angenommen, die Kerle ließen irgendwo Kübel herumstehen. Stieß er dagegen, gab es einen Mordsradau, und sofort war das gesamte Schiff hellwach. Dann stürzten sie sich auf ihn und überwältigten ihn, und er hatte auch mit den erbeuteten Waffen nicht die geringste Chance.
Aber nein, die Bastarde waren ordentlich und gründlich. Hier wurde nicht geschlampt, sie hielten den Kahn gut in Schuß. Na bitte, dachte Carrero, und er näherte sich dem Logis und dem Schott zur Galion. Wenigstens zu etwas taugen sie. Sie würden auch in den Minen eifrig schuften, wenn sie mit der Peitsche dazu angetrieben werden.
Überhaupt, warum nahm er nicht den Kerl, den Killigrew als Kapitän vertrat, als Geisel und beherrschte auf diese Weise das ganze Schiff? Er ließ sich nach Arica segeln, lief als Sieger in den Hafen ein und ließ erst einmal einen der Hunde hängen, weil es ihm so gefiel – und als Abschreckung für alle anderen.