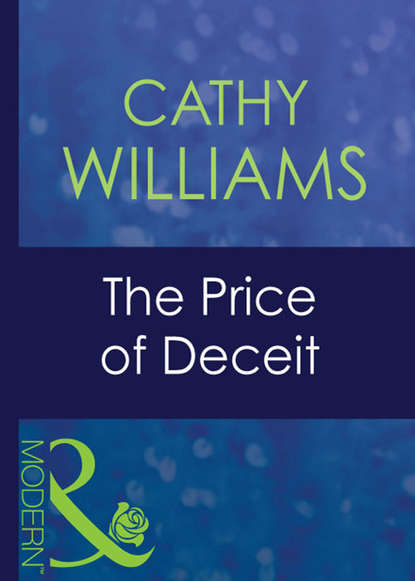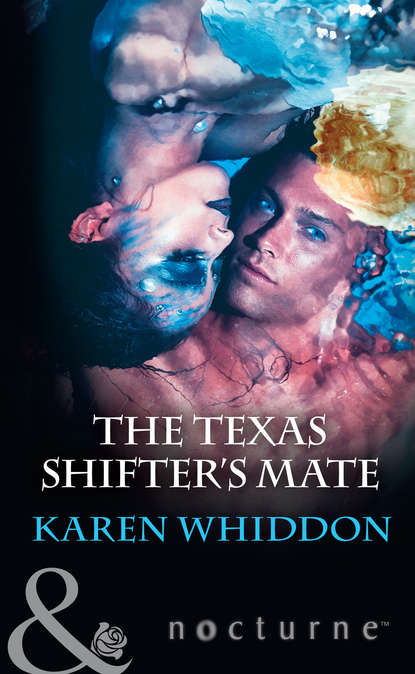Seewölfe Paket 23

- -
- 100%
- +
„Und die Fesseln? Wie hat er die gelöst?“
„Noch wissen wir es nicht“, erwiderte Blacky. „Aber er muß sie irgendwo aufgescheuert haben.“
„Vielleicht an einem Nagel, der ein Stück aus ’ner Planke ’rausragt“, meinte Sven. „Möglich wäre es. O Teufel, hätten wir ihm doch nie die Ketten abgenommen.“
„Ben hat es bereut, das kannst du mir glauben.“
„Und was ist weiter vorgefallen?“
„Carrero hat Luke, der gerade Wache vor dem Schott hatte, mit einem Trick hereingelockt. Er hat mit dem Belegnagel herumgehämmert, glaube ich. Luke wollte nach dem Rechten sehen, da hat Carrero ihm was über den Kopf gegeben. Vorher hat er sich natürlich schlafend gestellt.“
„Dieser Scheißkerl“, sagte Sven. „Wenn Hasard das erfährt, macht er uns alle zur Schnecke.“
„Carrero hat an Deck auch noch Jack Finnegan umgehauen – mit dem Belegnagel. Der hat eine saubere Handschrift, kann ich dir sagen.“
„Sind die beiden schwer verletzt?“
„Ihre Köpfe sind hart genug, sie werden es überstehen“, erwiderte Blacky. „Und wir haben ja schon Schlimmeres einstecken müssen, nicht wahr?“
„Ja, klar. Der dickste Hund ist, daß Carrero weg ist. Mann, so eine Schande.“
„Plymmie erwischt ihn“, sagte Blacky. „Ich bin davon überzeugt. Sie wird ihm sicherlich einiges mehr als den Hosenboden aufreißen. Was für einen Haß sie auf ihn hat, weißt du ja.“
„Ja.“ Sven stöhnte und verzog das Gesicht.
„Hör jetzt auf zu reden“, sagte Blacky. „Du hast schon genug Blut verloren. So gut wie der Kutscher bin ich nicht, aber vielleicht mindestens so gut wie Mac, was das Behandeln von Blessuren betrifft. Hältst du still – oder soll ich dir den Arm gleich amputieren?“
„Du machst vielleicht Witze!“
Blacky grinste, zog sich das Hemd aus und riß es in Streifen. Im Nu hatte er jeweils zwei Fetzen zusammengeknotet und legte Sven einen behelfsmäßigen Verband an. Lange würde diese Maßnahme nicht vorhalten, das wußten sie beide. Vor allen Dingen mußte Sven so schnell wie möglich an Bord der „Estrella de Málaga“, damit die Wunde ausgewaschen und mit sauberen Tüchern verbunden werden konnte.
Eine Weile hockten sie aber noch da und lauschten in die Nacht. War da nicht ein Knurren zu vernehmen? Plymmie – oder bildeten sie sich das nur ein? Wie weit hatte Carrero sich entfernen können, seit er auf Sven Nyberg gefeuert hatte? Sehr weit konnte er nicht gelangt sein.
Aber was war, wenn er die Hündin niederschoß? Gelang es ihm dann, sich wiederum abzusetzen, fanden Shane und seine Begleiter ihn in der Dunkelheit sicher nicht mehr wieder.
Plymmie riß und zerrte an ihrer Leine, und jedesmal, wenn das Halsband tief in ihr Fell schnitt, gab sie einen keuchenden Laut von sich.
„Laßt sie los!“ stieß Shane hervor. „Sie ist schneller als wir!“
Hasard junior biß die Zähne zusammen. Philip schnitt ebenfalls eine Grimasse. Hasard befreite Plymmie von der Leine – und sie raste davon.
Den Zwillingen war nicht wohl in ihrer Haut. Big Old Shanes Befehl war durchaus richtig, aber es gab auch noch einen anderen Aspekt, den man bedenken mußte: Sie mußten damit rechnen, daß Luis Carrero Plymmie kaltblütig tötete.
Allerdings war es genausogut möglich, daß Plymmie den Spanier niederwarf und schaffte. Und – nicht zu vergessen – es ging um Hasard und die Männer, die mit ihm nach Potosi unterwegs waren. Selbst wenn Plymmie geopfert werden mußte, war Shanes Entscheidung nur richtig: Das Leben der Männer war mehr wert als das eines Tieres.
Hasard junior und auch sein Bruder erkannten, wie schwer es war, solche Entscheidungen zu treffen, bei denen es um Leben oder Tod des einen oder anderen ging.
„Faß ihn!“ gellte Hasard juniors Stimme hinter Plymmie her – und sie schien ihr Tempo noch zu verdoppeln.
Sie jagte durch die Nacht – ein langgestreckter grauer Schatten. Die Männer und die beiden Jungen liefen hinter ihr her, hatten sie aber bald schon aus den Augen verloren.
Lautlos huschte Plymmie durch die Nacht, sie schien über den felsigen Untergrund zu fliegen. Sie verlor die Witterung des Spaniers nicht, hatte sie deutlich in der Nase. Die Flecken waren in der Dunkelheit nicht zu sehen, doch die Hündin roch sie: Blutstropfen hafteten an dem Gestein. Carreros Blut. Er hatte sich die Fußsohlen aufgescheuert und aufgeritzt.
Dieser Umstand erleichterte Plymmie die Suche. Sie wußte, welche Richtung sie einzuschlagen hatte.
Sie raste dahin und hetzte die Beute. Sie war jetzt die Wölfin, die sich ihrem Opfer näherte und ihm bald im Nacken sitzen würde. Eine gnadenlose Jagd – grausam, wie die Natur nun einmal war. Und doch lag eine gewisse Art der Fairneß darin. Das Opfer hatte eine Chance. Es konnte, wenn es gerissen genug war, noch auf die eine oder andere Art entwischen.
Wenn Carrero ins Wasser lief, verlor sich seine Spur. Aber er konnte sich nicht in die See stürzen. Welcher Sinn lag darin? Draußen war er verloren, und eine andere Art von Schicksal ereilte ihn.
Seine Hoffnung würde darin bestehen, an einen Bachlauf zu gelangen. Aber fand er ihn rechtzeitig genug? Noch ahnte er nicht, daß ihm die Hündin auf den Fersen saß.
9.
Luis Carreros Atem ging hastig und stoßweise. Er verfluchte sich, weil er die Langschäfter in der Vorpiek zurückgelassen hatte. Aber dieser Fehler war nicht wiedergutzumachen.
So schlimm, wie es jetzt war, hatte er sich das Ganze doch nicht vorgestellt. Das Gestein erwies sich als mörderisch. Seine Füße brannten wie Feuer. Er lief mit seltsam staksenden Bewegungen. Bei jedem Schritt hätte er am liebsten aufgeschrien.
Er verspürte den Drang, sich einfach hinzusetzen und abzuwarten – aber er mußte weiter. Nicht stehenbleiben jetzt, hämmerte er sich immer wieder ein, nicht schlappmachen.
In einem Anflug blinder Wut schleuderte er die Muskete von sich, die er Jack Finnegang abgenommen und auf Sven Nyberg abgefeuert hatte. Er hatte ohnehin keine Zeit zum Nachladen. Die Waffe behinderte ihn jetzt nur beim Laufen.
Sie flog ein Stück zurück und landete klappernd zwischen den Felsen. Carrero fluchte leise und hastete weiter.
Er wandte sich jetzt zur Küste. Da war zum Teil harter Sand, der nicht die Fußsohlen zerfetzte wie dieses scharfkantige Gestein. Die Aussicht auf einen besseren Boden beruhigte ihn wieder. Er ertrug die Schmerzen ein wenig besser. Immer wieder trieb er sich zu schnellerem Tempo an. Manchmal warf er einen Blick über die Schulter zurück.
Es schien ihm jedoch niemand zu folgen. Somit war die Flucht geglückt. Doch es war ein Fehler, jetzt zu verharren. Erst später, wenn Meilen zwischen ihm und den Verfolgern lagen, durfte er sich eine kurze Verschnaufpause gönnen. Dann ging es weiter, und er rechnete damit, Arica noch während der Nacht zu erreichen.
Dort durfte er sich auf seinen Lorbeeren ausruhen – nur für kurze Zeit, denn anschließend galt es, über die englischen Galgenstricke herzufallen und ihnen den Garaus zu bereiten. Aber aufatmen würde er, und er würde gleich wieder der alte Luis Carrero sein: selbstbewußt, stolz und überlegen.
Wenn er erst wieder in Potosi war – das gab ein Fest! Er würde sich an den Engländern rächen, würde sie schikanieren und foltern. Dann gab es eine große Orgie mit vielen Weibern, und sicherlich würde es auch Don Ramón de Cubillo einen Riesenspaß bereiten, den Sieg über die Bande von Schnapphähnen zu feiern.
Als Krönung der Feier sollte man, so fand Carrero, den Kopf des schwarzhaarigen Bastards Killigrew auf einem silbernen Tablett hereintragen. Ja, das war nach seinem Geschmack!
Seine Allerkatholischste Majestät wollte ja ohnehin nur den Kopf dieses Satans. Er wollte ihn nicht lebend. Welchen Wert hatte es, wenn Killigrew nach Spanien überführt wurde? Nicht den geringsten. Er, Luis Carrero, würde die Belohnung kassieren. Und der Ruhm und der Dank der Nation waren ihm sicher.
Diese Gedanken hielten ihn aufrecht und trieben ihn voran. Wieder verspürte er heftige Schmerzen. Er versuchte, sie zu ignorieren, aber so einfach war das nicht.
Er humpelte. Sein Herz hämmerte in der Brust, und in den Lungen spürte er schon seit geraumer Zeit ein scharfes Stechen. Dennoch hielt Carrero nicht inne. Weiter, weiter, dachte er, bleib nicht stehen!
Er erreichte den schmalen Uferstreifen und schlug die südliche Richtung ein. Ja, im Sand ging es besser. Die Schmerzen ließen jetzt nach. Er hatte den Eindruck, auch wieder schneller voranzukommen.
Noch einmal blickte er über die Schulter zurück. Nichts. Keine Gestalt näherte sich. Hatten die Bastarde von den Schiffen die Verfolgung überhaupt nicht aufgenommen, weil sie meinten, daß es aussichtslos sei?
Möglich war aber auch, daß sie ihren angeschossenen Kumpanen zwischen den Felsen entdeckt hatten und sich in diesem Augenblick um ihn kümmerten. Das verschaffte ihm einen größeren Vorsprung. Alles war zu seinem Vorteil. Es war letztlich auch nicht schlecht gewesen, daß dieser Hundesohn von einem Wachtposten versucht hatte, ihn zu stellen. Er hatte sein Fett empfangen, und die anderen konnten zusehen, wie sie ihn verarzteten.
Noch einmal schaute Carrero sich um. Plötzlich war er irritiert. War da nicht etwas? Links hinter ihm? Nein – er irrte sich bestimmt.
Er blickte wieder voraus und konzentrierte sich auf das Laufen. Wie lange konnte er so durchhalten? Die Fußsohlen brannten nicht mehr so schlimm. Sein Herz schlug noch heftig, aber wieder etwas regelmäßiger. Die Seitenstiche hielten sich in Grenzen. Er rechnete sich aus, daß er noch gut eine Stunde so weiterlaufen konnte.
Da – war da nicht ein Geräusch hinter ihm? Wieder wandte er den Kopf. Diesmal sah er den grauen Schatten, der wie ein Schemen über den Strand huschte.
Das Mark schien ihm in den Knochen zu gefrieren. Ein Hund, dachte er entsetzt. Die Bestie!
Sofort hatte er wieder das Bild vor sich, wie Plymmie ihn an Bord der „Estrella de Málaga“ angeknurrt hatte. Jetzt hatten sie das Vieh auf ihn losgelassen, kein Zweifel. Herrgott, warum hatte er nicht gleich daran gedacht? Und die Stiefel – sie hatte ja nur daran zu riechen brauchen. Und das Blut, das er garantiert auf den Felsen hinterlassen hatte, als er sich die Fußsohlen zerfetzt hatte?
Er wußte Bescheid. Er hatte selbst Hunde gehabt und war ein Fachmann auf dem Gebiet. Was für ein Narr war er doch! Diese Bastarde hatten den einfachsten und sichersten Weg gewählt, ihn zu fassen. Sie hetzten die Hündin hinter ihm her!
So hatte er es getan, wenn einmal Sklaven aus dem Lager am Cerro Rico von Potosi geflohen waren. Auch kurz vor seinem Aufbruch nach Arica, von wo aus seine Expedition in See gegangen war, hatte er einen dieser Indio-Affen, wie er sie nannte, „erlegt“. Der Kerl hatte sich eingebildet, ungesehen und ungehört aus dem Lager zu entwischen.
Aber er hatte einen Fehler begangen: Er hatte versucht, ihn, Carrero, umzubringen, und zwar mit einem Hartholzmesser. Carrero war dem Anschlag auf sein Leben dank seiner Geistesgegenwart entgangen – und dann hatte er seine Bluthunde auf den Mann gehetzt.
Ja, sie hatten ihn zerrissen. Carrero hatte sich das Werk selbst angesehen. Viel war von dem Kerl nicht übriggeblieben. Hatte er es anders verdient? Kein Indio durfte sich in den Kopf setzen, einen Luis Carrero überlisten zu können.
Außerdem waren sie allesamt dumm und dreist, diese Indio-Affen. Waren sie nicht von Gott bestimmt, als Sklaven für die Spanier zu arbeiten? Na also – es gab nichts Besseres und Richtigeres für sie. Statt sich zu beugen und dankbar zu sein, rebellierten sie jedoch. Dagegen gab es nur ein Mittel. Man mußte Exempel statuieren, um die anderen an der Kandare zu halten.
Carrero hatte immer nach dieser Devise gehandelt, unterstützt von Don Ramón de Cubillo, der alles guthieß, was sein Oberaufseher tat. Carreros Erfolge zählten: Er herrschte wie ein Despot, und auch die Aufseher kuschten vor ihm wie die Bluthunde.
Carrero war überall und hielt seine Augen und Ohren offen. Nichts konnte ihm entgehen. Und wenn neue Sklaven beschafft werden mußten, weil einige von den Indios die Frechheit hatten, einfach zu sterben, war Carrero immer sehr schnell mit „Nachschub“ bei der Hand.
Jawohl, er war ein angesehener Mann in Potosi. Und so würde es auch wieder sein, obwohl der Provinzgouverneur inzwischen allen Grund dazu hatte, sich zu sorgen. Keine Nachrichten von Carrero und dem Expeditionstrupp, obwohl diese schon längst hätten zurück sein müssen! Das gab selbst einem behäbigen Mann wie de Cubillo allmählich zu denken.
Warte auf mich, Don Ramón, dachte Carrero, ich komme!
Dann wandte er noch einmal den Kopf und stellte fest, daß der graue Schatten noch nähergerückt war. Das war die Realität – er konnte sich ihr nicht entziehen!
Es war genau die Situation, die er Hunderten von Sklaven mit seinen Bluthunden bereitet hatte. Jetzt war es umgekehrt – er war der Gejagte. Und er hatte Angst vor dieser wölfischen Bestie. Das Grauen, das ihn packte, konnte er nicht abschütteln.
„Nein!“ stieß er hervor.
Er glaubte, ein Hecheln und Knurren zu vernehmen. Der Abstand zwischen ihnen schrumpfte zusammen. Gleich war die Hündin heran. Carrero spürte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach. Sein Atem ging jagend, sein Herz schlug wie wahnsinnig. Die Seitenstiche nahmen wieder zu.
Aufhören! schrie es in ihm. Ich werde verrückt!
Schon einmal hatte ihn dieses Wolfsvieh umgerissen – entsetzlich! Das Hecheln war dicht hinter ihm. Das Knurren, das in unregelmäßigen Zeitabständen ertönte, holte ihn ein und versetzte ihn in Panik.
„Nein!“ schrie er. „Ich will nicht sterben!“
Carrero riß die eine der beiden erbeuteten Pistolen heraus – es war die von Luke Morgan. Er drehte sich halb um, spannte den Hahn, legte auf die Hündin an und drückte mit wutverzerrtem Gesicht ab.
Die Wölfin schien den Schuß geahnt zu haben. Sie schnellte zur Seite. Carrero feuerte auf den huschenden Schatten, der aber plötzlich hinter einem Uferfelsen verschwand.
Es schien sie nie gegeben zu haben, diese teuflische Wolfshündin. Es wirkte, als habe sie sich in Luft aufgelöst wie ein Spuk. Der Schuß donnerte in die Nacht – und ging fehl. Irgendwo prallte die Kugel von den Felsen ab und jaulte als Querschläger davon.
Carrero stöhnte auf. Das hatte ihm noch gefehlt.
Wieder hörte er das Knurren. Wie von Sinnen schleuderte er die leergeschossene Pistole aus dem Gurt. Sie gehörte Jack Finnegan, und es handelte sich um ein solides, nicht sonderlich aufwendig gearbeitetes, aber sehr präzises Radschloß-Modell.
Carreros Gesicht war eine Fratze der Angst und des Hasses. Er wollte den Hahn spannen, griff aber mit dem Daumen daneben. Er stolperte und drohte zu stürzen, fing sich wieder, fluchte und hantierte mit beiden Händen an der Waffe herum.
Endlich gelang es ihm, den Hahn zu spannen. Da sah er, wie der Schatten des Tieres wieder hinter dem Felsen hervorsprang.
„Nein!“ schrie er.
Plymmie raste auf ihn zu, ein zähnefletschendes Ungeheuer in der Nacht. Das Knurren nahm zu, das Hecheln wurde zu einem Dröhnen. Ihr Atem verwandelte sich in Dampf. In dieser Vision sah Carrero sie plötzlich, und er schrie noch einmal.
Er war halb irrsinnig vor Angst und Entsetzen, vor allem deshalb, weil er wußte, was solche Hunde mit Menschen anrichten konnten. Brüllend richtete er die Radschloßpistole auf Plymmie.
„Du Vieh! Ich bring’ dich um!“ schrie er.
Ihr Schatten flog an ihm vorbei. Er feuerte im Laufen, und ein Donnerhall rollte über den Strand. Der Mündungsblitz stach auf die Wolfshündin zu, doch wieder war sie schneller. Schon war sie vorbei, und die Kugel raste ins Leere.
Carrero brüllte auf und schleuderte die Pistole nach ihr. Er traf auch dieses Mal nicht. Die Pistole landete im Sand.
Plötzlich war Plymmie wieder verschwunden. Carrero taumelte. Er glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. War dieses Vieh vielleicht wirklich verhext? Stand es mit dem Teufel im Bund? Er konnte es nicht fassen. Er war ein guter Schütze, und er hatte schließlich auch den Kerl nicht verfehlt, der ihn angerufen und bedroht hatte. Warum gelang es ihm nicht, dieses Höllenbiest zu töten?
Er hatte nur noch das Entermesser als Waffe. Er zog es aus dem Gurt, nahm es in beide Hände, blieb stehen, blickte gehetzt nach allen Seiten und sagte: „Komm her! Wo bist du?“
Seine Stimme klang schrill und verzerrt. Er erkannte sie selbst kaum wieder. Wütend hackte er mit dem Entermesser durch die Luft.
„Du dreckiges Biest!“ brüllte er. „Wo steckst du?“
Er sah das Tier nicht, so sehr er seine Augen auch anstrengte. Keuchend, mit pumpenden Lungen, stand er da. Er duckte sich und schaute sich wieder nach allen Seiten um.
Da! Da war etwas! Oder nicht? Carrero war sicher, eine Bewegung bemerkt zu haben. Er schleuderte das Entermesser. Es huschte durch die Luft. Und dieses Mal traf er. Es gab ein hartes Geräusch, und er vernahm auch einen Ton, den Laut eines Tiers im Sterben, wehklagend und hell. Dann riß es ab.
Carrero trat auf sein Opfer zu. Er bückte sich – und dann begriff er. Es war nicht die Hündin, die er mit dem Messer getroffen hatte. Es handelte sich um einen Strandhasen, der jählings aufgetaucht war. Er hatte ihn glatt geköpft.
Carrero begann, wie ein Irrer zu lachen. Er konnte sich nicht mehr beruhigen und ließ das Entermesser zu Boden fallen. Nutzte es ihm noch? Nein. Das Vieh war fort. Verschwunden! Er konnte wieder laufen – Arica entgegen.
Er lief und lief, lachte und lachte. Er vernahm kaum das leise Knurren, das plötzlich wieder hinter ihm war. Und welche Bedeutung hatte es jetzt noch? Er hatte den Köter abgehängt, in die Flucht geschlagen – jawohl!
Die Wölfin war heran, setzte Carrero in letzten, langen Sprüngen nach und hob vom Boden ab. Sie flog von hinten auf ihn zu, saß ihm im Nacken und riß ihn mit sich nieder.
„Nein!“ schrie Carrero.
Aber sein gellender Schrei verröchelte. Es nutzte ihm nichts mehr, daß er mit den Fäusten nach ihr schlug und wie verrückt mit den Beinen stieß. Die Wölfin war ihm überlegen. Ihre kräftigen Zähne schnappten nach seiner Kehle. Carrero sah sie aufblitzen. Sie waren wie die Zähne eines Haies, dolchspitze Waffen, gnadenlos und tödlich.
Sein letzter Laut erstickte, als sie ihm die Kehle durchbiß. Sein Körper sank schlaff auf den Sand, dann regte er sich nicht mehr.
Die Wölfin ließ von ihm ab, trottete ins Wasser und schnappte nach den Wellen, als müsse sie sich das Maul spülen. Sie kehrte auf den Strand zurück, hob den Kopf und legte ihn in den Nacken. Sie schien den Mond anzublicken, öffnete ein wenig das Maul und gab ein verhaltenes Heulen von sich.
Dann begab sie sich wieder zu Luis Carrero, beschnupperte ihn und ließ sich schließlich in seiner Nähe auf dem Sand nieder. Sie schloß die Augen und öffnete sie wieder. Sie atmete jetzt ganz ruhig, von der Hetzjagd war ihr nichts mehr anzumerken. Überhaupt – es schien nichts geschehen zu sein. Ruhe war jetzt wieder eingetreten, unterbrochen nur von dem leisen Rauschen der Brandung.
Nichts konnte Sven Nyberg mehr halten. Als die Schüsse aufpeitschten, mußte er sich aufrappeln.
„Wir sehen nach, was da los ist“, sagte er zu Blacky. „Nein, keine Widerrede. Wenn du nicht willst, daß ich dem Trupp nachlaufe, ist das deine Sache.“
„Na los, ich stütze dich“, sagte Blacky.
„Mann, meine Schulter ist durchlöchert, nicht mein Bein!“
„Kannst du laufen?“
„Klar kann ich das!“ stieß Sven hervor, dann lief er los und hängte den verblüfften Blacky fast ab, als sie durch die Felsen zum Ufer eilten.
Shane, Al und die anderen hatten unterdessen das Wasser fast erreicht. Die Stille wirkte unheimlich. Was war geschehen?
„Plymmie!“ rief Hasard junior. „Plymiiiee!“
Ein helles Bellen ertönte hinter den Felsen. Philip junior und sein Bruder lachten auf.
„Sie ist am Leben!“ rief Philip.
„Hast du vielleicht was anderes erwartet?“ fragte Hasard.
„Ich schon, du vielleicht nicht?“
„Lassen wir das, es ist ja egal“, sagte Hasard junior.
Ziemlich außer Atem gelangten sie an den schmalen Uferstreifen, als erster Shane, dann die Zwillinge, und dicht hinter ihnen Al, Batuti, Montbars, Piet und Baxter.
Plymmies Ohren spielten. Als sie die Stimmen ihrer Leute hörte, bellte sie kurz, erhob sich und trottete ihnen entgegen.
Big Old Shane blieb stehen, streichelte sie und blickte zu der reglosen Gestalt, die in der Nähe der Brandung lag.
„Gut gemacht, Plymmie“, sagte er. „Der Frauenschänder und hundertfache Mörder hat sein gerechtes Ende gefunden.“
Batuti und Al liefen zu dem Toten.
„Hölle, die hat es ihm aber besorgt!“ stieß der Gambia-Mann in einer Mischung aus Verblüffung und Betroffenheit hervor.
Die Hündin strich um ihre Beine herum. Sie ließ jetzt die Zunge heraushängen und benahm sich wie ein junger Hund, der Lust zum Spielen hat. Es war kaum zu glauben, daß sie soeben einen Menschen getötet hatte.
„Achtung!“ stieß Montbars plötzlich hervor. „Da ist jemand!“
Sie fuhren herum und griffen zu den Waffen. Zwischen den Felsen waren leise Geräusche. Stimmen waren zu vernehmen. Dann erschienen Blacky und Sven Nyberg, und die Männer atmeten wieder auf.
„He!“ rief Big Old Shane. „Ihr habt uns vielleicht einen Schrecken eingejagt! Gebt euch das nächste Mal gefälligst zu erkennen!“
„Das habe ich glatt vergessen“, sagte Blacky.
„Ich dachte, ihr wüßtet, daß wir hinter euch sind“, sagte Sven.
„Du spinnst wohl“, sagte Shane. „Und überhaupt, was hast du hier zu suchen?“
„Ich will wissen, was mit Carrero ist“, sagte Sven.
„Er ist tot“, erwiderte Shane. „Plymmie hat ihn zur Strecke gebracht.“
„Das genügt mir“, sagte Sven grimmig. „Geschieht ihm recht.“
„Wir müssen Ben und die anderen benachrichtigen“, sagte Blacky.
„Du übernimmst das“, sagte Shane. „Und du nimmst Mister Nyberg gleich mit, der soll sich von Mac behandeln lassen.“
„Um Gottes willen“, stöhnte Sven. „Von dem?“
„Einen besseren Feldscher haben wir zur Zeit nicht“, sagte Shane grob. „Außerdem war ja nicht damit zu rechnen, daß es reihenweise Schulterdurchschüsse und Brummschädel gibt, nicht wahr?“
Darauf wußte keiner etwas zu erwidern. Blacky und Sven zogen sich zurück. Sie marschierten zur Bucht und setzten mit der intakten Jolle zur „Estrella de Málaga“ und zur „San Lorenzo“ über, um den voll Spannung wartenden Kameraden zu berichten, was sich zugetragen hatte.
Shane und die anderen bestatteten unterdessen den Toten.
„Er hat es nicht verdient“, sagte der graubärtige Riese. „Aber irgendwie ist es unsere Pflicht, verdammt noch mal. Wir können ihn schließlich nicht hier liegenlassen.“
„Wir könnten es doch“, sagte Batuti.
„Hör auf. Er ist tot, das genügt uns.“
Sie begruben ihn unter Steinen. Keiner sprach ein Gebet für Luis Carrero, kein Wort fiel. Sie wandten sich ab und schritten davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Carrero hatte empfangen, was er verdient hatte. Der Potosi-Trupp würde in keine Falle laufen …
ENDE
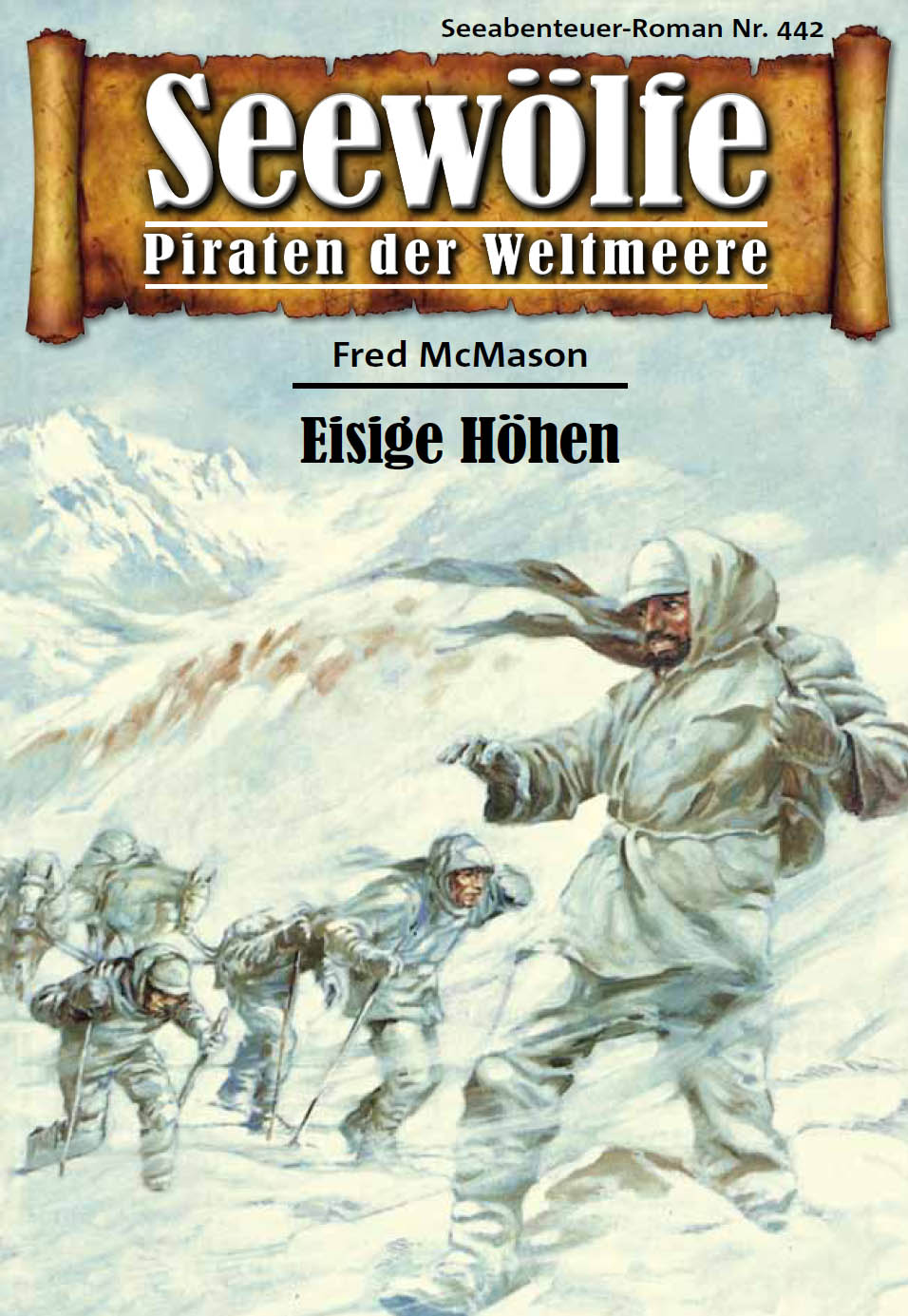
1.
28. November 1594 – Tacna.
Das „Unternehmen Potosi“ begann um neun Uhr morgens, denn jetzt war die zwölf Mann starke Truppe komplett. Als Führer, der die Bergwelt der Kordilleren genau kannte, hatte man den Dominikanerpater Aloysius gewonnen.
Dieser Pater Aloysius entsprach überhaupt nicht der Vorstellung von einem ehrbaren Mönchlein oder gar Betbruder. Er war ein kraftvoller, sehniger Typ mit kühn geschnittenem Gesicht, sehr scharfblickenden Augen, breiten Schultern und schmalen Hüften. Er sah eher wie ein Bilderbuchpirat aus, und er verstand es meisterhaft, seine Fäuste einzusetzen, wenn ihm das der Herr im Himmel befahl. Und da Pater Aloysius einen guten Kontakt zum Herrn unterhielt, befahl der Herr das offenbar recht oft.
Die Männer waren abmarschbereit. Auch die acht Maultiere, die sie von den Spaniern erbeutet hatten, als sie das Tacna-Tal überfielen, um Sklaven für Potosi zusammenzutreiben, waren bepackt und beladen.