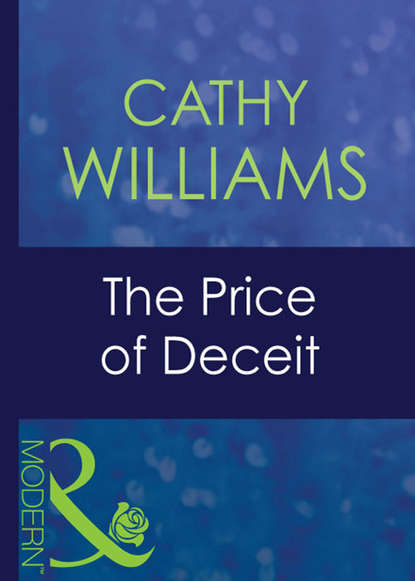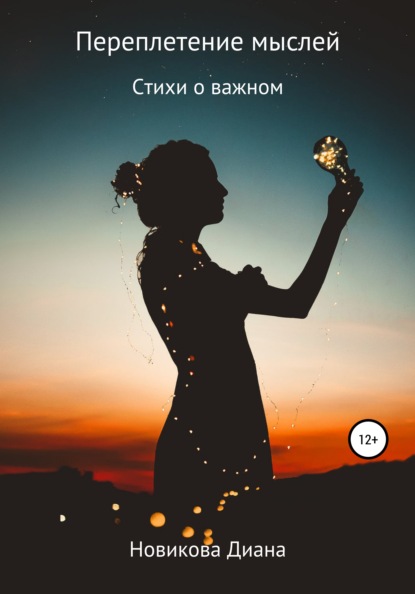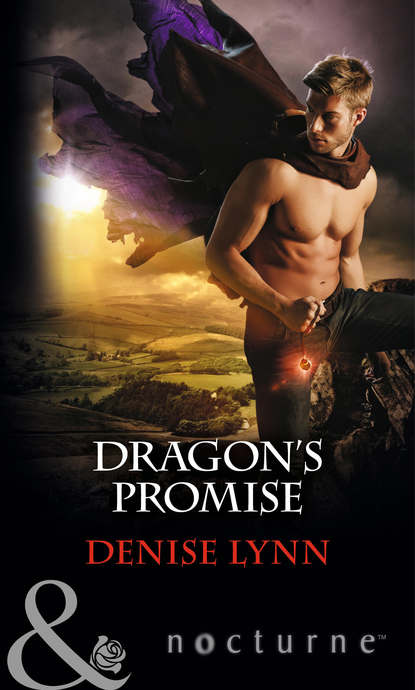Seewölfe Paket 28

- -
- 100%
- +
Der Onkel strich wieder durch seinen Bart. Aus den wenigen Silberfäden waren jetzt schon viel mehr geworden.
„Was ist schon – genaugenommen – ein Leben? Es ist nur ein kurzer Augenblick, den Allah uns auf Erden gewähren läßt. Das richtige Leben fängt erst später an, wenn man seine sterbliche Hülle abgelegt hat. Dann wird man von Allah ins Paradies aufgenommen, wo niemand Hunger oder Durst leiden muß. Dort warten die schönsten Mädchen auf einen, dort herrschen Frieden, Ruhe und Überfluß.“
Der Onkel geriet richtig ins Schwärmen und malte Ahmed aus, was ihn alles im Paradies erwarte. Er selbst schien es aber nicht so eilig zu haben, dorthin zu gelangen.
Ahmed selbst hatte es auch nicht eilig, aber er mochte dem Onkel nicht widersprechen, weil der ihn ja durchfütterte – unter großen Entbehrungen, wie er öfter betonte.
Aber da war die Angst vor diesen Tieren, die er nicht kannte, und auch die Zaubergärten fürchtete er, obwohl sie andererseits wieder seine Neugier weckten. Unbehaglich zog er die schmalen Schultern hoch.
Der Onkel erzählte ihm wieder von dem wundersamen schwarzen Riesenvogel, der sich tagsüber im Wasser aufhielt, aber nachts emporstieg und sich in die Lüfte erhob. Wenn man diesen Vogel sah, würde man eine der Schwarzen Tränen Allahs finden, denn der Vogel war der Wächter dieser Tränen.
Bisher hatte Ahmed den wundersamen, unter Wasser lebenden Vogel noch nie gesehen. Nur gehört hatte er von ihm. Es mußte ein mächtiges Tier mit gewaltigen Schwingen sein, die es im Wasser elegant bewegte. Vermutlich war es halb Fisch, halb Vogel, und es gab einige Fischer, die ihn schon mal gesehen hatten. Aber darüber hatten sie sich so erschreckt, daß sie die Suche nach den Schwarzen Tränen vergessen hatten.
Ob das alles so genau stimmte, wußte Ahmed nicht. Er konnte es auch nicht beurteilen. Aber es wurde viel darüber erzählt, abends, wenn die Fischer oder Perlentaucher am Strand beim Essen zusammensaßen.
Selim schreckte ihn aus seinen Gedanken.
„Los, Ahmed, wir segeln hinüber. Ich glaube, heute ist unser ganz großer Glückstag. Heute werden wir sie finden, die Schwarzen Tränen, und dann sind wir reich.“
Der Onkel deutete lachend ins Wasser.
„Das Meer ist heute etwas wild“, sagte er, „aber das braucht dich nicht zu ängstigen. Du bist ja sowieso die meiste Zeit unten, wo es still und ruhig ist. Ich muß da viel mehr Angst haben als du.“
Und wieder strich er lachend durch seinen dunklen Bart.
Eine halbe Stunde später befanden sie sich ganz außen am Riff. Vom Boot aus sah man nicht viel, nur eine helle grünliche Fläche, die jäh durch eine pechschwarze Zone unterbrochen wurde. Das Grün hörte übergangslos auf, und direkt daneben ging es so tief hinunter, daß man die Tiefe nicht einmal ahnen konnte.
Ahmed hatte eine Gänsehaut, als er in das schwarze Wasser blickte. Trotz der Hitze stieg eine Kältewelle nach der anderen in seinem Körper hoch.
„Du mußt dich immer am Ankertau entlangtasten“, riet der Onkel. „Dann kann gar nichts passieren.“
Ahmed nickte kläglich, nahm den Muschelkorb und sah nach, ob das Messer an seiner Hüfte richtig saß. Nachdem er tief Luft geholt hatte, sprang er ins Wasser.
Er hatte noch nie am Außenriff getaucht – ebenso wie die anderen Fischer, die nach Perlen suchten. Sie alle hatten Angst vor der wilden Strömung, der fürchterlichen Tiefe und den gräßlichen Untieren, die das Riff bevölkerten.
Am Ankertau stieg er langsam tiefer ab und sah sich um. Links vor sich gewahrte er eine schwarze drohende Wand. Sie war mit bunten Nesseltieren besetzt, deren Arme sich in der Strömung hin und her bewegten. Finstere Löcher gähnten in der Wand. Nach einem letzten Vorsprung fiel sie steil in die Tiefe ab wie ein gewaltiger Berg, von dessen hohem Grat man schaudernd hinabblickte.
Die Schönheit dieser Welt entschädigte Ahmed allerdings für seine Angst. Am Außenriff war es ganz anders als an den kleinen Korallenbänken. Aber dort war das Wasser auch nicht so tief.
Es war wirklich ein riesiger Zaubergarten, in den er geriet, und er sah sich mit neugierigen Augen um.
Da gab es farbenprächtige Fische, die nicht die geringste Scheu zeigten, als er sich ihnen näherte. Sie wichen erst dann ein Stück aus, wenn er die Hände ausstreckte.
Er erreichte den Stein, der als Anker diente, und hielt sich immer noch an dem Tau fest. Vor ihm befand sich eine wellige Zone aus hellgrünen Gräsern. Sie bewegten sich, als streiche unaufhörlich der Wind darüber. Alles war hier in pausenloser fließender Bewegung.
Wie gewohnt, sah er sich sofort nach Muscheln um. Das hatte Selim ihm immer wieder gepredigt. Er sah jedoch keine einzige, und so ließ er das Tau los und schwamm unter Wasser ein Stück weiter.
Eigenartige Tiere bewohnten diesen welligen Garten. Sie sahen wie kleine Aale aus, waren aber ganz bunt gemustert. Ahmed schwamm ihnen aus dem Weg, denn es gab kleine Seeschlangen, die ungeheuer giftig waren. An ihrem Biß starb man innerhalb kürzester Zeit.
Auch den Abgrund mied er sorgfältig, weil er dort immer das Gefühl hatte, in endlose Tiefen zu stürzen. Er schwamm dicht über den welligen Gräsern und tauchte dann auf, um Luft zu holen.
An der Oberfläche schüttelte er den Kopf, damit Selim wußte, daß er nichts gefunden hatte. Der Onkel nickte enttäuscht zurück.
Beim zweiten Tauchgang stöberte er einen jungen Hai auf, der erst erschreckt die Flucht ergriff, dann aber seine Neugier nicht bezähmen konnte und wieder umkehrte.
Ahmed nahm das Messer zur Hand und verhielt sich ruhig und abwartend. Sein Herz klopfte überlaut in der Brust, als der Hai sich ihm noch weiter näherte. Dann verschwand er ganz überraschend in einem riesigen klaffenden Loch in der Felswand.
Die Welt um ihn herum wurde immer bizarrer und wundersamer. Er bemerkte Fische, wie er sie noch nie gesehen hatte, Korallen von unglaublicher Farbenpracht und Größe.
Jedesmal, wenn er auftauchte, sah er, wie sich die kleine Tartane immer heftiger auf dem Wasser bewegte. Die Gestalt seines Onkels tanzte hin und her, und es gab immer einen Ruck, wenn das Schiff an der Ankertrosse zerrte.
Eigentlich war es Zeit, jetzt vom Außenriff abzulaufen und in die geschützte Bucht zu segeln. Aber Selim gab ihm kein Zeichen, und so tauchte er weiter und entfernte sich auch weiter vom Schiff.
Hier wuchsen überall kleine und große Felsen vom Grund nach oben. Es gab finstere Höhlen, Löcher und Spalten. Als er an einer vorbeischwamm und den Meeresboden absuchte, glotzten ihn zwei funkelnde Augen an. Die Augen sah er ganz deutlich, den Leib aber nicht, der war weiter hinten in der Höhle verborgen.
Ahmed schrak heftig zusammen. Ohne große Bewegungen zog er sich ganz langsam zurück. Dabei sah er, daß die Augen immer noch auf ihn gerichtet waren, als verfolgten sie aufmerksam jede seiner Bewegungen.
Schließlich wand sich unendlich langsam ein monströser, schenkelstarker Riesenleib aus der Grotte. Der häßliche Kopf pendelte hin und her, ein Maul mit spitzen scharfen Zähnen öffnete sich klaffend.
Jetzt zog sich Ahmed so schnell zurück, wie er nur konnte. Es war eine riesige Muräne, die ihn anstarrte.
Oben angelangt, war die See noch bewegter. Es sah nach einem handfesten Sturm aus, und ein heißer Wind stieß ihm in das Gesicht.
Onkel Selim dachte immer noch nicht daran, aufzugeben. Er saß nur da und blickte gedankenverloren über das Wasser.
Beim achten Tauchgang schwamm er durch ein Gewirr von Felsen, Korallen und dunklen Tangwäldern. Die Umgebung wirkte gespenstisch und unheimlich. Zwischen den Korallen gab es stachelige und große Seeigel. Auch bläuliche Seesterne bewegten sich auf dem Grund. Über ihm schwebten wie leuchtende Wolken zwei kopfgroße violette Quallen.
Gleich darauf spürte Ahmed etwas auf, das sein Herz härter schlagen ließ. Er konnte es anfangs nicht glauben, als er den mächtigen Schatten im Wasser sah.
Das erste, was er verspürte, war nackte Angst, fast Panik. Im ersten Impuls wollte er sofort auftauchen. Aber dann packte ihn doch die Neugier, und er schaute wie gebannt zu dem mächtigen Tier im Wasser.
Es hatte sich anscheinend vom Grund erhoben, wo es ausgeruht oder etwas gejagt hatte.
Jetzt glitt es langsam und majestätisch davon. Es war eine Riesenmanta mit einer Spannweite von mehr als fünf Yards, es war der schwarze Riesenvogel, der tagsüber durchs Wasser schwebte und nachts fliegen konnte, wie die Fischer sagten.
Ahmeds Angst war plötzlich wie weggeblasen. Er schwamm dicht über dem Grund und starrte dem „Vogel“ nach.
Ja, es schien wahrhaftig ein Vogel zu sein. Er hatte mächtige und ausladende Schwingen, und er bewegte sich so, als fliege er. In gleichmäßiger und ruhiger Folge bewegten sich seine Schwingen. Er schien keine Eile zu haben.
Ahmed folgte ihm fast instinktiv. Er brauchte sich nicht anzustrengen und konnte dem schwarzen Vogel mühelos hinterherschwimmen. Das große Tier schien harmlos zu sein und griff keine Menschen an. Ahmed hoffte nur, daß er lange genug die Luft anhalten konnte, um dem Vogel auch weiter zu folgen.
Dann fiel ihm siedendheiß ein, was der Onkel gesagt hatte. „An dem Tag, an dem du den schwarzen Vogel siehst, wirst du eine der Schwarzen Tränen Allahs finden.“ So ungefähr hatte er sich ausgedrückt.
Er schluckte vor Aufregung. Wenn das wahr war, wenn das wirklich stimmte, waren sie reich und brauchten sich lange Zeit keine Sorgen mehr zu bereiten.
Seine Luft war verbraucht, er mußte wieder nach oben. Diesmal beeilte er sich, so schnell er konnte, um den Riesenvogel nicht aus den Augen zu verlieren.
Er war noch da, als er wieder hinuntertauchte. Einen Augenblick glaubte Ahmed, der schwarze Vogel hätte auf ihn gewartet und sei absichtlich langsamer geschwommen. Er sah, daß ein paar kleinere Fische den Großen begleiteten. Zwei hatten sich an seiner Unterseite mit Hilfe von Saugnäpfen angeheftet, zwei weitere schwammen dicht vor seinem Maul herum. Sie lebten von den Resten der Beute, die der schwarze Vogel übrigließ.
Ahmed merkte nicht, wie die Zeit verging. Seine größte Sorge war immer das Auftauchen und die Angst, den Fisch dann endgültig aus den Augen zu verlieren.
Es ging durch ein farbenprächtiges Labyrinth aus Korallen, kleinen Tangwäldern, leuchtenden Aktinien und über grasähnliche Flächen hinweg, wo überall Fische schwammen.
Dann tauchte ein riesiger Korallenstock auf, eine langgestreckte Barriere, die mit zahlreichen Höhlen durchsetzt war.
Der schwarze Vogel beschrieb eine spielerische und elegante Bewegung und segelte um die Barriere herum, wobei er einen ziemlich schmalen Durchschlupf wählte.
Ahmed traute sich da nicht hindurch. Womöglich lauerten in dem Spalt Muränen. Also stieg er etwas auf und schwamm darüber hinweg.
Als er die Barriere hinter sich hatte, war der große Vogel ganz plötzlich verschwunden. Enttäuscht stieg Ahmed auf, schnappte nach Luft und glitt wieder in die Tiefe. Doch von dem Riesenvogel fand sich keine Spur mehr. Vielleicht war er doch in die Lüfte gestiegen, wie die Fischer immer behaupteten.
Als er sich noch ratlos umsah, entdeckte er, daß der ganze Boden dicht mit Muscheln bewachsen war. Sie klebten auf einer flachen Korallenbank von mindestens zwei Schiffslängen Ausdehnung.
Der Junge starrte die Pracht fassungslos an. Er war davon überzeugt, daß ihm der schwarze Riesenvogel den Weg zu der Muschelbank gewiesen hatte. Schnell sammelte er Muscheln ein, bis der Korb gefüllt war. Diesmal war der Aufstieg weit schwieriger als sonst. Die See dünte noch stärker. Er hielt nach seinem Onkel Ausschau, der mit seiner Tartane weit entfernt war. Als Selim ihn entdeckte, hievte er den Steinanker hoch und segelte auf ihn zu.
Ahmed übergab den Korb. Die Muscheln wurden an Deck geschüttet.
„Sind da unten noch mehr?“ fragte Selim heiser.
„Ja, noch viel mehr. Ich habe den schwarzen Riesenvogel gesehen“, stieß Ahmed hervor. „Als er verschwunden war, fand ich die Perlen.“
Selim geriet außer sich vor Freude.
„Habe ich es dir nicht prophezeit?“ fragte er aufgeregt. „Ich bin sicher, daß wir Allahs Schwarze Tränen finden. Du mußt ganz schnell wieder hinunter und die anderen Muscheln holen.“
Ahmed nickte. Er war jetzt doch ziemlich erschöpft.
„Wollen wir nicht lieber morgen tauchen?“ fragte er zaghaft. „Es kommt ein harter Sturm auf. Ich habe mir den Platz gemerkt, wo die Muscheln liegen.“
Selim wehrte mit beiden Händen ab.
„Der Sturm wird nicht so schlimm werden, und die Perlen sind wichtiger. Wenn wir sie nicht heraufholen, dann tut es ein anderer, und wir haben das Nachsehen.“
Er gab Ahmed aus dem Lederschlauch etwas zu trinken und wartete ungeduldig, bis der Junge wieder in der Tiefe verschwand. Dann ging er in aller Eile daran, mit dem Messer die Muscheln zu öffnen. Er brach sie auf, warf voller Gier einen Blick hinein und feuerte sie dann, eine nach der anderen, enttäuscht in einen Holzzuber.
Ahmed brachte den nächsten Korb voll nach oben, dann den dritten. Nach dem achten Tauchvorgang war die Muschelbank geplündert und leer.
Der Junge brach vor Erschöpfung fast zusammen. Er wollte nur noch ausruhen, schlafen, sich ausstrecken. Aber Selim dachte trotz der immer höher gehenden See nicht daran, endlich nach Hause zu segeln. Wie besessen öffnete er eine Muschel nach der anderen.
Nach einer halben Stunde blickte er in das Fleisch einer Muschel und erstarrte. Dann stieß er einen unterdrückten Schrei aus, öffnete den Mund und blickte fassungslos auf eine schwarze Perle.
„Die Träne Allahs“, flüsterte er und begann am ganzen Körper vor Aufregung zu zittern.
4.
Weil das Frischwasser in dieser tropischen Hitze immer schnell verdarb, ließ Hasard öfter Wasser an Land holen, sobald sie ein oasenähnliches Fleckchen entdeckten. Dort war das Wasser von besonderer Qualität und immer kühl und frisch.
Jetzt war das wieder der Fall. An Backbord war ein gewaltiger Hain aus Dattelpalmen zu sehen, der hinter einem hohen Dünenkamm versteckt lag. Es mußte eine große Oase sein.
„Dort holen wir noch einmal Wasser“, sagte Hasard. „Unser Zeug ist ja wieder brühwarm. Außerdem können wir uns mit weiteren Früchten eindecken.“
Der Profos verzog ein bißchen das Gesicht.
„Behagt dir das etwa nicht?“ fragte der Seewolf.
„Das Trinkwasser schon, Sir. Aber Datteln und Feigen kann ich nicht mehr sehen. Die einen schmecken süß und pappig, und die anderen pappig und süß. Warum läßt der Große Kapitän nicht einmal ein paar saftige Steaks an den Palmen wachsen?“
„Gibt’s denn so was überhaupt?“ fragte Paddy Rogers. „Ich habe noch nie solche Palmen gesehen.“
„Natürlich gibt es die nicht“, brummte Carberry. „Das ist nur so eine Wunschvorstellung von mir. Aber dir muß man ja alles immer erst dreimal verklaren, bis du was kapierst. Du merkst auch erst, daß Ebbe ist, wenn’s beim Rudern staubt, was, wie?“
„Bei mir hat es noch nie gestaubt“, versicherte Paddy treuherzig.
„Wir gehen dort vorn vor Anker“, sagte Hasard, ohne auf das Geplänkel zwischen Profos und Paddy zu achten. Letzterer erkundigte sich jetzt ernsthaft, ob es wirklich bei Ebbe stauben könne, aber der Profos winkte nur genervt ab.
Die „Santa Barbara“ nahm Kurs auf die Küste, wo hinter dem Dünenkamm die Wedel der Palmen zu erkennen waren. Sie hatte gerade den Kurs geändert, als aus dem Großmars eine Meldung erfolgte. Oben lehnte an der Segeltuchverkleidung Matt Davies und wies mit seiner blitzenden Hakenprothese nach achtern.
„Kleines Schiff achteraus. Läuft auf Nordkurs.“
„Noch nicht vor Anker gehen“, sagte Hasard. „Wir luven nur an und warten ab, bis das Schiff deutlicher zu erkennen ist.“
Don Juan de Alcazar blickte durch den Kieker.
„Das sieht fast einer Khalissa ähnlich“, sagte der Spanier nachdenklich. „Könnte aber auch eine Sambuke sein. Das läßt sich noch nicht einwandfrei unterscheiden.“
Der Seewolf wurde sofort hellhörig. Nur zu gut war ihm die Begegnung mit dem letzten Piratengesindel noch in Erinnerung. Er hatte „kleine Gefechtsbereitschaft“ angeordnet. Das bedeutete, daß alle Rohre geladen und feuerbereit waren. Bei der ruhigen See waren auch die Stückpforten hochgezogen. Die Stücke brauchten nur noch ausgerannt zu werden. Für die kampferprobten Arwenacks war das das Werk weniger Augenblicke, dann konnte man zur Sache gehen.
„Ein pechschwarzer Kasten“, sagte Dan O’Flynn. „So schwarz wie das Schiff des Wikingers. Sogar die Segel sind pechschwarz.“
„Dann könnten es Piraten sein“, sagte Hasard. „Schwarz ist bei Nacht eine vorzügliche Tarnung, um andere Schiffe zu überfallen. Meist bemerkt man sie zu spät.“
Es war tatsächlich eine Sambuke, wie sich etwas später einwandfrei erkennen ließ. Das Schiff segelte unglaublich schnell und hatte gerade eben fast unmerklich den Kurs geändert. Noch erweckte es den Anschein, als würde es in mehr als einer Meile Entfernung an der „Santa Barbara“ vorbeisegeln.
Hasard kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Die Sonne spiegelte sich auf dem Wasser und zauberte Lichtreflexe hervor.
„Ah, ein ganz unauffälliger Bursche“, sagte er leise. „Er will auf uns zuhalten und ändert den Kurs so unmerklich, daß man es anfangs gar nicht mitkriegt. Will sich wohl die vermeintliche Beute ansehen“, setzte er hinzu.
„Ansehen kostet ja nichts“, meinte der Profos. „Anfassen wird schon etwas teurer, und wenn er uns zu lange beschnüffelt, dann gibt’s was auf die Hörner, die orientalischen. Ja, er ändert tatsächlich wieder ganz leicht den Kurs.“
Carberry grinste ein bißchen. Das sah nach Vorfreude aus, aber sein Grinsen hatte auch etwas Boshaftes an sich. Erwartungsfroh sah er der Sambuke entgegen.
„Wird Zeit, daß mal wieder ein paar Affenärsche gebügelt werden“, murmelte er dann.
Die schwarze und düster wirkende Sambuke hielt ihren Kurs so, daß sie in etwa zwei Kabellängen Entfernung die Galeone passieren würde. Die Arwenacks sahen ihr neugierig entgegen.
„Kein einziges Kanönchen“, sagte Hasard, „aber gerade das stimmt mich mißtrauisch. Es sind nämlich überall Halterungen für Drehbassen angebracht. Die Kerle versuchen, einen äußerst harmlosen Eindruck zu erwecken.“
„Die sehen so unverdächtig und harmlos aus wie Sandflöhe in langen Hosen und Halskrausen“, stellte Carberry fest. „Seht euch doch nur diese Visagen an! Ich krieg’ mich nicht mehr ein. Achtet mal auf den Kerl mit dem grünen schmuddeligen Unterrock auf dem Schädel.“
Al Conroy hatte inzwischen auf der von der Sambuke nicht einsehbaren Seite die Rohre ausrennen lassen. Ein halbes Dutzend Arwenacks standen bereit. Die Galeone brauchte nur ein wenig den Kurs ändern.
Der Kerl mit dem schmuddeligen Unterrock auf dem Schädel sah wahrhaftig zum Fürchten aus. Es waren stumpfe Züge in einem total geistlosen Gesicht. Ein Fransenbart wuchs ihm fast waagerecht vom Kinn weg. Als der Kerl jetzt auch noch betont harmlos grinste und das Maul aufriß, schluckte sogar der Profos. Hinter dem Mottenbart erschien ein spärliches Gebiß, das oben nur aus drei und unten aus zwei schwarzen Zahnstummeln bestand.
„Nicht mal ’ne tote Kakerlake würde ich dem anvertrauen“, meinte Carberry schaudernd.
Aber es gab noch mehr derartige Gestalten. Verschlagene, tückische Gesichter, lauernde Augen, gebleckte Zähne, eine Rumpelkammer menschlicher Hinterhältigkeit und Boshaftigkeit tat sich da auf.
Die Schnapphähne hatten die Arme um die Bäuche verschränkt, damit man die Krummdolche nicht sah.
Der mit dem Unterrock hob den einen Arm und winkte. Gleichzeitig näherte sich die Sambuke noch weiter. Drüben erweckten sie den Anschein, als freuten sie sich mächtig, aber die Arwenacks erkannten in den zerbeulten und narbigen Visagen die Wahrheit. Die Kerle konnten ihr Metier nicht verbergen.
Hasard stand abwartend auf dem Achterdeck und musterte jenen Kerl, der offenbar der Anführer der Roßtäuscher und Buschräuber war. Er sah in ein unrasiertes Gesicht mit gemeinen Augen. Und obwohl der Kerl „zuvorkommend“ grinste, war unverkennbar, was er vorhatte. Nämlich sich freundlich anzubiedern, um dann blitzartig einen Überfall zu unternehmen.
Ein paar von ihnen riefen etwas in einer Sprache herüber, die selbst die Zwillinge nicht verstanden. Es konnte „schönes Schiff“ oder etwas Ähnliches heißen.
„Ja ja, schönes Schiffchen!“ rief der Profos den Halunken zu. „Aber jetzt klemmt euch mal euren schwarzen Sarg unter die Achseln und zeigt die Hacken. Könnte sonst passieren, daß ihr heute noch mit dem Scheitan persönlich ein Tänzchen auf die Planken legt.“
Scheitan hatten sie offenbar verstanden. Einigen verging das Grinsen, und sie plierten tückisch herüber. Weitere Blicke wurden mit dem Kerl an der Ruderpinne gewechselt, der drohend herübersah.
„Ruder hart Backbord, Pete“, sagte Hasard.
Pete Ballie legte Ruder. Die „Santa Barbara“ schwang herum.
Drüben starrten Halunken entgeistert in ausgefahrene Culverinen, die genau auf sie gerichtet waren.
Der mit dem Unterrock auf dem Schädel klappte seinen Zahnfriedhof zu und biß sich vor Schreck mit seinen letzten Stummeln auf die Zunge. Dabei verzog er schmerzhaft die Visage.
Bei den Kerlen verlor sich von einem Augenblick zum anderen jegliche vorgetäuschte Freundlichkeit. Sekundenlang standen sie wie Salzsäulen da, dann kapierten sie endlich, daß ihrerseits jegliche Aktion zu spät kam. Sie würden ihre Drehbassen nicht einmal mehr hochwuchten können, ohne in Stücke geblasen zu werden.
Auch Alu Ben Chufru verstand diese Sprache nur allzu gut. Die verdammten Christenhunde hatten sie glatt überrumpelt und waren jetzt eindeutig im Vorteil. Da war es wohl doch angemessen, man begab sich auf den Rückzug.
Er tat so, als interessiere ihn dieses Schiff nicht mehr, obwohl er innerlich vor Wut kochte, überrumpelt worden zu sein.
Gleichgültig drehte er den Kopf weg und rief seiner Bande dabei ein paar gezischte Worte zu.
In die erstarrten Figuren geriet Bewegung. Jeder hatte plötzlich etwas zu tun und verhielt sich so, als gäbe es die Galeone nicht mehr. Die Sambuke segelte weiter. Keiner der Kerle drehte sich auch nur ein einziges Mal noch um. Nach einer Weile verschwand sie hinter einer schmalen Landzunge den Blicken der Arwenacks.
Hasard lächelte, etwas schadenfroh, wie es den Anschein hatte. Die anderen grinsten ebenfalls mehr oder weniger.
„Das war den ehrenwerten Señores aber gar nicht recht, plötzlich in die Mündungen von Kanonen blicken zu müssen“, sagte Don Juan, der ebenfalls am Grinsen über die schnelle Abfuhr war. „Die haben sich die Sache vermutlich anders vorgestellt.“
„Wesentlich anders“, stimmte Hasard zu. Dann rief er nach oben: „Kannst du die Kerle noch sehen, Matt?“
„Die segeln an die Küste!“ rief Matt. „Aber ich sehe nur noch die Mastspitzen.“
„Vermutlich wollen sie uns auflauern“, meinte Ben Brighton. „Aber damit werden sie auch kein Glück; haben. Wir werden aufpassen.“
„Und vor allem aus der Reichweite ihrer Drehbassen bleiben“, sagte Hasard. „Auf größere Distanz können sie gegen unsere Culverinen ohnehin nichts ausrichten.“
Die Sambuke segelte noch ein Stück weiter und rundete dabei eine weitere Landzunge. Dort legten sich die Schnapphähne offenbar auf die Lauer. Jetzt waren von dem Schiff nur noch ganz schwach die Mastspitzen zu erkennen.
„Wollen wir trotzdem noch Wasser holen?“ erkundigte sich Shane. „Wenn wir vor Anker liegen, und den Halunken fällt es ein …“
„Ich weiß, was du meinst“, sagte Hasard. „Wir werden nicht ankern, die Galeone aber so am Wind halten, daß die Kerle uns nicht überraschen können, ohne sich blutige Nasen zu holen. Auf das Wasserholen möchte ich nicht verzichten, weil wir nicht wissen, wann sich wieder eine so günstige Gelegenheit bietet.“
Der Ausguck hatte die schwarze Sambuke zwar nicht im Blickfeld, er wußte aber, wo sie sich aufhielt, und er würde sofort bemerken, wenn sie lossegelte. In dieser Hinsicht bestand also so gut wie keine Gefahr mehr.
Kurz darauf wurde das Beiboot ausgesetzt. Shane, Ferris Tucker, Edwin Carberry und Batuti enterten ab. Sie hatten drei größere Wasserfässer dabei, einschließlich der Tragegestelle. Jeder hatte im Hosenbund eine doppelläufige Pistole stecken.