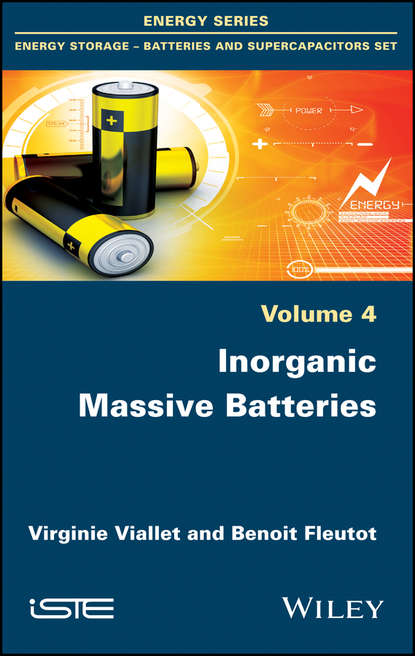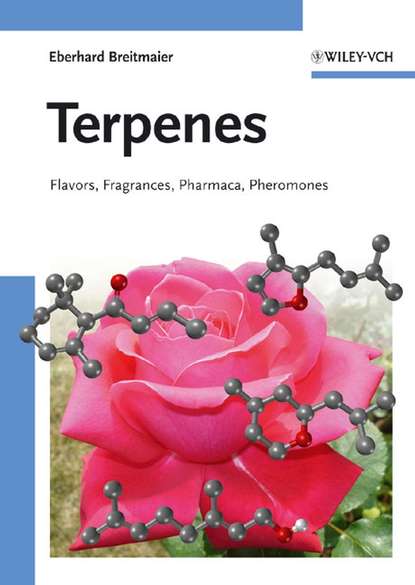Seewölfe Paket 28

- -
- 100%
- +
„Nehmt lieber noch ein paar Musketen mit“, riet Hasard. „Ich traue den Brüdern gerade hier an dieser Küste nicht über den Weg. Mit den Pistolen habt ihr keine große Reichweite, falls etwas passiert.“
Batuti nahm die geladenen Musketen in Empfang, die ihm Al Conroy über die Rüste nach unten reichte. Sie legten ab und pullten zum Land hinüber, zu einer Stelle, wo sie die „Santa Barbara“ nicht mehr im Blickfeld hatten. Auch von ihr waren nur noch die Mastspitzen zu sehen. Die Galeone begann, langsam gegen den warmen Wind zu kreuzen.
Hinter der Ladzunge sahen sie die große Düne vor sich. Von den Dattelpalmen war jetzt ebenfalls nichts mehr zu sehen, so hoch stieg der Dünenkamm an.
Carberry drehte sich beim Pullen um und zeigte mit dem Amboßkinn in die Richtung, wo der Strand ganz flach wurde und sich feinpulveriger Sand befand.
„Da ziehen wir die Jolle hoch“, sagte er. „Dann haben wir es leichter und können schräg über den Dünenkamm laufen.“
Batuti saß an der Ruderpinne und spähte zum Land hin. Der schwarze Riese hatte die Augen zusammengekniffen und musterte die Düne. Er glaubte, dahinter eine flüchtige Bewegung gesehen zu haben, war sich seiner Sache aber nicht ganz sicher. Doch dann riß er mit einem harten Ruck die Ruderpinne herum.
„He, was soll das?“ protestierte Carberry.
„Hört mal auf zu pullen“, sagte Batuti leise. „Mir war so, als hätte sich bei der Düne etwas bewegt.“
Sie hielten die Jolle so, daß sie freies Blickfeld zum nahen Land hatten. Aber dort rührte sich nichts.
„Vielleicht hast du dich getäuscht“, sagte Ferris.
Batuti schüttelte den Kopf und starrte weiterhin aufmerksam zum Land hinüber.
Als sich nach einer Weile immer noch nichts rührte, zog der Profos die Riemen wieder durchs Wasser.
„Wahrscheinlich war es das Sonnenlicht, das dich geblendet hat“, meinte er. „Das passiert öfter mal.“
Sie waren noch keine zehn Yards weitergepullt, als Batuti ruckhaft zusammenfuhr.
„Zwei Kerle“, sagte er und deutete zum Land.
Links hinter der Düne tauchten zwei Kamelreiter auf. In einer Sandwolke rückten sie rasch näher.
Die Arwenacks erkannten weit hinter ihren Köpfen jetzt deutlich die Türme einer Moschee, die im Sonnenlicht glänzten.
Sie stellten das Pullen ein und tasteten nach der Muskete.
Inzwischen hatten sich die Kamelreiter weiter genähert. Sie trugen schmuddelige Kaftans und hatten turbanähnliche Tücher um die Köpfe geschlungen. In den Händen hielten sie Musketen, die sie jetzt hochrissen. Carberry glaubte in dem einen Kerl einen der Galgenstricke von der Sambuke wiederzuerkennen.
Noch im Reiten feuerten sie ihre Musketen ab. Zwei kleine Flammenzungen erschienen vor den Läufen. Der Knall hörte sich wie Peitschenschläge an.
Gedankenschnell hatten die Arwenacks ihre Waffen in den Händen.
Big Old Shane duckte sich instinktiv, als etwas mit zirpenden Geräuschen an seinem Kopf vorbeiflog. Die Kugel versengte ihm fast das rechte Ohr.
Die zweite Kugel schlug in die Ducht ein und blieb stecken. Im Holz entstand ein Loch, in das bequem ein Daumen hineinpaßte.
Die beiden Kerle warfen die leergeschossenen Musketen achtlos in den Sand und griffen nach ihren Pistolen. Immer noch stürmten sie wild auf den Kamelen voran.
Big Old Shane feuerte. Er schoß nicht überhastet und ließ sich ein paar Augenblicke Zeit, um das auf und ab schwankende Ziel besser erfassen zu können.
Zur selben Zeit feuerten auch Ferris und der Profos. Der eine Reiter wurde im Sattel schlaff und sank in sich zusammen. Dabei fiel ihm die Pistole aus der Hand. Einen Augenblick später flog er in hohen Bogen aus dem Sattel. Er überschlug sich ein paarmal und blieb mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken liegen.
Der andere fiel ebenfalls aus dem Sattel und verlor seine Waffe. Er blieb jedoch mit seinem Kaftan hängen und wurde ein Stück von dem Kamel mitgeschleift. Dann landete auch er leblos im Sand. Die beiden Kamele trabten in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Hinter der Düne war nur noch eine Staubwolke zu sehen, dann war der ganze Spuk auch schon vorbei.
„Das waren doch diese dreckigen Pilger von der Sambuke“, fluchte Carberry. „Die eine Visage habe ich wiedererkannt. Aber was sollte dieser Angriff auf uns bezwecken?“
„Ein Racheakt“, sagte Ferris lakonisch. „Sie haben vorhin nichts erreicht und wollen sich dafür rächen. Offenbar sind das recht nachtragende Halunken.“
„Und wo haben sie die Kamele her?“
„Vermutlich in der Oase geklaut. Sie haben uns von irgendeinem Punkt aus belauert oder bemerkt, daß wir die Jolle aussetzten. Dann haben sie einen Bogen um die Düne geschlagen, sich die Kamele besorgt und wollten uns in Empfang nehmen.“
„Schon möglich“, sagte Carberry. Sie sahen zu den beiden reglosen Gestalten im Sand. Anscheinend waren alle beide tot.
„Die anderen werden die Schüsse gehört haben“, sagte Batuti. „Was tun wir jetzt – an Land pullen, oder kehren wir zurück an Bord? Es kann sein, daß dahinten noch mehr Kerle auf uns lauern.“
Die Entscheidung wurde ihnen abgenommen. Hinter der Landzunge schob sich die „Santa Barbara“ hervor.
„Zurück an Bord“, sagte Carberry. „Hasard winkt uns zu.“
Sie kehrten um, legten an der Rüste an und erzählten, was vorgefallen war.
Hasard blickte durch das Spektiv zu den stummen Gestalten im Sand.
„Das kann sich alles so abgespielt haben, wie du sagst, Ed. Die Rabauken wollten euch überraschen, und fast wäre ihnen das auch gelungen. Wir segeln noch ein Stück näher heran, bis wir einen besseren Überblick haben. Dann können wir immer noch die Fässer füllen.“
„Weiter im Landesinnern ist eine Moschee mit Türmen zu sehen“, berichtete Batuti. „Man sieht aber nur die Spitzen.“
„Haben wir schon bemerkt. Es ist nur eine winzige Ortschaft. Ein paar der Bewohner flüchten weiter ins Landesinnere. Ich glaube nicht, daß wir noch etwas zu befürchten haben.“
„Dann sollten wir uns doch mal etwas näher mit den Schnapphähnen befassen“, schlug der Profos vor. „Wenn wir die Sambuke überraschen, brummen wir ihr ordentlich eins auf.“
Bevor Hasard antworten konnte, meldete sich wieder der Ausguck.
„Die Sambuke segelt weiter. Sie hält sich ziemlich dicht unter Land.“
„Na also“, sagte Hasard, „damit ist das Problem von allein gelöst. Es hat keinen Zweck, ihr zu folgen. Sie ist schneller als wir.“
Nachdem noch einmal alles genau abgesucht worden war, stand fest, daß sich keine weiteren Kerle in der Nähe aufhielten. Die Piratensambuke hatte ihre beiden Schnapphähne einfach im Stich gelassen und war weitergesegelt, ohne sich um sie zu kümmern. Die Piraten konnten nicht einmal über den Ausgang ihres Überfalles Bescheid wissen.
5.
Die beiden Schnapphähne waren tot, wie Carberry feststellte, als sie die große Düne erreicht hatten.
„Was tun wir mit ihnen?“ fragte Shane.
„Gar nichts“, knurrte Carberry zurück. „Meinetwegen sollen die Geier sie holen. Ich fühle mich nicht verpflichtet, den Totengräber für üble Schnapphähne zu spielen.“
Sie nahmen die Tragegestelle mit den leeren Fässern auf und umgingen die Düne. Dort blieben sie erst einmal stehen.
Ganz dicht vor ihnen befand sich ein langgestreckter Palmenhain. Er war um ein großes Wasserloch gruppiert. Hier gab es nicht nur Wasser im Überfluß, sondern auch Datteln.
Kein Mensch ließ sich blicken. Erst viel weiter hinten lag ein kleines Dorf mit hellen Lehmhäusern, einer Moschee und zwei Minaretten. Dort schien sich zur Zeit niemand aufzuhalten. Die paar Bewohner hatten wohl angesichts der Piratensambuke blitzschnell das Weite gesucht und waren dorthin gelaufen, wo noch mehr Palmenhaine standen.
In dem Wasserloch spiegelte sich die Sonne. Das Wasser selbst war von tiefblauer Farbe. Hier ging auch kein Wind mehr, und so war es unerträglich heiß.
„Sieht nach Ruhe und Frieden aus“, sagte Shane, „leider aber gibt es immer wieder ein paar Hundesöhne, die diesen Frieden nachhaltig stören müssen.“ Er sah sich noch einmal genau um, konnte aber niemanden entdecken. Auch drüben bei den Hütten rührte sich nichts.
Batuti und Shane luden die Fässer an der Wasserquelle ab und füllten sie. Es war herrliches klares und kühles Wasser. Davon überzeugten sie sich gleich an Ort und Stelle.
Während die beiden Wasser einfüllten, pflückten Ferris und der Profos Datteln ab. Ferris tat es voller Eifer und probierte auch gleich welche. Carberry tat es mit verzogenem Gesicht.
„Von dem süßen Pappzeug kriegt man matschige Flossen“, maulte er. „Meine sind schon so weich wie die Datteln selbst.“
„So süß sind die doch gar nicht“, widersprach Ferris. „Außerdem bereichern sie unseren Speisezettel. Der Kutscher hat gesagt, man kann daraus auch Schnaps herstellen. Man muß sie nur richtig präparieren.“
Plötzlich waren die Datteln gar nicht mehr so uninteressant für den Profos. Ziemlich wild begann er zu pflücken.
„Dattelschnaps, was, wie? Das müssen wir gleich ausprobieren. Ich habe doch gewußt, daß die Dinger zu etwas gut sind.“
Innerhalb kurzer Zeit war der große Leinensack voll mit Datteln. Inzwischen hatten auch Shane und Batuti die Fässer gefüllt. Mit Hilfe der Tragegestelle schleppten sie die Wasserfässer zur Jolle. Der Profos hatte sich den Sack mit Datteln aufgeladen.
„Wir sollten noch mehr davon holen“, schlug er vor. „Schließlich nehmen wir den Leuten in dem Dorf ja nichts weg. Die haben jede Menge Datteln.“
„Ich dachte, die seien dir zu pappig und matschig“, sagte Shane grinsend.
Carberry dachte wieder an Dattelschnaps und blickte verzückt zum Himmel.
„Das war am Anfang so. Jetzt sind mir diese Früchtchen so richtig sympathisch geworden. Ich werde nachher gleich mal mit dem Kutscher reden.“
Etwas später waren sie an Bord, und da nahm der Profos sofort den Kutscher zur Seite.
„Stimmt es, daß man aus den Datteln Schnaps bereiten kann?“
„Das stimmt. Man kann das aus fast allen Früchten. Sie müssen nur süß sein und stark gären.“
„Dann fangen wir am besten gleich an, bevor sie vergammeln“, drängte Carberry. „Wir holen auch sofort noch mehr.“
„So schnell geht das nun auch wieder nicht. Du kannst nicht ein paar Datteln abrupfen und anschließend verlangen, daß sie zu Schnaps werden. Dazu gehört etwas mehr. Aber ich werde es versuchen. Shane kann mir aus Kupferblech ein paar Röhrchen herstellen, die braucht man nämlich zur Destillation.“
„Aha. Aber wenn wir mehr Schnaps herstellen wollen, können wir dann nicht einfach ein Kanonenrohr nehmen? Ich meine, da läuft doch wesentlich mehr durch als durch so ein kleines Röhrchen.“
Der Kutscher amüsierte sich köstlich über den eifrigen Profos. Aber leider waren seine gigantischen Ideen mit Kanonenrohren und so nicht in die Tat umzusetzen. Er brauchte eine ganze Weile, um dem Profos das zu verklaren.
Eine halbe Stunde später wurden noch drei weitere Fässer Trinkwasser geholt. Der Profos sorgte dafür, daß auch noch reichlich Datteln an Bord genommen wurden. Der Grund dafür war der Küstenverlauf. Hasard war in den Großmars aufgeentert und hatte mit dem Spektiv die Küste genau abgesucht. Von weiteren Oasen oder Ansiedlungen war weit und breit nichts zu sehen. Nur ein wüstenähnlicher und unbewachsener Landstrich erstreckte sich an der Backbordseite.
Bis sie damit fertig waren, wurde es Abend, und die Schatten der Nacht senkten sich über Land und Meer. Sie beschlossen, die Nacht über hier vor Anker liegenzubleiben. Es gab in Küstennähe zahlreiche Untiefen und außerdem das Problem mit Ebbe und Flut, das einen wesentlich anderen als den gewohnten Rhythmus aufwies.
Erst in der Frühe des nächsten Tages segelte die „Santa Barbara“ wieder weiter.
Von dem unterdrückten Schrei erwachte Ahmed aus seinem Halbschlaf und fuhr hoch. Fassungslos blickte er zu seinem Onkel. Ein derartiges Gesicht hatte er bei ihm noch nie gesehen.“
Selim hatte den Mund weit aufgerissen. Die Augen quollen ihm fast aus den Höhlen, sein braunes Gesicht war ganz fahl und gelblich geworden. Dazu stieß Selim ein paar undefinierbare Laute aus. In der Hand aber hielt er eine Muschel, und in die starrte er hinein, als sei dort alle Herrlichkeit der Welt verborgen.
„Was ist, Onkel Selim, fehlt dir etwas?“ fragte Ahmed besorgt.
Selim gab immer noch keine Antwort. Nur um seine Lippen zuckte es ständig. Er schien etwas sagen zu wollen, brachte aber vorerst keinen Ton heraus. Schließlich begann er zu schnaufen.
„Allahs Schwarze Träne“, sagte er heiser. „Du hast eine von Allahs Schwarzen Tränen gefunden, Ahmed. Hier ist sie.“
Der Onkel fiel auf die Knie, hielt die große Muschel mit der rechten Hand umklammert und bedankte sich lautstark und kreischend bei Allah über den glücklichen Fund. Er pries ihn in den höchsten Tönen. Dann kehrte er langsam wieder in die Wirklichkeit zurück, benahm sich aber trotzdem immer noch seltsam und eigenartig.
Endlich durfte auch Ahmed Allahs Schwarze Träne sehen, aber der Onkel hielt sie jetzt mit beiden Händen umklammert.
Ahmed war erst etwas enttäuscht über den Fund. Er beugte sich über die Hände und sah in die Muschel. Zunächst sah er nur etwas Schwarzes zwischen dem rosigen Fleisch. Es war klein und unscheinbar auf den ersten Blick. Ahmed hatte sich die Schwarzen Tränen immer ganz anders vorgestellt – schwarz und geheimnisvoll schimmernd.
Ein harter Stoß traf die Tartane. Ahmed konnte sich gerade noch festhalten, sonst wäre er über Bord gegangen. Die Tartane hatte nur ein knapp kniehohes Schanzkleid. Sie benahm sich bei dem Seegang jetzt wie wild, aber das Wasser kochte auch schon fast.
Feierlich und voller Andacht bohrte Selim mit dem Finger in dem Muschelfleisch herum und schob die Perle höher. Erst jetzt offenbarte sich ihre ganze Schönheit, und sie war viel größer, als es den Anschein erweckte.
Stumm starrte er das kleine Wunderwerk an. Er hatte schon rosa, gelbliche und fast durchscheinende Perlen gesehen, aber niemals ein Exemplar von solch erlesener Schönheit. Er war wahrhaftig eine der Tränen, die Allah in seiner Trauer geweint hatte und die dann auf den Meeresgrund gesunken waren, wo der schwarze Vogel sie hütete und gefräßige Haie sie bewachten.
Und er, Ahmed, hatte dieses Prachtstück gefunden! Er war unbändig stolz darauf.
Aber jetzt mußten sie schnellstens an Land, denn die See wurde immer wilder und aufgewühlter. Die Tartane ächzte und krachte in allen Verbänden. Sie schlingerte hin und her, tauchte tief mit dem Bug ins Wasser und wurde von hohen Brechern überschwemmt.
„Wir müssen zurück!“ schrie Ahmed durch den Sturm, dessen Brausen hohler und orgelnder wurde, weil er an Heftigkeit zunahm.
Selim sagte gar nichts. Er starrte nur die Perle an, die Perle, die ihm Reichtum bescheren würde, wenn er sie verkaufte.
Der Onkel reagierte immer noch nicht. Er schien nicht einmal zu bemerken, daß sich um sie herum die Hölle auftat.
Da gab es einen scharfen peitschenden Knall. Ahmed sah sofort, daß das Ankertau gebrochen war.
Jetzt wurde es noch schlimmer, denn sofort legte sich die Tartane hart auf die Seite. Das kleine Segel zerfetzte. Der Sturm trieb sie auf die ferne Küste zu.
Selim schlitterte auf Knien über das ganze Deck und stieß sich den Schädel. Die Muschel mit der Perle hielt er immer noch umklammert, als wolle sie ihm jemand entreißen.
Ahmed kriegte jetzt Angst, als der Onkel sich nicht mehr erhob. Der harte Anprall hatte ihn offenbar bewußtlos werden lassen.
Er wagte sich ein paar Schritte vor, um dem Onkel zu helfen, doch da traf ein fürchterlicher Brecher das kleine Schiff. Er wischte mit unvorstellbarer Gewalt über das Deck. In einer Sturzflut aus Wasser und wildem Schaum sah Ahmed undeutlich, wie Selim die Hand öffnete, als er sich aufrichten wollte.
Der harte Wellenschlag wischte Allahs Schwarze Träne über Bord! Sie verschwand irgendwo in der Tiefe beim Außenriff.
Der Junge spürte, wie sich eine harte Faust um sein Herz krampfte. Es schien jeden Augenblick aussetzen zu wollen. Jahrelang und unter vielen Gefahren hatten sie nach den kostbaren Perlen gesucht. Und jetzt, als sie endlich eine gefunden hatten, war sie auch schon wieder fort, noch bevor sie sie richtig betrachten konnten.
Diese Schwarze Träne war für alle Zeiten verloren.
Weitere Überlegungen konnte Ahmed nicht anstellen. Er sah nur noch den Onkel weiter auf das Schanzkleid zurutschen. Die Tartane hing hart nach Backbord über, aber Selim konnte sich nicht festklammern.
Ahmed wußte nicht, ob er den Verlust der schwarzen Perle schon bemerkt hatte.
Dann traf es ihn selbst mit fürchterlicher Gewalt. Ein hallender Schlag dröhnte in seinen Ohren. Eine Riesenfaust schlug ihm hart ins Kreuz. Aufschreiend griff er um sich, doch da war nichts mehr als Wasser und abermals Wasser.
Er stürzte, fiel, überschlug sich, wurde mitgerissen und fortgetragen von wirbelnden Wogen, die immer wieder über ihm schäumend zusammenbrachen. Die Welt bestand nur aus einem einzigen Chaos, in dem es kein Unten und kein Oben mehr gab.
Die Erkenntnis, daß er sich nicht mehr auf der Tartane befand, überfiel ihn erst später. Dann nämlich, als er auf den wilden Wogen nur noch weit entfernt ein schwankendes kleines Gebilde sah, das von einer Seite zur anderen torkelte.
Von der Küste sah er nicht einmal einen Strich, und hoch über ihm befand sich nur ein Feld aus großen grauen Wolken.
Ahmed empfand ungeheure Angst, eine Angst, wie er sie nur selten in seinem Leben gehabt hatte. Er schrie und brüllte, wurde unter Wasser gedrückt, wild emporgeschleudert und hin und her geworfen, bis er nicht mehr wußte, wo oben und unten war.
Wenn ihn eine Welle hochhob, sah er in weiter Ferne die Tartane. Er preßte die Zähne zusammen und konzentrierte seine Blicke auf das wild schlingernde Schiffchen. Doch den Onkel sah er nicht. Entweder lag er noch bewußtlos an Deck, oder die See hatte ihn ebenfalls über Bord gespült.
Sein einsamer Kampf gegen die wütenden Elemente begann. Verzweifelt schlug er anfangs noch um sich. Aber das kostete ungeheure Kräfte und erschöpfte ihn schnell. Dann fing er an, seine Lage zu überdenken.
Er wußte ungefähr, wo die Küste lag, und er wußte auch, daß es eine sehr weite Strecke war, die er schwimmend zurücklegen mußte. Obwohl er ein guter Schwimmer war, hatte er Bedenken, es zu schaffen, denn dazu war die See zu hoch.
Die Angst war wieder da, die ihn zweifeln ließ, an ihm nagte und fraß und seine Unsicherheit vergrößerte. Hinzu kamen auch gleich noch eine Menge anderer Sorgen. Hatte der Onkel es überlebt? Würde die Tartane an der Küste zerschellen oder untergehen? Außerdem war die kostbare Perle im Meer verschwunden. Allein das war schon ein herber Verlust.
Ein schäumender Brecher begrub ihn und wirbelte ihn nach unten wie in einen gigantischen Sog. Gerade noch rechtzeitig hielt Ahmed die Luft an, um kein Salzwasser schlucken zu müssen.
Das Meer spie ihn nach einer Weile wieder aus. Hustend, keuchend und heftig nach Luft ringend, geriet er an die Oberfläche. Da hatte er schon fast die Orientierung verloren und wußte nicht mehr, wo das Land lag. Von der Tartane sah er ebenfalls nichts mehr. Wind und Wellen hatten sie weit abgetrieben. Oder war sie schon gesunken?
Er betete und flehte zu Allah, daß er ihn endlich aus dieser Misere erlösen und zur Küste geleiten möge.
Einmal glaubte er, weit voraus einen dunklen Schatten über dem Wasser zu sehen. Er schwamm kaum noch, ließ sich einfach von den Brechern treiben und wartete. Nicht mehr lange, das wußte er, würden seine Kräfte erschöpft sein. Dann sank er wie ein Stein auf den Meeresgrund.
Die Bewegung über dem Wasser war immer noch zu sehen, aber nur sehr undeutlich zu erkennen.
Sein Herz schlug plötzlich schneller. Vielleicht hatte Onkel Selim es doch noch geschafft und suchte jetzt nach ihm das Meer ab.
Hin und wieder verschwand der Schatten, und dann tanzten Ahmed rote Ringe vor den Augen, aus denen bunte Kreise wurden. Ihm wurde alles egal und gleichgültig. Auch diesen Zustand kannte er. Er hatte ihn ein paarmal erlebt, wenn er in seiner Neugier zu tief getaucht war. Dann kam es wie ein Rausch über einen, oder man wurde gleichgültig.
Wieder sah er den Schatten. Es war nur ein vager Umriß, der sich aus den Wellen hob, aber danach sofort wieder im nächsten Wellental verschwand.
Der Schatten rückte nicht näher. Er schien auf der Stelle zu tanzen, obwohl er mal größer wurde und dann wieder schrumpfte.
Er starrte so angestrengt darauf, daß er nicht merkte, wie sich über seinem Kopf ein neuer Brecher auftürmte. Direkt vor ihm schlug er zischend und donnernd zusammen.
Ahmed schluckte Wasser, denn diesmal hatte er nicht aufgepaßt. Er schluckte so viel, daß seine Lungen brannten und ihm übel wurde. Ein Hustenanfall würgte und schüttelte ihn. Die roten Ringe wurden erneut zu feurigen Kreisen und immer größer.
Dann fraßen sie ihn in einer gigantischen roten Explosion auf.
6.
Sein Erwachen begriff er überhaupt nicht. Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren und wußte auch nicht, wo er sich befand.
Er wähnte sich auf einem hohen Berg, von dem ihn jemand unsanft hinabstieß, aber immer bevor sein Körper in die Tiefe aufschlug, wurde sein Fall jäh gebremst und ging in ein langes Schweben über. Wie ein Vogel, der sich von der Bergspitze ins Tal gleiten läßt.
Kehliges Lachen glaubte er einmal in seiner unmittelbaren Nähe zu hören. Ein paar geflüsterte Worte fielen. Danach versank er übergangslos in einem tiefen Wasser, das ihm machtvoll ins Gesicht schlug.
Lange Zeit konnte er sich diesen eigenartigen Zustand nicht erklären. Er hatte so etwas auch noch nie erlebt.
Das Auf und Ab blieb, ebenso der große und dumpfe Gong, dessen hallender Schlag an seine Ohren drang. Kaum war er verhallt, da erklang er wieder. Ein merkwürdiger Ton war das.
Da war auch etwas Licht, wie er feststellen konnte. Das Licht wurde nur alle Augenblicke dunkel, als würde es von einem riesigen Schwamm aufgesogen.
Dann brannte es schmerzhaft auf seiner Wange, und als er mühsam die Augen öffnete, kehrte er mit einem Schlag in die Wirklichkeit zurück und wußte sofort, was passiert war – bis zu jener Stelle, wo ihn die rote Explosion verschlungen hatte.
Er sah sich um. Vor Entsetzen schloß er sofort wieder die Augen, denn er sah direkt in die Fratze des Scheitans, der ihn höhnisch angrinste und ihm einen Backenstreich gab.
Die Stimmen um ihn herum wurden lauter. Dazwischen erklang rohes und bösartiges Gelächter.
„Mach die Augen auf, du Bastard!“ brüllte der Scheitan mit donnernder Stimme.
Ahmed riß die Augen weit auf, um weiteren schmerzhaften Backenstreichen zu entgehen. Er wollte etwas sagen, brachte aber vor Aufregung und Schreck vorerst keinen Ton heraus.
Dafür starrte er in dämonische Fratzen. Manche blickten ihn aus zusammengekniffenen Augen gleichgültig an, andere grinsten hinterhältig, und ein paar weitere Kerle musterten ihn wie einen giftigen Fisch, den sie am liebsten wieder ins Meer zurückwerfen würden.
Das waren Totengräber in wilder verwegener und verdreckter Kleidung, Buschräuber, Schnapphähne und Blutsäufer übelster Sorte, zwischen die er geraten war.
Piraten waren es, wie sie die Küstengebiete um Abu Dhabi heimsuchten, Kerle, die Beute rissen wie Ali Ben Chufru und noch einige mehr, die sich auch nicht scheuten, arme Fischer auszuplündern.
Und diese Halunken hatten ihn offenbar aufgefischt und bereiteten sich jetzt einen Spaß daraus, ihn ins Leben zurückzuholen.
Ahmed blickte aus den Augenwinkeln scheu nach links. Dort stand ein bärtiges Ungeheuer mit finsteren Augen und drohenden Blicken. Der Kerl lehnte am Schanzkleid und schaute herüber. Ahmed sah, wie sein Körper immer auf und ab ging, wie er sich hob und senkte, wenn die Wellen das Schiff bewegten. Er sah nur diesen gewaltigen, tonnenförmigen Leib. Die Beine vermochte er nicht zu sehen.
„Na, bist du endlich wieder bei dir?“ fragte ein unrasierter Kerl mit einem hämischen Grinsen. „Beinahe hätten dich die Haie gefressen, aber du warst ihnen wohl noch zu klein und zu mager.“