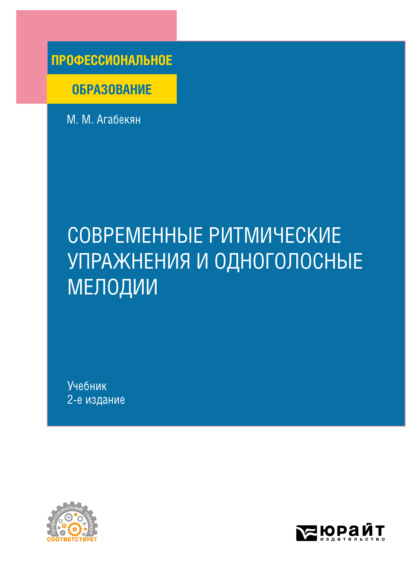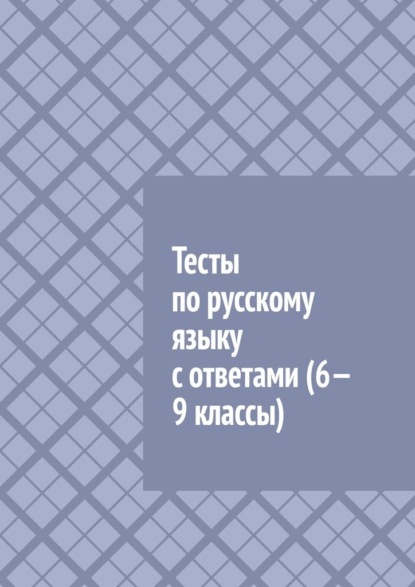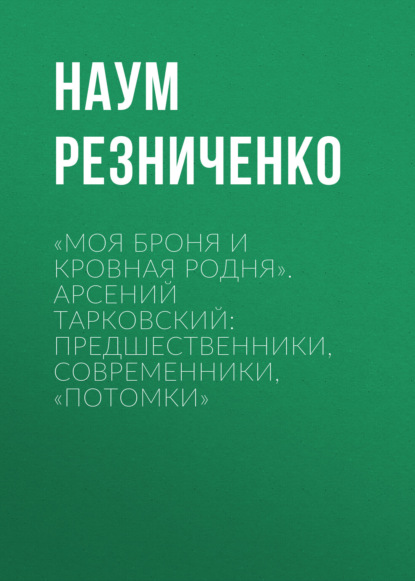Seewölfe Paket 28

- -
- 100%
- +
„Hinterher!“ brüllte Ebel, der Bärtige.
„Wohin?“ keuchte Haschira.
Ebel Schachnam trat ihm mit voller Wucht in den Hintern. „Da lang, du Dummkopf!“ Ebel wies zum Dattelwald. Als der Riese und die Blonde dort wie Schemen untergeschlüpft waren, hatte er gerade noch ihre Gestalten erkennen können.
Die Meute setzte sich in Bewegung und nahm die Verfolgung der Ungeheuer, wie sie die drei Fremden nannten, auf.
„Wir kriegen sie noch!“ stieß Haschira hervor. „Weit können sie nicht sein! Und der Gaul bricht jeden Moment zusammen!“
Güner stieß zu Ebel. Sie liefen hinter der Horde her.
„Das kann nicht sein!“ zürnte der Anführer. „Das ist ja wie verhext!“
„Es ist eine schlechte Nacht“, sagte Güner im Laufen.
„Ach, sei still! Wo ist der Wein?“
„Ich habe den Krug fallen lassen.“
„Und?“
„Der Wein ist ausgelaufen“, erwiderte der Kurde.
Ebel Schachnam stieß einen pfeifenden Laut aus, der so ähnlich klang, als habe jemand einen Dolch in einen luftgefüllten Ziegenbalg gestoßen. „Das wirst du noch bereuen!“
„Es ist nicht meine Schuld“, beteuerte der Kurde.
Sie rannten und rannten und holten die Meute ein. Ebel Schachnam setzte sich an die Spitze, wie es sich für einen Häuptling gehörte. Aber das führte auch zu nichts. Es war immer noch so dunkel, daß sich einige Kerle glatt die Köpfe an den Dattelbäumen stießen. Sie fluchten und stöhnten, und alles in allem gab die Bande kein sehr gutes Bild ab.
Das Schlimmste aber war, daß von dem Höllenweib und ihren beiden Rettern jegliche Spur fehlte. Die Nacht hatte die Gestalten verschluckt. Sie waren weg, als hätte es sie nie gegeben.
Ebel Schachnam begriff, daß es so nicht weiterging. Er blieb abrupt stehen. Güner prallte um ein Haar gegen seinen Rücken.
„Die Pferde“, sagte Ebel. „Wir brauchen die Pferde. Holt sie.“ Beim Scheitan, warum hatte er nicht gleich daran gedacht?
Ein paar Kerle, unter ihnen Haschira, eilten zum Lager zurück. So schnell es ging, wurden die Pferde von ihren Pflöcken losgebunden und in den Dattelwald geführt. Nun saßen die Räuber auf und jagten den Flüchtlingen nach.
Nach Südwesten – dort, so meinte Ebel Schachnam, mußten sie irgendwo stecken. Er würde sie schon packen! Und dann gab es keine Gnade mehr! Wer immer sie waren und so sehr sie auch jammerten, er würde ihnen eigenhändig die Haut über die Ohren ziehen.
So erbärmlich das knochige Pferd des Ritters auch wirkte, es konnte erstaunlich schnell laufen. Das Mädchen saß hinter dem Mann im Sattel und klammerte sich an der Rüstung fest.
Der Riese indessen lief – so schnell, wie man es keinem normal beschaffenen Menschen zugetraut hätte – hinter dem Reiter her. Er sah die Hinterbacken des Tieres vor sich, sie dienten ihm als Orientierungshilfe. Das Pferd hingegen wußte instinktiv, in welche Richtung es sich zu wenden hatte, um tückischen Sümpfen, Wasserlöchern und Morast zu entgehen.
Sie bewegten sich in südöstliche Richtung. Bald gelangten sie auf eine sanfte Anhöhe. Hier legten sie eine Verschnaufpause ein.
Der Ritter saß ab. Seine Rüstung klapperte, das Visier fiel zu. Er öffnete es wieder und sah das Mädchen streng an. Sie hockte wie ein Häufchen Elend auf dem Tierrücken und kaute an ihren Fingernägeln.
„Wie oft soll ich es dir noch sagen, Ludmilla?“ tadelte der Rittersmann mit blecherner Stimme. „Es hat keinen Sinn, daß du uns wegläufst. Du handelt dir nur Ärger ein.“ Wieder sprach er Holländisch.
„Ich will nach Hause“, erwiderte sie weinerlich.
„Wir werden alle drei nach Hause zurückkehren.“
„Ich will keine Datteln, ich will Milch und Käse“, sagte sie trotzig.
„Und Ton de Wit will Bier“, sagte der Riese mit grollender Stimme. „Jeder muß was entbehren.“
„Das hast du gut gesagt, mein starker Freund“, erklärte der Ritter. „Ich, Branco Fernan, der Kämpfer für die gute Sache, werde dir nie vergessen, was du alles für uns beide getan hast. Schon viermal hast du mir das Leben gerettet. Sechsmal hast du Ludmilla aus der Patsche geholfen.“
Es war zu dunkel. Anderenfalls hätte man jetzt sehen können, wie der Riese rot im Gesicht wurde.
„Das ist doch nichts Besonderes“, brummte er.
„Ludmilla“, sagte Branco Fernan zu dem schluchzenden Mädchen. „Wir kehren nur wieder nach Holland zu den Windmühlen und den Deichen zurück, wenn wir fest zusammenhalten. Begreifst du das?“
„Na klar.“
„Weißt du, wer diese Kerle sind, die dich verschleppt haben?“
„Piraten.“
„Weißt du auch, was sie mit dir vorgehabt haben?“ fragte Ton de Wit mit finsterer Miene.
Ludmilla antwortete, und die beiden Männer nickten ernst.
„Genau das“, entgegnete Branco Fernan, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Willem Smitt hieß. Da Branco Fernan aber viel besser klang, und es obendrein eines jeden Ritters Würde verlangte, daß er sich einen Kriegsnamen zulegte, hatte sich Willem dieses Pseudonym ausgedacht.
„Sie werden uns verfolgen“, sagte Ton de Wit.
„Und wir werden sie abhängen“, erklärte Branco Fernan mit stolzer Gebärde. Er ließ sein Pferd Jolante noch ein wenig grasen, dann saß er wieder auf und winkte Ton de Wit zu. „Auf zu neuen Taten! Keinem Muselmanen wird es gelingen, uns, die Recken des Herrn, zu umzingeln und niederzumetzeln! Wir sind die Heerscharen Gottes!“
Die Heerschar setzte sich wieder in Marsch. Ludmilla berichtete leise, wie sie ausgekniffen und in dem Wasserloch gelandet war, wie die wüsten Kerle sie in ihr Guffa verfrachtet und entführt hatten. Branco Fernan und Ton de Wit, der Riese, lauschten ihren Worten.
Im stillen schworen sie sich, furchtbare Rache zu üben. Vorerst aber war es besser, sich vor den Flußräubern zu verstecken. Die waren in der Überzahl und hatten auch Pferde.
Außerdem hatten sie sich inzwischen von dem Schrecken erholt, der ihnen in die Knochen gefahren war. Sie waren jetzt wieder das, als was man sie einzuschätzen hatte: blutrünstige, grausame Galgenstricke und Halsabschneider, die schon so manchen harmlosen Reisenden auf dem Gewissen hatten.
3.
Hasard hatte sich im positiven Sinn verrechnet. Nach relativ kurzer Fahrt erreichte die „Santa Barbara“ schon am frühen Morgen dieses Apriltages Korna – wo Euphrat und Tigris sich vereinigten. Alle Mann waren an Deck, als das Schiff auf die weißen Häuser des Hafenstädtchens zuglitt.
Dan O’Flynn befaßte sich noch einmal mit den Karten. Ben und Shane und ein paar andere schauten ihm dabei über die Schultern. Hasard brauchte nicht mehr auf das Kartenmaterial zu sehen, er kannte es inzwischen in- und auswendig.
„Da wären wir also“, sagte Old O’Flynn sinnigerweise. „Und was jetzt?“
„Wir haben die Wahl“, erklärte Don Juan de Alcazar. „Entweder segeln wir auf dem Euphrat oder auf dem Tigris weiter.“
Old O’Flynn grinste wie der Teufel persönlich. „Was du nicht sagst.“
„Nach Backbord in den Euphrat“, sagte der Profos. „Es ist doch letztlich egal, welchen Kurs wir wählen, was, wie? Oder ist jemand anderer Meinung? Oder hast du schon einen Plan, Sir?“
„Ich bin für Steuerbord“, sagte der Kutscher.
„Tigris?“ fragte Mac Pellew. „Warum das?“
„Der Euphrat bringt nichts Gutes.“
„Das finde ich auch“, pflichtete der alte O’Flynn dem Kutscher bei. „Wenn ich bloß an den Euphrat denke, juckt es bei mir im Beinstumpf. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen.“
Der Kutscher zog die Augenbrauen ein wenig hoch – kaum merklich. Dann erklärte er: „Tatsache ist, daß an den Ufern des Euphrats Babylon liegt.“
„Babylon?“ wiederholte Batuti. „Davon habe ich schon mal irgendwo gehört.“
Don Juan lachte. „Diejenigen von euch, die lesen können, sollten öfter mal einen Blick in die Bibel werfen.“
„Warum haben wir Pater David nicht dabei?“ rief Smoky. „Der könnte uns weiterhelfen! Kutscher, spann uns nicht so auf die Folter!“
„Ja, du Schlaukopf“, sagte auch Carberry grimmig und rückte dabei drohend auf den Kutscher zu. „Laß dir die Würmer nicht einzeln aus der Nase ziehen. Was ist los mit Babylon? Ist das Bagdad?“
„Nein“, erwiderte der Kutscher mit weisem Gesicht. „Aber es ist die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden – jedenfalls nach der Offenbarung des Johannis.“
Die Mienen der Männer waren verzückt. Palaver entstand. Alle riefen durcheinander. Die meisten hatten das Wort „Hurerei“ aufgeschnappt und drängten jetzt darauf, sofort nach Babylon zu segeln.
„Na, so was!“ röhrte auch der Profos. „Sir, ich bin unbedingt dafür, diese Stätte zu besichtigen, wenn ich das mal so ausdrücken darf!“
„Du darfst es“, sagte der Seewolf. „Aber …“
„Vielleicht treffen wir dort auch auf diesen Johannis!“ rief Higgy. „He, das muß ein feiner Kerl sein, wenn er so was geschrieben hat!“
„Der Johannis ist mir egal, mir geht’s um die Ladys!“ verkündete Stenmark.
„Ihr seid ja alle übergeschnappt!“ stieß Old O’Flynn erregt aus. „Mein Bein tut weh! Das ist ein böses Omen! Finger weg von Babylon, heißt das!“
„Du mit deinen Ahnungen!“ brüllte Carberry. „Du kannst einem alles vermiesen! Ich will nach Babylon!“
„Auf zu den Schönen, die werden sich freuen!“ rief Al Conroy.
Am Kai von Korna waren inzwischen einige Menschen zusammengelaufen. Sie sahen sich untereinander verängstigt an. Man fragte sich, was das Geschrei an Bord des fremden Seglers zu bedeuten haben mochte. Stand ein Angriff bevor? Irgend jemand benachrichtigte den Hafen. Wesir, und dieser wiederum erstattete seinem Sultan Meldung, es gäbe Ärger durch wilde Giaurs, die auf den Decks ihres Schiffes wüteten und haßerfüllt zur Stadt glotzten.
Muftis und Kadis, Händler und Fischer, Marktschreier und vermummte Frauen versammelten sich im Hafen von Korna. Mit gemischten Gefühlen verfolgte man, was sich weiterhin an Bord dieses rätselhaften, lauten Dreimasters abspielte.
Jung Hasard war mittlerweile neben seinen Vater getreten und sagte: „Dad, du erinnerst dich doch an meinen Traum?“
„Ja, du hast mir davon erzählt.“
„Wir sollten uns daran halten.“
„Das finde ich auch“, sagte der Seewolf.
„Danach führt unsere Route immer nordwärts“, sagte Hasard junior.
Sein Vater hob beide Hände und rief: „Ruhe!“
Die Mannen verstummten und blickten ihren Kapitän an.
„Sir?“ fragte Carberry.
„Unser Kurs führt nach Norden“, verkündete Hasard. „Das bedeutet auf den Tigris, denn der Euphrat biegt hier nach Westen ab.“
„Zweifellos ist das richtig“, erwiderte Ferris Tucker. „Aber der Kutscher hat uns mit Babylon einen Floh ins Ohr gesetzt.“
„Wann hast du zuletzt in der Bibel gelesen?“ fragte der Seewolf mit ungewöhnlicher Schärfe.
„Das ist schon lange her“, erwiderte der rothaarige Riese treuherzig, aber ihm war mit einemmal höchst mulmig zumute.
„Das merke ich. Sonst wüßtest du, daß Babylon nicht mehr existiert. Die Stadt und den Turm soll es vor Jahrtausenden gegeben haben, aber natürlich kann es sich auch um eine Legende handeln.“
„Was denn?“ protestierte der Profos. „Eine Legende? In der Bibel? Ich denke, es stimmt alles, was da drinsteht! Wenn Pater David hier wäre, würde ich …“
Hasard unterbrach ihn. „Er ist aber nicht da, Ed. Es gibt Gleichnisse in der Bibel, die nicht wortgetreu zu stimmen brauchen. Es geht dabei darum, anschaulich Situationen darzustellen, aus denen philosophische Schlüsse gezogen werden. Klar?“
Carberry kratzte sich am Kinn. „Klar, Sir.“
„Hat sonst noch jemand Fragen?“ wollte der Seewolf wissen.
„Keiner, Sir“, erwiderte Old Shane stellvertretend für alle. Es empfahl sich nicht, den Seewolf noch länger wegen des Babylonpalavers zu reizen. Er setzte sich durch – wie immer. Und das war gut so.
Die „Santa Barbara“ segelte an Korna vorbei und schob sich gegen die Strömung des Tigris nach Norden. In Korna atmete man auf – fast konnte man es an Bord der Galeone vernehmen.
Später standen die Mannen am Schanzkleid und blickten auf die seltsamen Boote, die ihnen entgegentrieben. Carberry, der sich wegen der Babylongeschichte und der weisen Reden des Kutschers wieder mal kräftig geärgert hatte, mußte irgendwie Dampf ablassen.
Deshalb amüsierte er sich über die flußabwärts treibenden Rundboote und Schlauchflöße.
„Hol’s der Teufel“, sagte er. „Was sind denn das für Tröge?“
„Das sind die hierzulande üblichen Wasserfahrzeuge“, erwiderte der Kutscher.
„Was du nicht sagst!“
„Sie heißen Guffas und Keleks.“
„Was für ein schlaues Kerlchen du bist!“ röhrte der Profos. „Und abends ziehen die Alis die Kähne aus dem Wasser und stellen sie sich als Nachttöpfe vors Lager?“
Die Männer lachten. Carberry ließ mal wieder seine schönsten, derbsten Witze vom Stapel.
Sir John flatterte auf und ab und krächzte wie ein Besessener. Arwenack, der Schimpanse, klatschte in die Hände und entblößte die Zähne zu einer Art Grinsen. Plymmie, die Wolfshündin, legte den Kopf schief und sah ihre Leute verdutzt an. Was war denn jetzt wieder in die gefahren?
„Das glaube ich nicht“, entgegnete der Kutscher und zog sich mit Mac in die Kombüse zurück. Sie bereiteten das Frühstück vor. Ehe der Profos zu neuen Kanonaden ausholte, war es klüger, ihm ein bißchen das Maul zu stopfen – mit Eiern und Speck.
Die Männer an Deck beobachteten, wie die Guffas und Keleks an der „Santa Barbara“ vorbeitrieben.
„Erstaunlich, was die alles laden“, sagte Shane in echter Anerkennung.
„Ja, und sie sind mit einfachsten Mitteln gebaut“, meinte Ferris Tucker. „Erfinderisch sind die Araber, das muß man ihnen lassen.“
„Was gehört schon dazu, einen Trog oder einen Nachttopf zu bauen?“ brummte der Profos.
„Was gehört dazu, ein Rad zu erfinden?“ fragte Higgy.
„Was willst du, du irischer Rotfuchs?“
„Ich meine, hast du mal darüber nachgedacht, wie schwierig es war, das Rad oder das Segel zu erfinden, als es das noch nicht gab?“ fragte Higgy.
Carberry spuckte über das Backbordschanzkleid ins Wasser und schaute einem großen Guffa nach.
„Von euren Kodderschnauzen habe ich erst mal genug“, sagte er verächtlich.
Dann verschwand er im Vorschiff, um „die Kojen zu kontrollieren“ und im Frachtraum, um die „Ladung zu überprüfen“. Wirklich, die Crew konnte einem manchmal erheblich auf den Geist gehen.
Die „Santa Barbara“ segelte weiter nordwärts. Die Entfernung nach Bagdad vermochte der Seewolf zu errechnen. Wie lange es aber noch dauerte, bis sie dort eintrafen, wußte keiner.
Mannigfach konnten die Tücken des Stromes sein. Untiefen, Klippen und Stromschnellen waren nicht berechenbar. Noch lag alles im Ungewissen. Die nächsten Tage würden ihnen offenbaren, welcher Art die Gefahren dieser Reise waren.
An Piraten dachte keiner der Männer der „Santa Barbara“ – noch nicht. Bald sollte sich dies jedoch ändern.
Ebel Schachnam hätte am liebsten um sich geschlagen, so wütend war er. Die Nacht über hatten die Kerle unablässig nach den vier Fremden gesucht – ohne Erfolg. Ein Pferd war gestrauchelt, hatte sich den rechten Vorderlauf gebrochen und mußte getötet werden.
Zwei Kerle hatten sich glatt verirrt. Jetzt, am Morgen, fanden auch sie sich wieder ein.
Aber der bärtige Anführer verspürte große Lust, sie auf der Stelle zu erdolchen. Nur bremste er sich, weil die Stimmung der Männer auch nicht besser war als seine. Was war bloß los? Alles ging schief. Lastete doch ein Fluch der Finsternis über ihnen?
„Nichts“, sagte Güner, der Kurde. Er hatte mit vier Mann einen Erkundungsritt durch den Dattelwald unternommen und war gerade ins Lager zurückgekehrt. „Der Erdboden hat diese Bastarde verschluckt.“
„Das gibt es nicht“, sagte Ebel Schachnam.
„Wir können sie nicht herbeizaubern.“
„Das weiß ich selbst“, brüllte der Bärtige.
„Was sollen wir tun?“ fragte der Kurde so ruhig wie möglich, obwohl auch er äußerst gereizt war.
„Weitersuchen!“
„Den ganzen Tag?“
„Und auch die Nacht, wenn es nötig ist!“ schrie Ebel Schachnam. „Ich will sie haben! Ich werde sie zerfetzen, vernichten!“
Güner ließ sich neben dem erloschenen Lagerfeuer auf den Boden nieder. „Warum lassen wir sie nicht laufen? Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir haben keinen Proviant und müssen dringend welchen beschaffen.“
Der bärtige Häuptling brauste sofort auf: „Du wagst es, meine Befehle zu kritisieren? Was fällt dir ein?“
Die Augen des Kurden verengten sich. „Nicht alles, was du anordnest, ist richtig, Ebel. Glaubst du etwa, du bist unfehlbar wie Allah?“
„Du Rebell!“ schrie Ebel. „Halt dein Maul! Ich verbiete dir, so zu reden!“
„Was willst du von dem Mädchen?“ erwiderte Güner unbeirrt. Seine Stimme troff jetzt vor Hohn. „Sie verprügeln, ihr die Haare abschneiden? Sie ist verrückt, hast du das nicht bemerkt? Sie ist nicht ganz richtig im Kopf.“
„Lüge! Sie hat meine Ehre befleckt!“
„Nachdem du es nicht geschafft hast, sie zu entehren“, entgegnete der Kurde.
Die Kerle waren näher herangetreten und umringten die beiden Streithähne. Spannung lag in der Luft. Ebel Schachnam war hochrot im Gesicht, seine Schläfenadern schwollen an. Plötzlich warf er sich ohne jegliche Vorwarnung auf seinen Unterführer und hieb mit beiden Fäusten auf ihn ein.
Güner rollte sich gedankenschnell zur Seite. Ebels Fäuste hämmerten auf den staubigen Boden.
Der Kurde sprang auf und rief: „Glaubst du, wir irren für jeden Blödsinn wie die Trottel durch die Gegend? Nur für dich? Du bist ein Narr! Schaff uns erst mal was zu essen ran, dann reden wir weiter!“
Der Bärtige rappelte sich auf und zückte sein Messer. „Du Bastard, das wirst du mir büßen!“
Güner zog ebenfalls seinen Dolch. „So? Versuch’s doch mal!“
Ebel Schachnam unternahm einen Ausfall und hieb mit dem Messer zu. Wieder wich der Kurde geschickt aus. Die Kerle stießen Rufe und Flüche aus. Die meisten hielten zu Güner, aber sie wagten nicht, offen aufzubegehren.
Schachnam war ihnen zu gefährlich. Sie alle hatten die Nase voll. Doch es waren die Brutalität und die Mordlust ihres Anführers, die sie fürchteten.
Güner wischte mit der Klinge seines Dolches durch die Luft. Ebel mußte zurückzucken, sonst hätte die Klinge seine Wange getroffen.
„Die Männer sind erschöpft!“ schrie der Kurde. „Sie brauchen etwas zu essen!“
„Freßt doch die Datteln!“ brüllte Ebel, der Bärtige.
„Die will keiner mehr!“
„Besser als gar nichts, du Hurensohn!“
„Was dir nicht schmeckt, schmeckt uns auch nicht!“ stieß der Kurde zornig aus.
„Und der Wein?“ schrie Ebel Schachnam. „Du hast ihn absichtlich verschüttet!“
„Lüge!“ brüllte der Kurde.
„Welcher Wein denn?“ fragte der Grinser.
Aber er erhielt keine Antwort. Alle starrten nur auf die Kämpfer. Für einen von beiden mußte das Messerduell tödlich enden. Daran gab es keinen Zweifel.
„Ich bringe dich um, du Hund!“ heulte Ebel Schachnam.
„Das schaffst du nicht!“ höhnte der Kurde.
„Verrecke!“
„Fahr zur Hölle!“
Jählings warf sich Ebel auf seinen Unterführer. Dieses Mal konnte Güner nicht schnell genug reagieren. Das Messer traf ihn. Er stöhnte auf, stieß aber selbst zu. Ebel tänzelte zur Seite. Beide Männer bluteten, aber Güner wankte stark.
„Stirb!“ brüllte der Bärtige. Er unternahm wieder einen Angriff. Noch einmal stach er auf den Kurden ein – und Güner sank blutüberströmt zu Boden. Er hob noch die rechte Hand. Der Dolch entglitt seinen Fingern. Sein Blick war auf Ebel Schachnam gerichtet. Er brach vollends zusammen und regte sich nicht mehr.
„Erledigt“, sagte Ebel Schachnam. Verächtlich spuckte er vor dem Kurden aus. „So ergeht es allen, die gegen mich anstinken wollen.“ Herausfordernd sah er seine Kerle an. „Hat noch jemand Lust, mit mir zu kämpfen?“
Keiner trat vor. Die Kerle schwiegen und hielten ihre Blicke gesenkt. Ebel grinste.
„Schmeißt den Schwachkopf in den Fluß“, sagte er. „Die Wasserratten sollen ihn fressen.“
4.
Das merkwürdige Trio schlug im verblassenden Licht des Tages am Ufer des Tigris seinen Lagerplatz auf. Die Rüstung von Branco Fernan klapperte und rasselte, als er absaß. Das Visier fiel zu. Er öffnete es wieder und schritt mit stelzenden, steif wirkenden Bewegungen auf und ab.
„Keine Schlangen“, sagte er.
„Keine Wölfe“, vermeldete Ton de Wit, der sich im Gebüsch umgesehen hatte.
„Hier gibt es doch gar keine Wölfe, du Narr“, sagte Ludmilla.
„Man kann’s nie wissen“, erwiderte der Riese. „Und du sollst mich nicht so nennen, sonst versohle ich dir den Hintern.“
„Ja, schon gut“, flüsterte das Mädchen.
Der Riese hatte sie schon einmal verhauen, als sie zu aufsässig geworden war. Davon hatte sie jetzt noch genug.
„Hier laßt uns rasten“, sagte Branco Fernan. „Hier laßt uns Burgen bauen und seßhaft werden.“
Ludmillas Augen weiteten sich. „Ist das dein Ernst?“
„Wir wollen die Ungläubigen in aller Welt bekehren.“
„Und ich will nach Hause.“
„Der Tag ist nicht mehr fern, mein Kind, an dem du deine Windmühlen wiedersehen wirst, das habe ich dir versprochen.“ Branco Fernan sah sie streng an. „Habe ich dich jemals angelogen?“
„Nein.“
Ton de Wit grinste. Er hatte ein paar Datteln aufgelesen und hielt sie dem Mädchen vor die Nase. „Willst du mal kosten?“
„Hau bloß mit deinen Datteln ab!“
„Lieber ein Stück Pökelfleisch?“ fragte der Riese.
„Ja.“
Während sie gemeinsam ihr karges Abendessen vorbereiteten, dachte Ludmilla nach. Schon oft hatte sie sich die Frage gestellt, ob dieser Branco Fernan, der eigentlich Willem Smitt hieß, richtig im Kopf war. Was er eigentlich in diesem Land am Euphrat und Tigris wollte, war ihr immer noch nicht klar.
Sie hatte ihn in Holland kennengelernt. Ludmilla war vor zwei Jahren von zu Hause ausgerissen. Das Auskneifen war ihr sozusagen mit in die Wiege gelegt worden. Es war ihre fixe Idee. Immer wieder mußte sie einfach abhauen, ganz gleich, wo sie gerade war.
Ton de Witt hatte einmal gesagt, sie habe das Wesen einer streunenden Katze.
Nun, Ludmilla war in einem Bordell von Den Haag gelandet. Es wäre ihr schlecht ergangen – die Kerle in dem Freudenhaus benahmen sich wie die Tiere. Aber plötzlich erschien dieser Ritter Branco Fernan und forderte die Huren auf, ihr fluchwürdiges Leben aufzugeben. Anderenfalls würde Gott sie furchtbar strafen.
Natürlich hatten die ausgekochten Huren gelacht und dem Kerlchen ihre Dienste angeboten. Aber Ludmilla hatte die Gelegenheit beim Schopf gepackt und war mit dem Männchen ausgekniffen. Die Bordellmutter hatte sie zwar keifend verfolgt, aber plötzlich war Ton de Wit zur Stelle gewesen.
Eine Maulschelle des Riesen hatte genügt, und die Madam war heulend in ihr gastliches Haus geflüchtet. Ludmilla war bei Branco und Ton geblieben.
Sie hatte erfahren, daß die beiden aus der tiefsten Provinz stammten. Der Riese war schon immer Branco Fernans Diener gewesen. Er war ihm treu ergeben. Irgendwann hatten sie den Plan gefaßt, durch die Lande zu ziehen, um Heiden zu bekehren. Gott habe ihm diesen Auftrag erteilt, behauptete der Ritter.
So hatte man zu dritt Holland verlassen und war mit dem Pferd quer durch Europa gezogen. Ludmilla kannte sich in der Erdkunde nicht aus. Was das für Länder waren, durch die sie gereist waren, wußte sie immer noch nicht recht. Deutschland, Ungarn, Griechenland und die Türkei – noch nie hatte sie früher von solchen Plätzen und Namen gehört.
Aber sie vertraute diesem Eisenmann, so seltsam er sein mochte. Er brachte einem eher das Lachen als das Fürchten bei, und doch spürte sie tief in ihrem Inneren, daß er ein aufrichtiger und guter Mann war, der nur das Beste wollte.
Verrückt war er wohl nicht. Ton de Wit war auch kein Blödian, obwohl er meistens dummes Zeug redete, sobald er den Mund auftat. Aber irgendwie fühlte sich das Mädchen wohl bei ihnen. Nie wäre es den beiden Männern eingefallen, sie unsittlich anzufassen, Sie benahmen sich wie die Mönche.
Nur manchmal packte Ludmilla eben das Heimweh. Sie seufzte. Wollte sie wirklich nach Hause zurück? Doch, gewiß. Schon allein wegen der feinen Sachen, die es dort zu essen gab.