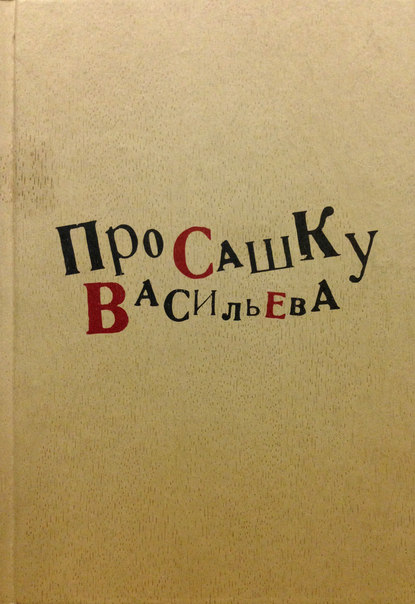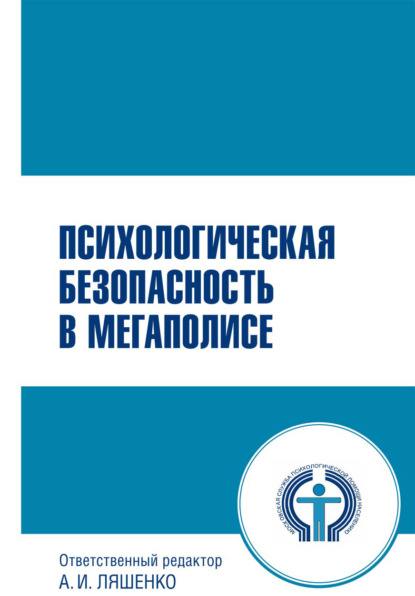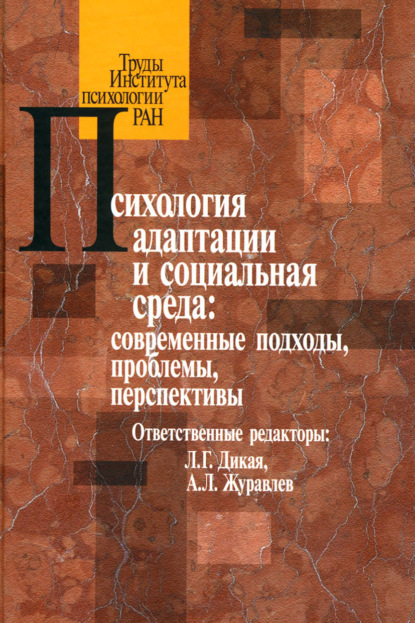Seewölfe Paket 30

- -
- 100%
- +
Die Idylle am Strand fand ein jähes Ende.
Margarida riß sich spontan von Felipe los und stieß einen lauten Schrei aus. Fast gleichzeitig preßte sie eine Hand auf den Mund, weil ihr bewußt wurde, daß sie einen schweren Fehler begangen hatte.
Felipe fuhr wie von einer Tarantel gestochen herum.
„Bei Gott – was ist los, Margarida?“ stieß er hervor.
Eine Antwort erübrigte sich, denn jetzt sah auch er jene unheimlichen Gestalten, die sich lautlos über den Strand bewegten und unverkennbar die Richtung zum Dorf eingeschlagen hatten.
Eigentlich handelte es sich nur um Schemen, die sich ohne Bewegung kaum von der Dunkelheit abheben würden. Und merkwürdigerweise sahen sie alle gleich aus – schwarz, düster und geheimnisvoll.
Felipe packte Margarida blitzschnell am Arm, um sie hinter einen Felsbrocken zu ziehen.
„Sei ganz still!“ zischte er.
Aber seine Ermahnung erfolgte zu spät. Margaridas Schrei hatte die Gestalten auf das lauschige Plätzchen hingewiesen, das ihnen seit Monaten als Treffpunkt diente.
Einige Schatten hatten sich bereits aus der Schar gelöst und eilten, die Deckung der Felsen ausnutzend, auf das Versteck der beiden jungen Leute zu.
„O Santa Maria!“ entfuhr es Margarida. „Sind das Geister, Felipe?“ Sie kauerte bebend vor Angst am Boden und klammerte sich an den jungen Fischer.
„Bestimmt nicht“, erwiderte Felipe. „Wir müssen verschwinden. Du hättest nicht schreien dürfen, Margarida.“
Felipe nahm das Mädchen an der Hand und zog es eilig hinter sich her. Er war sich darüber im klaren, daß es völlig sinnlos war, sich jetzt noch verstecken zu wollen. Außerdem konnte er allein und ohne Waffe nichts gegen diese finstere Schar ausrichten.
Die beiden jungen Leute liefen, so schnell sie die Beine trugen. Sie eilten über Geröll und Sand, vorbei an zerklüfteten Felsen und spärlichem Gestrüpp. Sie kannten den Weg zu dem nahegelegenen Fischerdorf, das sich kaum wahrnehmbar an das Ufer einer kleinen Bucht schmiegte, sehr genau und fanden sich auch in der Dunkelheit gut zurecht.
Trotzdem gelangten sie nicht weit.
Nur dreißig Schritte von ihnen entfernt, schienen plötzlich einige dieser unheimlichen Schatten aus dem Boden zu wachsen. Sie waren in schwarze Kutten gehüllt, ihre Köpfe wurden von spitzzulaufenden Kapuzen verdeckt. Felipe konnte nicht verhindern, daß auch ihm bei diesem Anblick ein eiskalter Schauer über den Rücken lief.
Doch für Überlegungen blieb keine Zeit. Von diesen Gestalten ging Gefahr aus, das fühlte er instinktiv. Er versuchte deshalb nach rechts auszuweichen und zog Margarida mit festem Griff hinter sich her.
Aber auch dort tauchten plötzlich die gespenstischen Kapuzenmänner aus der Dunkelheit hervor und schnitten ihnen den Weg ab.
Die beiden jungen Leute stoppten jäh ihre Schritte. Felipe suchte krampfhaft nach einem Ausweg, aber den gab es nicht mehr, man hatte sie regelrecht umzingelt.
Margarida begann zu schluchzen und drängte sich schutzsuchend an den jungen Fischer. Er spürte deutlich ihr Zittern und legte die Arme um sie.
„Sei ganz ruhig, Margarida“, sagte er, „niemand wird dir etwas tun.“
Die Lippen des Mädchens bebten. „Es – es sind Gespenster, Felipe, glaube mir …“
Der Mann schüttelte energisch den Kopf, obwohl auch er sich im stillen eingestehen mußte, daß ihm die Situation alles andere als geheuer war.
„Ich glaube, es sind Mönche“, sagte er – immer darauf bedacht, das Mädchen zu beruhigen.
Die Kuttenträger standen still und reglos wie Zaunpfähle in der Landschaft. Sie schienen sich ihrer Überlegenheit absolut sicher zu sein.
Während Margarida leise wimmerte, huschten Felipes Blicke gehetzt hin und her. Hinter seiner Stirn jagten sich die Gedanken. Was waren das für merkwürdige Gestalten? Handelte es sich tatsächlich um Mönche? Wenn ja – was suchten sie dann zu dieser nächtlichen Stunde hier am Strand? Und warum hatten sie zuvor den Weg zum Dorf eingeschlagen?
Felipe fand keine Antwort auf diese Fragen, aber er verspürte den dringenden Wunsch, eine Entscheidung herbeizuführen. Er wollte endlich wissen, was hier gespielt wurde.
Er strich Margarida abermals beruhigend über das Haar, dann durchbrach er mit fester Stimme die bedrückende Stille.
„Wer seid ihr?“ fragte er. „Und was wollt ihr von uns? Wenn ihr Männer Gottes seid, dann benennt euren Orden und gebt uns um Christi willen euren Segen, damit wir in Frieden in unser Dorf zurückkehren können. Wenn ihr aber Böses im Schilde führt, dann bedenkt, daß wir arme Fischer sind. Wir besitzen nichts, was für euch von Wert sein könnte …“
Felipe, der all seinen Mut in diese Worte gelegt hatte, wurde jäh unterbrochen.
Einer der unheimlichen Mönche trat einen Schritt vor und zog einen Dolch unter der Kutte hervor. Das fahle Licht des Mondes spiegelte sich im blanken Metall der Waffe.
„Wir sind zwar keine Betbrüder“, sagte er mit rauher Stimme, „aber unseren Segen sollt ihr trotzdem erhalten.“
Das spöttische Gelächter, das jetzt folgte, ließ selbst Felipe die Haare zu Berge stehen. Bei allen Heiligen – der beißende Hohn, der Triumph, Kälte, Skrupellosigkeit und Mordlust zum Ausdruck brachte, konnte fürwahr nicht den Kehlen frommer Männer entspringen. Es schienen vielmehr die Schlünde der Hölle zu sein, die sich hier draußen am Strand geöffnet hatten.
2.
Über dem Golf von Cádiz verdichtete sich die Dunkelheit mehr und mehr zu einem dunstigen Schleier. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Nebelschwaden von der Wasserfläche aufsteigen würden.
Philip Hasard Killigrew, der Seewolf, stand unterhalb der weitausladenden Heckgalerie und ließ seine eisblauen Augen prüfend über das langgezogene Deck der Schebecke wandern.
Der Wind hatte gedreht und wehte jetzt genau aus Südosten. Das bedeutete für das wendige Schiff, dessen Bug in nordwestliche Richtung zeigte, daß es platt vor dem Wind laufen konnte. Segelmanöver waren kaum noch erforderlich, das prallgefüllte Tuch der Lateinersegel trieb die Schebecke rasch voran.
Old Donegal Daniel O’Flynn stakte mit seinem Holzbein über die Planken. Er hielt vor Hasard und fuhr sich mit einer Hand über das von Wind und Sonne gegerbte Gesicht.
„So still wird das nicht bleiben, Sir“, sagte er. „Ich kann die Dons regelrecht riechen.“
Der Seewolf lächelte. „Ich rieche zwar nur das Wasser, aber deine Vermutung teile ich durchaus, Donegal.“
Der rauhbeinige Alte nickte zufrieden, und für kurze Zeit wirkte sein Gesicht sogar eher nachdenklich als grimmig.
„Eigentlich kann man den Dons nicht verdenken, daß sie so scharf auf uns sind. Für die wären wir ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, wie tief der gute Philipp wegen uns in seine Schatzkiste greifen müßte.“
„Er hat eben die richtige Wertschätzung für uns“, meinte der Seewolf ironisch. Gemeinsam mit Old Donegal ging er zum Vorschiff.
Dort versuchte gerade Mac Pellew, der den Kutscher als Koch und Feldscher unterstützte, eine Mängelrüge an den bulligen Paddy Rogers loszuwerden. Dieser hatte vor einigen Stunden im Auftrag des Schiffszimmermanns die Tür eines Kombüsenschapps repariert.
„Da bist du ja“, sagte Mac. „Ich war schon nahe dran, dich aus der Koje zu holen.“ Der nörgelnde Unterton in seiner Stimme war nicht zu überhören.
Der im Denken etwas langsame Paddy blickte ihn verständnislos an.
„Mich – aus der Koje holen?“ fragte er. „Wieso das denn? Ich hatte Freiwache. Außerdem habe ich fest geschlafen.“
„Das habe ich auch schon festgestellt“, entgegnete der griesgrämige Mac, „zumal du wie ein schwindsüchtiges Walroß geschnarcht hast. Ich habe ja weiß Gott nichts dagegen, wenn jemand nach harter Arbeit in süßen Schlummer sinkt …“
„Dann ist ja alles in Butter“, unterbrach ihn Paddy mit strahlendem Gesicht. „Ich habe dein verdammtes Schapp repariert und dann in meiner Koje geschlummert.“
Der meist etwas sauertöpfische Mac, der schon unter Francis Drake auf der „Marygold“ Zähne gezogen, Knochen geflickt und Schweine geschlachtet hatte, stemmte die Fäuste in die Hüften.
„Höre ich recht?“ fragte er. „Du nennst das, was du in der Kombüse angerichtet hast, eine Reparatur?“
Paddy rieb seine Knollennase.
„Jawohl, das tu’ ich“, erwiderte der trotzig. „Ich bin, was den ganzen Holzkram betrifft, zwar nicht so bewandert wie Ferris, aber du wirst mir trotzdem nicht vorwerfen können, daß die Tür noch klemmt.“
„Da hast du allerdings recht.“ Macs Gesicht glich jetzt einer verschrumpelten Zitrone. „Die Tür hat auch gar keine Gelegenheit mehr, zu klemmen, weil sie sich nach deiner sogenannten Reparatur überhaupt nicht mehr schließen läßt. Kein Wunder, daß schon beim geringsten Seegang das Geschirrzeug aus dem Schapp fliegt.“
Paddy Rogers kriegte einen hochroten Kopf. „Das kannst du mir nicht erzählen – nicht, nachdem ich mir wegen deiner verdammten Tür zweimal auf den linken Daumen geklopft habe. Ich werde das überprüfen.“
Mac vollführte eine abwehrende Geste. „Gar nichts wirst du. An meine Schapps lasse ich dich nicht mehr heran. Die werde ich in Zukunft hüten wie ein Vater seine unschuldigen Töchter.“
Die Arwenacks konnten ihr Lachen nicht länger zurückhalten.
Edwin Carberry rieb sich das stoppelbärtige Amboßkinn und grinste von einem Ohr bis zum anderen. Sein narbiges Gesicht sah dabei zum Fürchten aus.
„Du solltest dich jetzt wirklich um deine unschuldigen Töchter kümmern, du menschlicher Rührlöffel“, sagte er zu Mac. „Wie ich dich nämlich kenne, bruzzeln die in Form von leckeren Speckpfannkuchen in der Pfanne und brennen an, während du Paddy von der Arbeit abhältst.“
Mac erschrak heftig. Für einen Augenblick schien es, als sei er zur Salzsäule erstarrt.
„Ach, du heiliger Bimbam!“ entfuhr es ihm. Im selben Moment wirbelte er herum und stürzte in die Kombüse.
„Habe ich’s nicht gleich gesagt?“ röhrte der Profos. „Jetzt läuft er mit einer qualmenden Bratpfanne um die Wette.“
Die Mannen bogen sich vor Lachen. Am lautesten aber lachte Paddy, weil er sich plötzlich von dem nörgelnden Koch befreit sah. Und außerdem – ob das Schranktürchen ein bißchen klemmte oder nicht, das durfte man seiner Meinung nach nicht überbewerten.
Doch Carberry sah das anders, und bevor sich der gute Paddy versah, trat der Profos bereits in die Fußstapfen Mac Pellews. Genauer gesagt: Er fing dort an, wo der Koch aufgehört hatte.
Nachdem sich der Profos nachhaltig geräuspert hatte, richtete er seinen hochamtlichen Blick wie eine Schwertspitze auf Paddy.
„Jetzt aber zu dir, du abgekochte Rapunzel. Warum hast du das Türchen nicht einfach ausgehängt und über Bord geworfen, wenn du ein Stück Holz nicht von einem Kohlkopf unterscheiden kannst?“
Paddy schickte einen hilfesuchenden Blick in den nächtlichen Himmel und faltete die riesigen Pranken, als wolle er vor dem Verzehr der angebrannten Pfannkuchen das Tischgebet sprechen.
„Fang du nicht auch noch an!“ stieß er hervor. „Das verdammte Türchen ist in Ordnung. Ich habe ihm sogar einen völlig neuen Rahmen verpaßt. Wenn es plötzlich nicht mehr schließt, dann – ja dann muß eben am Schapp selber was schief sein.“
„Mir scheint, mein lieber Paddy“, sagte der Profos, „daß eher an dir etwas schief ist. Jawohl, ich hab’s auch schon! Die Knollenrübe, die du in deinem lieblichen Gesicht trägst, ist es nicht, aber deine Klüsen sind es. Mir ist das schon vor längerer Zeit aufgefallen, aber jetzt erst bin ich mir sicher: Seit wir bei den Zopfmännern in China waren, hast du nämlich Schlitzaugen. Da staunst du, was? So richtig schön schräggestellte Schlitzaugen. Natürlich kann man mit solchen Klüsen nicht gerade sehen, und damit haben wir auch schon die Erklärung für das schiefe Türchen.“
Paddy stierte den Profos an, als seien dem Hörner aus dem Kopf gewachsen.
„Das gibt es doch gar nicht!“ stieß er hervor, und seine Finger betasteten beide Augen.
Der Profos winkte ab.
„Mit schiefen Fingern kann man nicht feststellen, ob die Klüsen gerade sind“, erklärte er. „Außerdem: Wenn ich dir sage, daß du Schlitzaugen hast, dann hast du sie auch!“
Paddy schüttelte verzweifelt den Kopf!
„Das gibt es nicht“, wiederholte er. „Du – du müßt dich irren, Mister Carberry. Ich meine, jetzt bei Nacht kannst du das auch gar nicht so genau sehen …“
„Ich hab’s schon gestern am Tag gesehen“, unterbrach ihn der Profos, „und all die Wochen vorher auch. Es sind ja schon etliche Monate ins Land gegangen, seit wir bei den Gelbmännern waren.“
Der bullige Paddy schluckte hart. „Und – und von was kommt das?“
„Woher soll ich das wissen?“ Der Profos zuckte mit den Schultern. „Vielleicht ist das ansteckend. Du kannst ja mal den Kutscher fragen. In irgendeinem schlauen Buch findet der bestimmt eine Erklärung dafür.“
Der Seewolf, der die letzten Ausführungen Carberrys mitgekriegt hatte, preßte zunächst die Lippen zusammen, um nicht laut lachen zu müssen. Dann aber warf er dem Profos einen tadelnden Blick zu.
„Mein lieber Ed“, sagte er, „findest du nicht auch, daß du es anderen überlassen solltest, sich mit ansteckenden Krankheiten zu beschäftigen?“
„Klar, Sir“, erwiderte Carberry. „Ich habe normalerweise ja auch gar keine Zeit für solchen Kram. Aber irgendeiner mußte diesem karierten Affenarsch doch endlich mal sagen, daß er windschiefe Klüsen hat, und zwar seit wir in China neue Knallerbsen einkauften.“
Bevor der Seewolf auf Carberrys Feststellungen eingehen konnte, wandte sich Paddy hilfesuchend an ihn.
„Sir“, sagte er, und seine Stimme klang beinahe flehend, „ich brauche dringend einen Spiegel. Wenn das stimmt, was Mister Carberry gesagt hat, halten mich alle für einen Chinesen.“
„Keine Angst, Paddy“, erwiderte Hasard grinsend. „Noch hast du keinen Zopf, der gehört nämlich auch dazu. Und ich hoffe nicht, daß Zöpfe genauso ansteckend sind wie Schlitzaugen. Im übrigen habe ich einen kleinen Spiegel, der steht dir selbstverständlich zur Verfügung.“
„Oh, vielen Dank, Sir.“ Paddy atmete trotz seines schweren Schicksals erleichtert auf, aber sobald er sich unbeobachtet wähnte, betastete er seinen Hinterkopf. Er konnte jedoch nichts feststellen, was auf das Wachsen eines Zopfes hindeutete.
Dem Seewolf aber lagen in dieser Nacht ganz andere Dinge am Herzen als Schlitzaugen und Chinesenzöpfe. Die Nähe des spanischen Festlandes stellte eine ständige Gefahr dar, die nicht unterschätzt werden durfte. Hinzu kam die zunehmende Nebelbildung, die die Sicht der Männer im Ausguck stark beeinträchtigte. Die von der Wasserfläche aufsteigenden grauen Schwaden vermischten sich mit der Dunkelheit und bildeten stellenweise kaum noch durchschaubare Dunstwände.
„Leichentücher“, murmelte Old Donegal mit starrem Blick, „richtige Leichentücher.“ Er deutete auf einige Schwaden, die dicht über dem Wasser schwebten.
Hasard überließ ihn seinen Gedanken, mit denen er wieder einmal jenseits der Kimm zu weilen schien – in stummer Zwiesprache mit Windsbräuten und Wassermännern. Er wandte sich indessen Al Conroy zu.
„Alles in Ordnung, Al?“ fragte er.
Der schwarzhaarige Stückmeister nickte.
„Wenn es sein muß, sind wir im Handumdrehen gefechtsbereit, Sir. Wenn es den Dons einfallen sollte, erneut ihre Finger nach uns auszustrecken, werden wir ihnen ganz schön was draufgeben.“
Der Seewolf wußte, daß er sich auf diese Worte verlassen konnte – wie überhaupt auf seine ganze Crew, die wie Pech und Schwefel zusammenhielt.
Die Armierung des schlanken Dreimast-Seglers gab Al Conroys Worten den nötigen Rückhalt. Die Seewölfe hatten keinen schlechten Griff getan, als sie nach dem Verlust ihrer Dubas diese Schebecke vereinnahmt hatten. Waren vorher algerische Piraten mit ihr im Mittelmeer auf Plünderfahrt gegangen, so lehrten jetzt die Arwenacks mit dem schnellen Segler den spanischen Häschern das Fürchten.
Als sich der Seewolf wieder nach achtern wandte, wo Pete Ballie am Ruder stand, kam Ferris Tucker auf ihn zu und hielt seine linke Hand in die Höhe. Auf den ersten Blick sah es aus, als winke er jemandem.
„Was gibt es, Ferris?“ Hasard warf ihm einen erstaunten Blick zu.
Der rothaarige Schiffszimmermann grinste. „Nicht der Rede wert, Sir. War nur ein kleiner Arbeitsunfall.“
„Was ist passiert?“
„Bei den Reparaturen am Backbordschanzkleid ist mir ein Holzsplitter in den Unterarm gefahren. Der Kutscher hat das mit seinem Quacksalberwerkzeug und Salben wieder in Ordnung gebracht. Er sagte, ich solle den Arm hochhalten, um die Blutung zu stillen.“
Der Seewolf schüttelte den Kopf. „Seit wann reparierst du mitten in der Nacht das Schanzkleid?“
„Es ist schon am Abend passiert“, erwiderte Ferris. „Nur hat es in der Nacht eine kleine Nachblutung gegeben, und der Kutscher wollte sich den Kratzer noch mal ansehen. Paddy hat mich würdig vertreten und schon gestern abend die noch anstehenden Arbeiten übernommen.“
„Das habe ich bereits mitgekriegt.“ Hasard grinste.
Der rothaarige Riese verholte sich zum Vorschiff. Wie es schien, nahm alles an Bord seinen gewohnten Gang, und daran änderte sich auch bis zum übernächsten Glasen der Schiffsglocke nichts.
Erst als die ersten hellen Schatten am Horizont den neuen Tag ankündigten, tönte die Stimme Bills aus dem Ausguck.
„Deck!“ rief er. „Schiff Steuerbord voraus auf Parallelkurs!“
Philip Hasard Killigrew hob das Spektiv ans Auge. Es war schwer, in der Nebelwand einige „Gucklöcher“ zu finden. Aber schließlich entdeckte auch er ein Licht, das langsam über das Wasser zu schweben schien. Es konnte sich nur um die Hecklaterne eines Schiffes handeln – höchstwahrscheinlich eines spanischen Schiffes.
Der Seewolf setzte den Kieker ab.
„Al!“ rief er.
„Aye, Sir?“
„Wir machen gefechtsklar. Alle Mann auf Stationen!“
Innerhalb weniger Augenblicke herrschte von vorn bis achtern rege Betriebsamkeit.
3.
Margarida zitterte wie Espenlaub. Hatten ihr die starken Arme und die beruhigenden Worte Felipes zunächst noch ein vages Gefühl von Sicherheit vermittelt, so wurde sie jetzt von Angst beherrscht.
Kaum war das schaurige Gelächter der unheimlichen Mönche verhallt, begannen sich die finsteren Gestalten zu bewegen. Der Kreis, der sich um das junge Liebespaar gebildet hatte, wurde enger und enger, und der Kuttenmann, der bereits einen Dolch in der Hand hielt, rief einen kurzen Befehl.
„Ruhig, ganz ruhig, Margarida“, flüsterte Felipe. „Ich werde nicht zulassen, daß dir etwas geschieht. Wenn sie noch einige Schritte näher heran sind, läufst du los, und zwar nach rechts. Dort klafft die größte Lücke in ihrem Kreis. Lauf, so schnell du kannst, zum Dorf, ich werde inzwischen versuchen, die Kerle aufzuhalten.“
Margarida klammerte sich noch enger an ihn.
„Nein, Felipe, ich bleibe bei dir, was auch immer geschehen mag.“
Der junge Fischer versuchte ihre Arme mit sanfter Gewalt von seinem Nacken zu lösen.
„Sei vernünftig, Margarida. Wir müssen es versuchen, auch um unserer Familien willen. Es geht nicht nur um unsere Sicherheit, auch das Dorf muß gewarnt werden.“
„Schon gut, Felipe“, flüsterte das Mädchen. „Ich werde alles tun, was du sagst. Möge die heilige Jungfrau dich beschützen.“
Felipe hauchte einen raschen Kuß auf ihre Lippen, dann sagte er: „Jetzt, Margarida – jetzt lauf los!“
Das Mädchen gehorchte. Ihre Hände glitten von seinen Schultern, dann fuhr die schlanke Gestalt herum und eilte leichtfüßig wie ein Reh über das Geröll.
Felipe versuchte, die Mönche abzulenken. Er bückte sich blitzschnell und griff nach einigen faustgroßen Steinen.
„Wenn ihr keine Männer Gottes seid, dann geht zum Teufel!“ rief er mit lauter Stimme. Fast gleichzeitig holte er weit aus und schleuderte den ersten Stein.
Der Kerl mit dem Dolch versuchte dem Wurfgeschoß auszuweichen, aber da er offensichtlich nicht mit dieser Reaktion gerechnet hatte, schaffte er es nur teilweise.
Der Steinbrocken erwischte ihn an der rechten Schulter und riß ihn ein Stück um die eigene Achse. Hätten ihn nicht zwei seiner Kumpane aufgefangen, wäre er unweigerlich zu Boden gegangen.
Während ein ächzender Laut über seine Lippen drang, löste sich der Dolch aus seiner Hand und fiel auf die Erde. Gleich darauf bedachte der Kapuzenträger den jungen Fischer mit einem wütenden Fluch.
Felipe warf bereits den nächsten Stein. Er kämpfte den Kampf des Verzweifelten und war sich darüber im klaren, daß er sich diese teuflischen Männer nicht auf Dauer vom Leib halten konnte. Seine ganze Sorge galt jedoch Margarida. Er war bereit zu sterben, wenn nur das Mädchen es schaffte, ins Dorf zu fliehen.
Kraftvoll beugte er sich zurück und schleuderte den gespenstischen Gestalten den dritten Steinbrocken entgegen. Ein lauter Schmerzensschrei bestätigte ihm, daß er sein Ziel nicht verfehlt hatte. Noch während er sich bückte, um weitere Steine aufzuraffen, sah er, wie einige der Mönche mit langen Sätzen auf Margarida zueilten.
„Lauf, Margarida, lauf!“ schrie er.
Die ranke Gestalt des Mädchens flog wie ein heller Schatten durch die Nacht. Aber sie hatte dennoch keine Chance, den Kreis zu durchbrechen. Noch bevor sie durch die Lücke schlüpfen konnte, wurde sie von zwei Kapuzenmännern gepackt.
Das laute Schreien Margaridas ließ Felipe erschauern. Seine schwache Hoffnung, daß sie es schaffen würde, hatte sich nicht erfüllt. In einem letzten Aufbäumen warf er den heranstürmenden Gestalten die beiden Steinbrocken entgegen, die er noch aufgehoben hatte.
„Ihr Teufel!“ brüllte er. „Laßt das Mädchen los, sie hat euch nichts getan!“
Innerhalb von wenigen Augenblicken wurden seine Rufe ebenso erstickt wie die lauten Schreie Margaridas. Felipe spürte einen harten Schlag gegen das Kinn, dann torkelte er zwei Schritte zurück und prallte gegen eine unsichtbare Mauer aus Menschenleibern. Nachdem ihm ein weiterer kräftiger Fausthieb wie ein Geschoß in die Magengrube gefahren war, sackte er mit einem Aufstöhnen zu Boden.
Einen Augenblick kauerte er zusammengekrümmt und etwas benommen auf dem Geröll, dann wurde er von derb zupackenden Fäusten hochgerissen.
Ein Kapuzenmann hielt ihm ein Messer vor die Brust.
„Schluß jetzt, Freundchen!“ zischte er. „Wenn du noch ein einziges Mal muckst, bist du dran. Und deine hübsche Freundin ebenfalls.“
Trotz dieser Drohung versuchte sich Felipe loszureißen.
„Zur Hölle mit euch!“ stieß er hervor. „Was wollt ihr von uns? Laßt wenigstens Margarida in Ruhe …“
Ein schmerzhafter Fausthieb zwang ihn erneut in die Knie.
„Ein hübsches Vögelchen, deine Margarida“, höhnte der Kerl, der ihn niedergeschlagen hatte. „Wenn das Mädchen vernünftig ist, wird es noch eine große Zukunft vor sich haben.“ Er unterstrich seine Worte mit einem meckernden Lachen, in das seine Komplicen mit einstimmten.
Felipe sah ein, daß er nicht die geringste Chance gegen diese Burschen hatte. Es blieb ihm vorerst nichts anderes übrig, als sich in sein Schicksal zu fügen und abzuwarten, was die vermeintlichen Mönche bezweckten.
Wie aber erging es Margarida? Ein rascher Blick nach rechts zeigte ihm, daß auch sie sich endgültig in der Gewalt dieser Männer befand. Schluchzend rief sie nach ihm, doch er konnte ihr nicht helfen. Erst als ihr einer der Kerle die Hand auf den Mund preßte, erstarb ihre Stimme.
Der Anführer zischte abermals einige knappe Befehle, und von da an ging alles ziemlich schnell. Felipe und Margarida wurden die Hände auf den Rücken gefesselt, dann brachen vier der Kapuzenmänner mit ihnen in die Richtung auf, aus der die finsteren Gestalten erschienen waren. Die übrigen Männer setzten ihren ursprünglichen Weg fort, der zu dem kleinen Fischerdorf führte.
Die Wolken verdichteten sich. Das Licht, mit dem der Mond die einsame Landschaft überschüttete, wurde immer spärlicher. Es wurde kühler. Die frische Brise, die vom Atlantik herüberwehte, roch nach Salz und Tang.
Nach einem kurzen Fußmarsch nahmen Felipe und Margarida die dunklen Umrisse eines Schiffes wahr, das nicht weit vom Strand entfernt vor Anker lag.