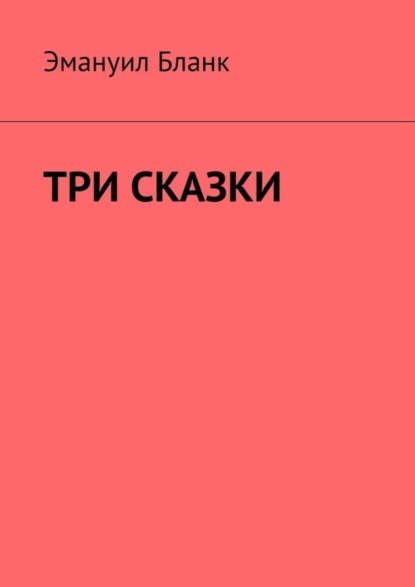Seewölfe Paket 30

- -
- 100%
- +
Antonio Gonzales nickte zustimmend und bedachte den erwähnten Rodrigo, der gerade die Kuhl überquerte, mit einem kurzen Blick. Der Mann war groß und ausgesprochen dürr, deshalb wurde er meist nur „Sensenmann“ genannt. Er verstand es wie kein anderer, die Zuhörer zu fesseln. Rodrigo Sanchez konnte nahezu alles verkaufen, weil er stets die richtigen Worte fand.
O ja, Bruder Antonio war stolz auf seine Mannen. Dabei war es gerade der bunt zusammengewürfelte Haufen, der – wenn man einmal von den Mönchskutten absah – die „São Pedro“ als das kennzeichnete, was sie tatsächlich war: ein Piratenschiff.
Seit mehr als zwei Jahren verließen die Schnapphähne immer wieder auf der Karavelle ihren Schlupfwinkel, um Beute zu schlagen. Seit dieser Zeit war Gonzales der Kapitän des Schiffes.
Früher war es im Besitz eines französischen Kaufmanns gewesen, der als Geizkragen verschrien war. Deshalb hatte Gonzales, der die meuternde Mannschaft hinter sich wußte, ihm bei passender Gelegenheit ein Messer in den Rücken gestoßen.
Erst eine Weile danach war ihm – getreu dem alten Seeräubermotto „Tarnen und Täuschen“ – die Idee eingefallen, ein „Kloster“ zu gründen und mitsamt seinen Kumpanen unter den Deckmantel der Mönchskutte zu schlüpfen.
Antonio Gonzales prüfte mit einem raschen Blick den Stand der Sonne, dann wandte er sich abermals dem kleinen und stämmigen Fernandez zu.
„Vielleicht solltest du dich darum kümmern, daß unsere Hühnerschar in der Vorpiek was zwischen die Zähne kriegt, Miguel.“
Fernandez legte die Stirn in Falten.
„Jetzt schon?“ fragte er. „Willst du unseren gesamten Proviant an die Weiber verfüttern?“
„Das nicht unbedingt“, erwiderte Gonzales grinsend. „Aber wenn wir uns nicht selbst das Geschäft verderben wollen, müssen wir darauf achten, daß die hübschen Täubchen nicht vom Fleisch fallen. Du weißt, daß Abdullah nicht nur nach Aussehen, sondern auch nach dem Gewicht der Ware zahlt. Die Barbaresken lieben nun mal üppige Weiber, daran können wir nichts ändern.“
Über Fernandez’ Gesicht huschte ein spöttischer Zug.
„Klar, du hast recht“, sagte er. „So gesehen, sollten wir die Vögelchen sogar noch ein wenig mästen, damit sie was auf die Waage bringen.“
Die beiden Schnapphähne sprachen von den dreizehn jungen Mädchen, die sie in die Vorpiek gesperrt hatten. Sie alle waren bei dem heimtückischen Überfall auf das an der Atlantikküste gelegene Fischerdorf Santa Maria erbeutet worden.
Zu ihnen gehörte Margarida, die sie zusammen mit dem jungen Burschen namens Felipe am nächtlichen Strand überrascht hatten.
Mädchenhandel – das war der Hauptgeschäftszweig der falschen Mönche. In Gegenden, in denen man sie nicht kannte, überfielen sie entlegene Fischerdörfer, plünderten sie aus und entführten Mädchen und junge Frauen, um sie dann an die Barbaresken zu verkaufen. Vor allem Abdullah, der Algerier, zahlte gute Preise für junge und frische Ware, die er seinerseits an der nordafrikanischen Küste weiterverkaufte.
„Sag dem Koch, er soll die fettesten Sardinen zubereiten“, fuhr Antonio Gonzales fort. „Das mag fürs erste reichen. Wenn wir in unserem Unterschlupf sind, kriegen die Weiber nur noch Himmelsspeck. Das Zeug schmeckt gut und sorgt für runde Hüften.“
„Himmelsspeck“ nannte man beliebte Zuckerbäckereien aus Mandeln, Feigen, Honig, Zucker, Eiern und Gewürzen. Sie schmeckten in der Tat himmlisch und sorgten, wenn man sie reichlich genoß, für die erwünschte Gewichtszunahme.
„Ich sage Ricardo Bescheid“, entgegnete Fernandez. „Abdullah wird seine Freude an den gemästeten Täubchen haben. Was aber hast du mit dem jungen Burschen vor? Hätten wir ihn nicht besser gleich über Bord werfen sollen?“
Gonzales winkte ab.
„Er ist uns mehr oder weniger durch Zufall ins Netz gegangen. Wenn wir ihn schon durchfüttern, dann soll er auch was dafür tun. Er kann beispielsweise die Dreckarbeiten übernehmen und außerdem Rodrigo bei der Herstellung des Lebenselixiers helfen. Falls wir ihn nicht mehr brauchen, können wir ihn immer noch beseitigen oder an Abdullah verkaufen. Der Bursche scheint gesund und kräftig zu sein und dürfte auf einem afrikanischen Sklavenmarkt rasch einen Käufer finden.“
Damit war auch Felipes Schicksal vorerst besiegelt.
Um die fernere Zukunft dachte der junge Fischer aus Santa Maria jedoch nicht nach, dazu war er viel zu sehr mit der Gegenwart beschäftigt.
Nach dem nächtlichen Überfall auf sein Heimatdorf hatte man die verschleppten Mädchen zu Margarida in die Vorpiek gesperrt, er aber war in die Segellast umquartiert worden. Der Raum war klein und eng, die stickige, abgestandene Luft erschwerte das Atmen.
Felipe hockte auf einem wirren Haufen von Tauwerk und Tuch. Da es in der Kammer stockfinster war, mußte er sich ganz auf seinen Tastsinn verlassen. Die Fesseln waren ihm zwar abgenommen worden, aber das war kaum von Nutzen für ihn. Irgendwelche Werkzeuge gab es nicht.
Die Piraten hatten die Holzkiste mit den entsprechenden Utensilien wohlweislich herausgeholt, bevor sie ihn in den muffigen Raum gestoßen hatten. Es war unmöglich, das Schott von innen zu öffnen, dafür sorgte der schwere Eisenriegel, den man draußen vorgeschoben hatte.
Zunächst hatten Felipes Gedanken ausschließlich Margarida und den anderen Mädchen gegolten. Sie hatten laut geweint, als sie von den Schnapphähnen mit Zoten und höhnischen Bemerkungen in die Vorpiek getrieben worden waren.
Seine lauten Verwünschungen und Fausthiebe gegen das dicke Holz des Schotts waren von den Teufelsmönchen nicht zur Kenntnis genommen worden. Ohnmächtig vor Wut und Hilflosigkeit hatte er sich schließlich auf das ertastete Tauwerk sinken lassen und dumpf vor sich hin gebrütet.
Welche Pläne hegten diese Verbrecher? Der junge Fischer wurde halb wahnsinnig bei dem Gedanken, daß die Kerle Margarida irgend etwas zuleide tun könnten.
Und was war mit den übrigen Bewohnern von Santa Maria geschehen? Sicherlich hatte es bei dem heimtückischen Überfall Tote und Verwundete gegeben. Was war aus seiner Familie geworden – aus seinen Eltern und Geschwistern? Und wohin segelte die Piratenkaravelle?
Felipe hielt es nicht mehr aus auf dem Tauwerk. Er erhob sich und begann erneut, sich durch den dunklen Raum zu tasten. Er klopfte die Wände ab und wühlte in den offenbar recht unordentlich aufgeschichteten Tauen und in einem Stapel von Segeltuch, aber da gab es nichts, was ihm als Waffe hätte dienen können – nicht einmal einen Belegnagel oder eine Holzlatte.
Schließlich ließ er ein dünnes Stück Tau durch die Hände gleiten. Es war geschmeidiger und beweglicher als die vielen dicken Seile. Er legte es griffbereit neben sich, als er sich wieder auf seinem alten Sitzplatz niederließ.
Das nervtötende Warten und Grübeln begann aufs neue. Die Luft in Felipes Gefängnis wurde immer stickiger, ein heftiges Knurren seines Magens erinnerte ihn daran, daß er seit vielen Stunden nichts mehr gegessen hatte.
Nicht einmal einen Schluck Wasser hatte man ihm bis jetzt zu trinken gegeben. Er dachte wieder an Margarida und die anderen. Was taten sie? Hatte man wenigstens sie mit Essen und Trinken versorgt?
Die Zeit verging, die Stunden schienen nicht enden zu wollen. Außer dem Rauschen und Plätschern des Wassers, das von den Bordwänden verdrängt wurde, war nur das Ächzen und Knirschen des Gebälks zu hören.
Felipe mußte lange warten, bis ein anderes Geräusch seine Gedankengänge jäh unterbrach.
Zunächst drang ein dumpfer Laut durch das Schott, dann rutschte der eiserne Riegel quietschend aus der Halterung.
Felipe stand blitzschnell auf, das dünne Taustück, das er sich zurechtgelegt hatte, hielt er hinter seinem Rücken versteckt. Er hatte lange genug nachgedacht, jetzt war er fest entschlossen, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit etwas zu unternehmen.
Wenn er eine Waffe hatte und womöglich eine Kutte, dann würde es ihm vielleicht gelingen, sich bis zum Kapitän durchzuschlagen. Mit dem Oberschnapphahn als Geisel würde er die Kerle zwingen, nach Santa Maria zurückzusegeln und ihn und die Mädchen freizulassen.
Natürlich war er sich darüber im klaren, daß seine Chancen nur sehr gering waren, aber er würde es versuchen – allein schon Margarida zuliebe.
Das Schott schwang auf und eine dunkle Mönchsgestalt erschien in der Öffnung. Das spärliche Licht einer Tranlampe, die irgendwo draußen im Gang brannte, ließ Felipe erkennen, daß der Besucher in der einen Hand einen Tonkrug hielt, in der anderen eine Steinschloßpistole.
„Wo steckst du, Freundchen?“ rief der Pirat spöttisch. „Es ist Zeit zum Backen und Banken. Komm her und hol dir dein Festmahl ab. Bruder Antonio hat dir ’nen ganzen Krug Wasser spendiert.“ Es folgte ein höhnisches Lachen. „Die fetten Sardinen sind nämlich den Weibern vorbehalten“, fuhr er fort, „damit sie schön rund und drall werden.“
Felipe verharrte still in der dunklen Segellast, eine Antwort gab er nicht. Das aber erschien dem Kuttenmann, der wohl mit einigen wilden Flüchen gerechnet hatte, merkwürdig. Er beschloß, doch lieber den Hahn der Pistole zu spannen.
Aber das schaffte er nicht mehr.
Das dünne Tau, das Felipe abwartend hinter dem Rücken verborgen hatte, flog blitzschnell durch die Luft und schlang sich um den Nacken des Mannes. Im selben Augenblick fühlte sich dieser wie von einer unsichtbaren Kraft nach vorn gerissen – direkt in die Segellast hinein.
Aus seinem Mund drang ein Ächzen, dann stürzte der Schnapphahn der Länge nach auf die Planken. Die Pistole entglitt seiner Hand, und der Tonkrug zerbarst mit lautem Splittern. Während sich die Scherben über die kleine Kammer verteilten, floß das Wasser über den Boden.
Felipe stürzte sich sofort auf den Piraten und schlug mit den Fäusten zu. Noch bevor der Bursche an Gegenwehr denken konnte, wurde es bereits schwarz vor seinen Augen.
Der junge Fischer triumphierte. Die Pistole! zuckte es ihm durch den Kopf. Ich muß sofort die Pistole finden, bevor ich mir seine Kutte ausleihe. Noch auf den Knien tastete er sich über die Planken, das schwache Licht, das vom Gang hereindrang, bot ihm keine große Unterstützung.
Felipe entdeckte die Pistole neben einer Taurolle. Doch bevor er danach greifen konnte, fühlte er sich plötzlich von hinten gepackt und hochgerissen. Fast gleichzeitig bohrte sich ihm der Lauf einer Waffe in den Rücken.
„Sieh an, unser liebestoller Sardinenfischer ist in seiner gemütlichen Kammer wohl ein bißchen wild geworden“, sagte eine Stimme hinter ihm. Sie gehörte Miguel Fernandez, der rechten Hand des Kapitäns.
Der spindeldürre Kerl, der neben ihm stand, schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht zu einem schadenfrohen Grinsen.
„Sag ich’s doch immer“, tönte er. „Müßiggang ist aller Laster Anfang. Es wird Zeit, daß unser junger Freund bald was vernünftiges zu tun kriegt. Vorerst aber werden wir wohl nicht umhin können, ihm die Wildheit ein wenig auszutreiben, meinst du nicht auch, Miguel?“
„Du hast völlig recht, mein lieber Bruder im Herrn“, erwiderte der kleine, stämmige Fernandez. „Schließlich dürfen wir sein Seelenheil nicht aus den Augen verlieren.“
Felipe ballte in ohnmächtiger Wut die Hände zu Fäusten. „Der Teufel soll euch holen!“
Die Schnapphähne lachten nur.
„Hört, hört, welch ein unchristlicher Wunsch“, spottete Rodrigo, der „Sensenmann“. „Vielleicht solltest du doch den Zeigefinger krümmen, Miguel. Dann weiß unser junger Freund gleich, wie das ist, wenn man vom Teufel geholt wird.“
„Ja, man sollte es wirklich tun“, sagte Fernandez. „Aber du kennst ja mein weiches, mitfühlendes Herz. Ich bin dafür, daß wir dieses Mal noch Barmherzigkeit walten lassen.“
„Hähä!“ lachte der Dürre. „Na, los denn – lassen wir sie walten!“
Felipe wurde herumgerissen, und noch bevor er sich zur Wehr setzen konnte, krachte der erste Hieb gegen sein Kinn. Er begann zu torkeln, blieb aber auf den Beinen.
„Das zahle ich euch heim!“ versprach er keuchend.
Aber die Piraten ließen ihm keine Chance. Ihre Fausthiebe prasselten wie eine Sturmflut auf ihn ein. Von einem Schwinger in die Magengrube getroffen, wurde er zurückgeschleudert, stolperte dabei über den noch immer besinnungslos auf den Planken liegenden Kuttenmann, und stürzte rücklings auf den Haufen von Tauen, der ihm vor kurzem noch als Sitzgelegenheit gedient hatte.
Sein Hinterkopf prallte dabei gegen die Holzwand der Segellast. Er sah zuckende Blitze vor seinen Augen, die sich im Kreis zu drehen begannen, dann glaubte er in ein finsteres, endlos tiefes Loch zu stürzen.
Fernandez und der „Sensenmann“ schleiften ihren Komplicen aus der Kammer, schlugen das Schott zu und schoben den Eisenriegel wieder vor. Doch das kriegte Felipe nicht mehr mit.
Das erste, was er nach langer Zeit totaler Dunkelheit wahrnahm, war das Poltern des Ankerspills. Es dauerte jedoch eine Weile, bis sein vollständiges Erinnerungsvermögen zurückgekehrt war. Mühsam und mit schmerzverzerrtem Gesicht richtete er sich auf. Hinter seinen Schläfen begann es zu hämmern und zu dröhnen, und als er sein Gesicht betastete, fühlte er an seinen Fingern klebrige Feuchtigkeit.
Felipe ärgerte sich über sich selber. Warum nur war er davon ausgegangen, daß der Kerl mit dem Tonkrug allein erschienen war? Wenn er gewußt hätte, daß sich zwei seiner Komplicen auf dem Gang aufhielten, hätte er sich einiges ersparen können.
Doch zum Nachdenken blieb ihm diesmal nicht viel Zeit.
Allem Anschein nach war die Karavelle vor Anker gegangen. Bald hörte er laute Stimmen vor dem Schott, gleich darauf wurde wiederum der Riegel zurückgeschoben.
Diesmal waren es mehrere Kapuzenmänner, die vor dem offenen Schott standen. Sie waren mit Messern und Pistolen bewaffnet, einer von ihnen hielt eine Tranlampe in der Hand, deren Licht die Segellast erhellte.
„Oh, unser feuriger Liebhaber hat ja schon ausgeschlafen“, sagte Miguel Fernandez. „Wie es scheint, benimmt er sich diesmal ganz manierlich.“
Felipe konnte nicht verhindern, daß ihm die Hände auf den Rücken gebunden wurden. Danach wurde er jedoch nicht wieder in die Segellast gesperrt, sondern unter Bewachung die Niedergänge hinaufgestoßen. Das grelle Licht der Sonne stach ihm schmerzhaft in die Augen, als er das Deck der „São Pedro“ betrat.
Dort herrschte allgemeine Aufbruchsstimmung. Die Piraten waren offensichtlich in ihrem Schlupfwinkel eingetroffen und schickten sich an, die Karavelle zu verlassen.
Felipe warf einen raschen Blick in seine nähere Umgebung. Das Schiff lag in einer kleinen, etwas versteckt gelegenen Bucht, die mehr einem Seitenarm des Rio Tejo glich, vor Anker. Ja, der Fluß war ihm nicht unbekannt, er hatte ihn zusammen mit anderen Fischern seines Dorfes bereits bis weit nach Norden hoch befahren.
Das nahe Ufer der Bucht bestand aus Sand und Geröll und wurde stellenweise von schroffen Felsen gesäumt. Die dahinter beginnende, leicht ansteigende Böschung war von üppigem Strauchwerk bewachsen, das fast übergangslos in einen niedrigen Buschwald mündete.
Was dem jungen Fischer aus Santa Maria jedoch hauptsächlich ins Auge fiel, war das alte, verwitterte Gemäuer, das höchstens zweihundert Schritte vom Ufer entfernt lag und in den dichten Buschwald eingebettet war. Zwei kleine Türmchen und einige halbzerfallene Mauerreste deuteten darauf hin, daß es sich um die uralte Ruine eines kleinen Klosters handelte.
Wenn das der Schlupfwinkel dieser falschen Mönche war, dachte Felipe, dann hatten sie sich in der Tat ein hervorragendes Versteck ausgesucht. Durch die schwarzen Kutten hatten sie ihr Äußeres dem „Kloster“ angepaßt und konnten unbehelligt – womöglich noch von den Bewohnern der Gegend als fromme Männer geehrt und geachtet – ihr Unwesen treiben.
Wie er jetzt aus eigener Erfahrung wußte, verlegte dieses Gesindel seine Beutezüge in entferntere Gegenden und hauste sonst hier am Rio Tejo in meisterhafter Tarnung.
Felipe wurde aus seinen Gedankengängen gerissen. Ein Stoß gegen den Rücken dirigierte ihn zum Backbordschanzkleid.
„Nur nicht einschlafen“, herrschte ihn Fernandez an. „Die hübsche Gegend kannst du noch lange genug genießen. Aber vergiß nicht, Freundchen: Wenn du hoch einmal versuchen solltest, uns Ärger zu bereiten, dann fackeln wir nicht lange. Es gibt dort drüben genug Bäume mit kräftigen Ästen, an denen man einen Kerl wie dich zappeln lassen kann. Auch am nötigen Tauwerk fehlt es uns nicht.“
Die Schnapphähne hatten bereits zwei Boote abgefiert und bemannt. Felipe wurde gleich im ersten Fahrzeug in Empfang genommen und mußte auf der mittleren Ducht Platz nehmen. Während Margarida und die anderen Mädchen an Deck gebracht wurden, stießen die Piraten das Boot bereits von der Bordwand ab.
Felipe fühlte Wut und Enttäuschung in sich aufsteigen, denn er hatte gehofft, wenigstens auf einem der Boote mit Margarida zusammenzutreffen. Er hätte ihr so etwas Mut zusprechen können. Aber genau das wollten diese Teufelsmönche offenbar vermeiden.
Fernandez, der sich auf der achteren Ducht niedergelassen hatte, schien Felipes Gedanken zu erraten.
„Aus einer gemeinsamen Spazierfahrt mit deiner hübschen Gespielin wird leider nichts“, sagte er mit beißendem Spott. „Aber du kannst beruhigt sein, wir werden sie rührend betreuen.“
„Sogar mit Himmelsspeck werden wir sie füttern, damit sie noch hübscher wird!“ rief ein anderer.
Das Boot wurde rasch zum nahen Ufer gepullt. Das zweite, in dem man einige der Mädchen untergebracht hatte, folgte sofort.
Margarida war dabei. Ihr langes, schwarzes Haar und ihre ranke Gestalt war für Felipe unübersehbar. Als er sich auf dem Weg zu dem alten Gemäuer noch einmal umdrehte, überfiel ihn erneut das zermürbende Gefühl der Hilflosigkeit.
Temperamentvoll wie Margarida war, versuchte sie, sich von ihren Bewachern loszureißen. Sie war in Freiheit aufgewachsen und wollte sich nicht ein ungewisses Schicksal aufzwingen lassen.
Aber sie hatte nicht die geringste Chance. Einer der falschen Mönche zerrte sie brutal hinter sich her, ein anderer hatte – um sie und die anderen einzuschüchtern – einen Dolch gezückt.
Felipe biß die Zähne zusammen, zumal er keine Möglichkeit sah, ihr zu helfen. Im Augenblick blieb ihm nur die Hoffnung, bald eine Gelegenheit zur Flucht zu finden, damit er Hilfe herbeiholen konnte. Das war zwar nur eine vage Hoffnung, aber der junge Fischer klammerte sich daran wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm.
6.
In der langgezogenen Mündung des Rio Tejo beherrschten zahlreiche Kleinsegler und Fischerboote das Bild. Von der Schebecke der Seewölfe nahm kaum jemand Notiz. Man war hier an fremde Schiffe gewöhnt, zumal an solche, die die spanische Flagge führten.
Der schlanke Dreimaster segelte über Backbordbug liegend auf den Hafen von Lissabon zu. Eine Schar hungriger Möwen flatterte mit lautem Geschrei über die Masttoppen und stürzte sich auf die Küchenabfälle, die der Kutscher über Bord gegeben hatte.
„Den armen Vögelchen ist wohl auch der Proviant ausgegangen“, meinte Carberry. „Hört’s euch nur gut an. So jämmerlich schreit man, wenn man richtigen Kohldampf hat.“
Der Profos hatte eine mitleidige Miene aufgesetzt, während er mit der rechten Hand liebevoll seinen Magen tätschelte.
Der Kutscher, der die leere Abfallpütz in der Hand hielt, lächelte verhalten.
„Man schreit nicht nur jämmerlich, wenn man vom Hunger geplagt wird“, sagte er, „sondern man wird auch ganz bescheiden. Schau dir die lieben Vögelchen nur an, Ed – unsere Abfälle scheinen ein wahres Festmahl für sie zu sein.“
„Pfui Teufel“, entfuhr es dem Profos. „So was könnte mir nicht mal der schlimmste Hunger reintreiben. Kein gesitteter Christenmensch würde deine Kombüsenabfälle anrühren. Nicht mal mit dem kleinen Finger.“
Der Kutscher winkte ab.
„Wenn man wirklich Hunger hat, kann man fast alles essen“, erklärte er. „Und was der eine verabscheut, ist für den anderen vielleicht eine Delikatesse. Oder könntest du dir vorstellen, einen schönen fetten Hirschkäfer zu verspeisen?“
Carberrys Gesicht wirkte angewidert.
„So ein Schweinkram!“ stieß er hervor. „Da wird man ja grün im Gesicht, wenn man nur daran denkt.“
„Na bitte“, fuhr der Kutscher fort. „Du wirst grün im Gesicht, und den alten Römern lief schon beim Gedanken an das köstliche Mahl das Wasser im Munde zusammen. Die haben die niedlichen Käfer nämlich mit Weizenmehl gemästet, sie dann geröstet und als Delikatesse verkauft. Doch vielleicht hätte das wilde Reitervolk der Hunnen etwas für deinen Geschmack zu bieten. Diese verwegenen Burschen ritten rohes Fleisch unter ihren Pferdesätteln mürbe und verspeisten es dann mit Kräutern und Gewürzen.“
Der Profos rollte mit den Augen und preßte beide Pranken gegen den Magen. „Hör sofort auf, du Zwiebelhacker! Ich nehme alles, was ich gegen deine Kombüsenabfälle gesagt habe, zurück. Und bevor du eine Suppe davon kochst, schauen wir uns doch lieber ein bißchen auf den Märkten von Lissabon um.“
Die Arwenacks grinsten und bemühten sich, den Speisezettel der Römer und Hunnen schnell wieder zu vergessen. Noch hatte der Vorrat des Kutschers ausgereicht, um alle Mann satt zu kriegen. Und was die Portugiesen für die Kombüse zu bieten hatten, würde man ja bald sehen.
Hasards Blicke waren auf das Dächergewirr gerichtet, das Backbord voraus auftauchte.
„Lissabon ist eine schone Stadt“, sagte er. „Sie baut sich von der Uferfront her fast wie ein Amphitheater auf.“
„Du hast recht“, pflichtete ihm Big Old Shane bei, der sich mit nachdenklichem Gesicht durch den grauen Bart strich. „Die Stadt wirkt majestätisch und ist ein bedeutender Handelsplatz. Man kann sich nicht so recht erklären, warum sich die Portugiesen jetzt schon achtzehn Jahre lang vom spanischen König herumkommandieren lassen, ohne dem Burschen mal auf die Finger zu klopfen.“
Hasard zuckte mit den Schultern. „Das ist Politik, Shane, und da ist manches schwer zu verstehen. Manchmal gleichen ganze Länder und Völker den Figuren auf einem Spielbrett. Die Mächtigen schieben sie nach Belieben hin und her, je nachdem, was sie sich davon versprechen.“
Der Seewolf spielte damit auf Ereignisse im Jahre 1580 an. Der Kardinal-König Henrique, ein Sohn Manuels I., war gestorben, und mit ihm die Dynastie Aviz. Portugal fiel damit an den spanischen König Philipp II., der ein Enkel Manuels I. war. Auf diese Weise sorgte die Erbfolge wieder einmal dafür, daß alles „in der Familie“ blieb.
„Im übrigen sollten wir den Einfluß der Dons nicht vergessen, wenn wir in Lissabon an Land gehen“, fügte Hasard hinzu. „Es kann nicht schaden, wenn wir ab jetzt wieder in unsere vielgeübte Rolle schlüpfen und uns als Spanier ausgeben. Außer dem Kutscher sollten die ausgesprochenen Blondschöpfe unter uns besser an Bord bleiben.“
Der Seewolf dachte dabei in erster Linie an Bob Grey, Roger Brighton, Stenmark, Piet Straaten, Jan Ranse sowie Nils Larsen und Dan O’Flynn. Die anderen Arwenacks würden im Gewimmel einer großen Hafenstadt nicht sonderlich auffallen, zumal auch die spanische Sprache, die von vielen Portugiesen verstanden wurde, kein Problem für sie war.
Hasard ließ einen Teil der Segel bergen, das Schiff verlangsamte seine Fahrt. Besonderes Aufsehen erregte es nicht, da außer den Franzosen und Spaniern auch die Portugiesen Schebecken als Handelsschiffe benutzten.
Im Hafen von Lissabon herrschte ein buntes Leben und Treiben. Viele Masten ragten in den tiefblauen Himmel – Galeonen, Karavellen, Schaluppen, Karacken und Schebecken lagen vor Anker. In ihrem Schatten dümpelten kleinere Wasserfahrzeuge, bis hin zu kleinsten Nußschalen.
Von Pete Ballie, der vor einigen Stunden erneut seinen Platz am Ruder eingenommen hatte, erforderte es einiges Geschick, den Segler an einen freien Liegeplatz zu manövrieren.
Auf vielen Piers und Stegen herrschte reger Betrieb. Waren wurden an Bord gehievt, die Landungen fremder Handelsschiffe mußten gelöscht werden. Dazwischen lungerten – wie in allen Häfen der Welt – Faulenzer, Neugierige und Abstauber herum, die insbesondere einlaufende Schiffe genau taxierten. Nicht weit von ihnen entfernt brüllten Straßenhändler ihre Angebote durch die Gegend, Diebe, Räuber und Schlitzohren waren eifrig dabei. Beutegut zu verhökern.
Carberry schnalzte genüßlich mit der Zunge.