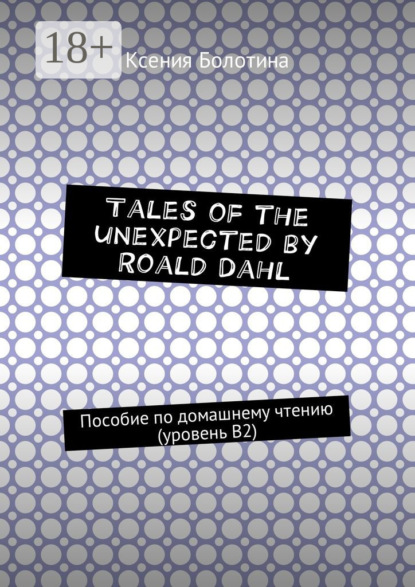Seewölfe Paket 30

- -
- 100%
- +
Etwas krachte.
Jäh füllte es den kleinen Raum wie mit einem Donnerschlag aus.
Blacky spürte, wie Gigliola über ihm zusammenzuckte und vor Schreck erstarrte.
Er selbst überwand den Schreck schneller, aber da war die junge Frau, die ihn mit ihrem atemberaubenden Körper behinderte.
Dem Krachen folgte ein Splittern von Glas. Scherben klirrten zu Boden.
Tür und Fenster waren gleichzeitig aufgebrochen worden.
Blacky schaffte es fast, sich von der angstgelähmten Gigliola freizukämpfen.
Aber die Gestalten waren bereits zur Stelle. Daß sie nach dem Lärm jetzt auf leisen Sohlen huschten, erschien Blacky widersinnig. Ihm fiel jedoch ein, daß sie diese Lautlosigkeit gebraucht hatten, um in das Haus einzudringen und sich unbemerkt anzuschleichen.
Er wollte vom Bett hochfahren und nach seinen Waffen greifen.
Zu spät.
Vier Kerle waren in diesem Sekundenbruchteil neben dem Bett, und sie gingen kein Risiko ein. Mit den Kolben ihrer Pistolen schlugen sie zu.
Blacky hörte noch, wie Gigliola vor Entsetzen schrie und gleich darauf mit einem Fausthieb zum Verstummen gebracht wurde. Dann explodierte grellfarbener Schmerz vor seinen Augen. Auch die schwächere Schmerzexplosion eines zweiten Hiebes nahm er noch wahr. Im nächsten Augenblick versank er in tiefe Bewußtlosigkeit, die ihm jegliche Empfindung ersparte.
Als er erwachte, durchfuhr ihn etwas von der Kälte eines Eiszapfens. Etwas das schlimmer war als körperlicher Schmerz.
„Gigliola!“ stöhnte er und tastete mit beiden Händen um sich. Sehen konnte er noch nichts.
In seiner unmittelbaren Umgebung, so weit seine Hände reichten, war nur Stein. Rauhe Platten mit Fugen dazwischen. Ein Fußboden.
Das Heulen des Windes drang in sein Bewußtsein.
Gigliolas Nähe war zu berauschend gewesen. Um so grausamer drang es jetzt in sein zurückkehrendes Bewußtsein, auf welche Weise er von ihr weggerissen worden war. Ohnmächtige Wut packte ihn.
Und damit setzten die Schmerzen in seinem Kopf ein.
Es hämmerte und dröhnte, als hätte sich eine fremde Macht in seinem Kopf eingenistet, um ihn von innen zu sprengen. Wahrnehmungen und Gedanken wurden betäubt. Er lag regungslos auf dem Rücken, rührte sich nicht und versuchte, die Schmerzen zu überwinden. Dazu mußte er die Wut bezwingen, die sein Blut in Wallung brachte.
Nach Minuten, die ihm wie Ewigkeiten erschienen, hatte er sich an das Hämmern und Dröhnen so weit gewöhnt, daß es seine Sinne nicht länger lahmlegte.
Langsam, mit beträchtlicher Mühe, drehte er sich auf den Bauch und kroch so weit, bis er mit den Händen gegen eine Wand stieß. Jetzt hörte er wieder das Heulen des Windes. Es war kalt. Er begann zu frieren, Zugluft strich über ihn hinweg. Abermals drehte er sich herum, lag eine Sekunde lang schwer atmend auf dem Rücken und fing dann an, sich aufzusetzen.
Es war eine höllische Anstrengung.
Die Kerle mußten ihn halb totgeschlagen haben.
Vielleicht hatten sie ihn tatsächlich für tot gehalten. Himmel, das konnte bedeuten, daß sie ihn in eine Gruft geworfen hatten – in ein gemauertes Geviert mit einer Granitplatte obendrauf!
Panik erfaßte ihn, und sofort setzten die Schmerzen wieder heftiger ein. Keuchend zwang er sich zur Ruhe. Noch konnte er atmen, und da war auch dieser Luftzug. Er sagte sich, daß er während seiner Bewußtlosigkeit längst erstickt wäre, wenn es sich tatsächlich um eine dicht abgeschlossene Gruft gehandelt hätte.
Nach einer wiederum quälend langen Zeitspanne schaffte er es endlich, sich mit dem Rücken an der Wand hochzuschieben.
Sitzend hielt er inne und wartete, bis sein Atem langsamer ging und auch die Schmerzen wieder geringer wurden. Sie mußten ihm mörderische Schläge verpaßt haben. Doch sie konnten ihn nicht wirklich für tot gehalten haben. Sie mußten seinen Herzschlag und seinen Atem festgestellt haben.
Also hatten sie einen Grund, ihn am Leben zu lassen.
Ihm wurde bewußt, daß er die ganze Zeit über die Augen offen gehabt hatte. Aber erst jetzt wich ein tief schwarzer Schleier, der sein Sehvermögen fast völlig ausgeschaltet hatte. Er sah das Mondlicht und hätte einen Freudenschrei ausstoßen können. Doch dieses Mondlicht hatte nichts von jener anheimelnden Wärme, die in Gigliolas Kammer geherrscht hatte. Es war kalt und abweisend, und es wurde in kurzen Zeitabständen von Wolken verdüstert, die der Wind vorübertrieb.
Blacky wußte nicht, wieviel Zeit vergangen war, als seine Kräfte endlich zurückkehrten und er den Schmerz bis auf einen geringen Rest bezwingen konnte. Er richtete sich vollends auf und taumelte noch ein wenig, stand dann aber sicher auf den Beinen.
Der Raum, in dem er sich befand, war rund. Es gab vier schmale Fenster, die von außen vergittert waren. Zwei Fenster waren undicht, die Zugluft, die er wahrgenommen hatte, strömte in scharfen kleinen Stößen herein. Der Fußboden bestand aus jenen Steinplatten, die er bereits ertastet hatte. Was sich über der Decke aus dunklen Brettern befand, konnte er nicht herausfinden – vermutlich das Dach.
Denn es war eine Turmkammer, in die sie ihn gesteckt hatten.
Draußen konnte er das Meer sehen. Ein auflandiger Nachtwind hatte dem Wasser deutliche weiße Schaumkronen aufgesetzt.
Landeinwärts befanden sich Gebäude und Parkanlagen. Ein Castello. Einzelheiten waren in der geringen Helligkeit nicht zu erkennen.
In der Mitte der Turmkammer stieß Blacky mit der Fußspitze gegen eine Kante. Er ging in die Knie, um tastend herauszufinden, was es war. Seine Fingerkuppen berührten Holzbohlen von zwei Zoll Stärke.
Eine Luke, ebenfalls kreisrund wie der ganze Raum.
Vorsichtig hob er die Luke an, nur um Handbreite.
Aus unendlich scheinender Tiefe drang ein Tosen und Gurgeln herauf.
Blacky spähte durch den Lukenspalt. Etwas Eisiges kroch über den Rücken.
Nur undeutlich, durch den weißschäumenden Gischt wenig erhellt, ließen sich Einzelheiten erkennen. Es schien aber eindeutig, daß der Turm über einem Felsenkamin gebaut war. Insgesamt mußte er eine Tiefe von mindestens 200 Fuß haben. Dort unten brodelte und schäumte das Wasser über die Uferklippen.
Blacky schloß die Luke.
Das Tosen war nicht mehr zu hören.
Es änderte nichts daran, daß seine Zukunft alles andere als rosig aussah.
4.
Die Holzscheite im Kaminfeuer prasselten und krachten unter den Flammen.
Don Marcello hob sein Glas, so daß er den Wein vor dem Hintergrund des Feuers betrachten konnte.
„Ein achtundachtziger Frascati“, sagte er schwärmerisch. „Mein Gott, die Römer haben schon immer gewußt, was gut ist. Hast du jemals einen köstlicheren Tropfen genossen, Emiliano?“
Emiliano Cóstola, der Mann mit dem Rabengesicht, zog gequält die Mundwinkel nach unten. „Machen Sie sich nicht über mich lustig, Don Marcello. Sie wissen, ich bevorzuge Rotwein.“
„Aber den Weißwein der Römer trinkst du doch nicht nur mit mir, um mir einen Gefallen zu tun, sondern weil er dir schmeckt! Wenn du den Frascati so verabscheuen würdest, rührtest du ihn nicht an. Habe ich recht?“
Cóstola sah den dunkelblonden Mann mit dem kantigen Gesicht an und bemühte sich, seine innere Verzweiflung nicht zu zeigen. Manchmal war es verteufelt schwer, die richtigen Antworten zu geben. Er wußte, in diesem Moment wollte ihn Don Marcello dazu bringen, sich selbst zu widersprechen, um dann in lärmenden Triumph auszubrechen.
Dabei wurde ihm nicht klar, daß er solchen Triumph nur aufgrund seiner Macht erlangte. Wenn man einmal wagte, seine wirkliche Meinung zu äußern, mußte man sehr behutsam sein und zuvor genau prüfen, in welcher Stimmung sich Don Marcello gerade befand. Seine Reaktionen waren höchst unterschiedlich.
Andererseits hatte er, Emiliano Cóstola, seine Position als Rechtsberater und Stellvertreter des Don nicht durch puren Zufall erlangt.
Er wußte, wie er mit Don Marcello umzugehen hatte.
Und Don Marcello war sich darüber im klaren, daß er in ihm den zuverlässigsten und treuesten Mann innerhalb seiner gesamten Organisation hatte.
„Ich weiß“, sagte Cóstola nach einer Weile des Überlegens, „welche große Vergangenheit der römische Wein hat. Man spürt das mit jedem Schluck, den man von so einem kostbaren Tropfen nimmt. Dessen bin ich mir immer bewußt. Wenn ich aber einen einfachen roten Landwein aus den Bergen Sardiniens trinke, dann habe ich das Gefühl, ein Teil dieses Landes zu sein, das uns hervorgebracht hat – das Gefühl, in der Tradition dieses einzigartigen Landes zu stehen, verwurzelt zu sein mit …“
„Emiliano, du bist ein Schlitzohr“, unterbrach ihn Don Marcello grinsend. „Ich hatte fast angenommen, du würdest mir erzählen, wie sehr du toskanischen Wein verabscheust – um mich abzulenken.“
„Das wäre denn doch etwas zu einfach gewesen“, entgegnete Cóstola mit dem Knopfaugenblinzeln eines listigen alten Raben.
Don Marcello Struzzo, der einen Hausmantel aus tiefblauer Seide trug, leerte sein Glas und schenkte aus einer kristallenen Karaffe nach. Das Stichwort „toskanisch“ war geeignet, seine gute Laune zu trüben.
Dieser verfluchte Eindringling aus der Toskana war wie eine schwere Last, die man immer wieder vergeblich abzuschütteln versuchte.
Don Cesare di Montepulciano lebte nun schon seit zehn Jahren wie eine Made im Speck.
Und so sieht er auch das, dachte Don Marcello in einem Anflug von grimmigem Spott.
Es änderte aber alles nichts daran: Don Cesare di Montepulciano hatte sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Cagliari eingenistet, und keine Macht der Welt schien ihn vertreiben zu können. Im Gegenteil. Der fette Kerl, der Wein, Weib und Gesang liebte wie kein anderer, hatte angefangen, seine Machtfühler immer mehr auch nach Cagliari auszustrecken. Dorthin, wo über Generationen stets nur die Familie Struzzo den Ton angegeben hatte.
Seine Ländereien in Montepulciano in der Toskana hatte der saubere Don Cesare einem Schwager zur Verwaltung übergeben. Denn der riesige Gutshof, den er hier, auf Sardinien geerbt hatte, bot zehnmal höhere Einkünfte. Don Marcello wußte darüber genau Bescheid, weil er Erkundigungen eingezogen hatte.
Aber nicht nur die Einkünfte waren es, die dem Eindringling in seiner neuen sardischen Heimat so sehr gefielen. Die vielen kleinen Pächter, die für seinen Gutsbetrieb arbeiteten, hatten viele ansehnliche Töchter und gelegentlich auch ansehnliche Ehefrauen.
Es war ein offenes Geheimnis, daß der toskanische Hurensohn einen beträchtlichen Anteil der Pachtraten in seinem Lotterbett abgelten ließ. Stolze Sardinnen wurden auf diese Weise entehrt und gedemütigt. Es war eine Schande.
Als noch größere Schande empfanden es manche in Cagliari, daß ihr Schutzpatron, Don Marcello, nicht in der Lage war, den Eindringling mit einem Tritt in den Hintern außer Landes zu jagen.
In den ersten Jahren seiner schmarotzerhaften Anwesenheit hatte sich Montepulciano noch zurückgehalten und war den Einheimischen kaum aufgefallen. Seit mindestens acht Jahren aber ging er Don Marcello und den meisten anderen mächtig auf die Nerven. Don Marcello hatte es zu offenen Auseinandersetzungen kommen lassen, und geglaubt, den Kerl mit Waffengewalt vertreiben zu können.
Er hatte Lehrgeld bezahlt.
Don Cesare di Montepulciano verfügte über eine beachtliche kleine Streitmacht, gegen die kein Kraut gewachsen war. Es handelte sich um blasierte Kerle, die er aus seiner vornehmen Heimat mitgebracht hatte.
Allerdings verstanden diese Kerle ihr Handwerk. Es hatte nicht den geringsten Sinn, daß man sich über sie amüsierte. Dadurch schaffte man das Problem am allerwenigsten aus der Welt.
Don Marcello und Don Cesare hatten sich im Laufe der kriegerischen Auseinandersetzungen mehrmals blutige Rache geschworen. Das war immer dann der Fall gewesen, wenn Don Marcellos Leute Ansiedlungen und Pächterhöfe im Machtbereich Montepulcianos verwüstet hatten. Und umgekehrt, wenn Don Cesares Horden in Cagliari den wilden Mann markiert hatten.
Don Marcello Struzzo stellte sein Glas ab, richtete sich im Sessel auf und sah seinen Berater an. „Was hältst du von der Angelegenheit, Emiliano? Ist es eine neue Offensive, die der Bastard eingeleitet hat?“
Cóstola nahm einen Schluck von dem römischen Wein und erwiderte den Blick seines Herrn über den Rand des Glases hinweg. „Ehrlich gesagt, ich rechne nicht mit einer wirklichen Offensive. Es wird eher ein Geplänkel sein, aber eins, das wir ernst nehmen müssen.“
Don Marcello rieb sich das Kinn. „Ich kann mir noch immer nicht vorstellen, daß dieser Bursche für Montepulciano arbeitet.“
Cóstola antwortete mit einer entschiedenen Handbewegung. „Daran habe ich nun meinerseits nicht den geringsten Zweifel. Der Mann fiel mir bei dem Zwischenfall auf der Piazza sofort auf. Die Toskaner rühmen sich stets ihrer besonderen Raffinesse. Das habe ich in meine Überlegungen einbezogen, und es paßt alles zusammen.“
„Nämlich?“ Don Marcello lehnte sich wieder zurück.
„Der Mann ist eindeutig Norditaliener. Er gibt sich als Engländer aus und radebrecht mit einem Akzent, der zugegebenermaßen sehr gekonnt ist. Sie werden sehen, Don Marcello, unter der Folter wird er auf einmal fließend Italienisch sprechen.“
Struzzo nickte. „Ein Todesbote also, den Montepulciano aus seiner lausigen Heimat hat holen lassen – mit dem alleinigen Auftrag, mich zu töten.“
„Das ist leider zu befürchten“, sagte der Mann mit dem Rabengesicht, und seine Knopfaugen waren voller Ernst und Sorge.
„Für einen bezahlten Mörder“, sagte Don Marcello gedehnt, „war dieser Bursche allerdings reichlich unvorsichtig. Warum mischte er sich in so einen läppischen Streit an Nócciolos Marktstand ein?“
„Er hat sich nicht eingemischt“, widersprach Cóstola. „Es war die kleine Händlerhure Gigliola, die ihm den Kopf verdreht hat. Warum, so dürfte er sich gesagt haben, sollte er sich nicht die Abwechslung eines Abenteuers erlauben, bevor er in Cagliari zur Tat schreitet?“
Don Marcello Struzzo ließ ein nachdenkliches Brummen hören. Nach einer Weile grinste er bösartig. Er leerte sein Glas mit dem perlenden weißen Frascati, als gelte es, einen Erfolg zu feiern.
„Nun“, sagte er, „wir werden dem Drecksack Montepulciano einen Denkzettel verpassen, den er so schnell nicht wieder vergißt.“
Bob Grey war für die letzte Deckswache an Bord der Schebecke eingeteilt, und er erlebte das Schauspiel des Sonnenaufgangs an der östlichen Kimm. Durch die Masten der im Hafen vertäuten Segler konnte er das offene Meer sehen. Vor dem Feuerball, der langsam über die scharfe Linie der Kimm aufstieg, erschienen Masten und Takelage wie ein gigantisches Ölbild, das in ausschließlich schwarzer Farbe vor blutigrotem Hintergrund gemalt worden war.
Der drahtige blonde Engländer wandte sich um, überquerte das Hauptdeck zur gegenüberliegenden Verschanzung und blickte zu den Häusern von Cagliari, die sich mit ihren Schindeldächern fast planlos um die winkligen Gassen gruppierten.
Die Stadt erwachte.
Rauch von Kochfeuern quoll aus den Schornsteinen und wurde vom Wind davongetragen. Die Bäcker hatten ihre Öfen schon vor Stunden angeheizt, noch bei Dunkelheit. Jetzt wehte der Duft frisch gebackenen Brotes bis zum Hafen, und Bob spürte als Reaktion darauf ein Hungergefühl in seinem Magen. Aber der Kutscher und Mac Pellew schlummerten in ihren Kojen. Bis zum Frühstück waren es noch drei Stunden.
Bob seufzte. Er würde den knurrenden Bären in seinem Magen besänftigen müssen.
Er wollte sich abwenden, als er die Schritte hörte – dumpfe Schläge von harten Stiefelabsätzen auf der Pier. Erstaunt blickte er zur Kaiseite der Pier, wo sich die Giebelwände der Lagerhäuser aneinanderreihten. Er rechnete mit einer Streife der Stadtgarde, was das einzig Wahrscheinliche zu dieser frühen Stunde war.
Doch die vier Männer, die da heranstelzten, trugen keine Helme und keine Brustpanzer, keine Uniformen. Alle vier waren schlank und schwarzhaarig, ihre Kleidung elegant, die Waffen hochwertig.
Bob Grey mußte unwillkürlich an die geschniegelten Burschen denken, von denen der Profos und die anderen berichtet hatten, die am Abend gemeinsam losgezogen waren.
Die Eleganten steuerten denn auch tatsächlich auf den Dreimaster zu.
Vor dem Schanzkleid blieben sie stehen. Sekundenlang musterten sie den Engländer aus schmalen Augen.
„Wache?“ schnarrte der älteste der drei, dessen silbergraue Haarsträhnen nur aus unmittelbarer Nähe zu erkennen waren.
„So ist es“, entgegnete Bob Grey.
„Rufen Sie Ihren Kapitän. Ich habe mit ihm zu sprechen.“ Es hörte sich an, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, zu dieser nachtschlafenden Zeit eine solche Forderung zu stellen.
Bob tastete unwillkürlich nach seinem Pistolengriff. Er war allein an Deck und konnte im Ernstfall nicht viel ausrichten. Andererseits ließ er sich nicht von irgendwelchen hergelaufenen Figuren einschüchtern. Sollte es tatsächlich kritisch werden, konnte er Alarm geben. Es galt eben nur, daß er auf seine eigene Haut achtete.
Leicht gesagt – angesichts von vier Burschen, die mit Pistolen und Dolchen bewaffnet waren und offensichtlich ausgerechnet diese frühe Tageszeit gewählt hatten, weil sie nicht mit Beobachtern zu rechnen brauchten.
Bob schüttelte den Kopf und grinste herausfordernd. „Tut mir leid, Signori. Der Kapitän ist nicht zu sprechen. Falls Ihnen die Uhrzeit nicht bekannt sein sollte …“
„Ich wiederhole meine Forderung nicht gern“, unterbrach ihn der Anführer schroff. „Notfalls müssen wir mit Gewalt vorgehen.“
Bobs Muskeln spannten sich an.
„Versuchen Sie es“, stieß er entschlossen hervor. „Ohne meine Einwilligung haben Sie auf diesem Schiff nichts verloren.“
Der Anführer und die drei anderen lachten höhnisch. „Die Lächerlichkeit dieser Bemerkung müßte Ihnen eigentlich bewußt sein.“
Bob ließ die Rechte auf dem Pistolengriff ruhen.
„Lassen Sie das meine Sorge sein“, entgegnete er, ohne seine innere Anspannung erkennen zu lassen.
„Also dann“, sagte der andere und nickte. „Letzte Chance für Sie, Engländer. Rufen Sie Ihren Kapitän, oder …“
Schritte näherten sich auf den Decksplanken.
Bob drehte sich ungläubig um.
„Oder?“ sagte der Seewolf mit einem Lächeln, das so eisig war wie ein Morgen in nördlichen Breiten.
Bob konnte nur darüber staunen, wie schnell der Seewolf selbst auf die leisesten Geräusche reagierte. In seiner Kammer konnte er die Stimmen bestenfalls als gedämpftes Murmeln gehört haben. Trotzdem hatte er sofort gespürt, daß dem Schiff und der Crew eine Gefahr drohte.
Es war diese besondere Art von geschärftem Instinkt, die den Seewolf mehr als alle anderen Männer an Bord auszeichnete.
Er war bereits vollständig angekleidet und mit seinem sechsschüssigen Drehling bewaffnet.
Bob Grey zog die Schultern hoch.
„Die Gentlemen haben sich nicht vorgestellt“, sagte er. „Trotzdem hören sie sich für meine Begriffe verdammt unverschämt an.“
Hasard nickte und trat neben Bob an die Verschanzung.
„Sind Sie der Kapitän?“ fragte der Anführer der Gruppe herablassend, obwohl er zu dem hochgewachsenen Engländer mit den breiten Schultern und den schmalen Hüften aufblicken mußte.
Hasard nickte abermals.
„Killigrew“, sagte er. „Wer sind Sie? Was wollen Sie?“
„Meine Männer und ich vertreten Don Cesare di Montepulciano, einen der Mächtigsten in Cagliari und Umgebung. Eine Gruppe unserer Leute wurde gestern abend von Mitgliedern Ihrer Crew vor einer Trattoria grundlos angegriffen und zusammengeschlagen. In einem Fall gab es sogar eine Verletzung durch ein Wurfmesser, Don Cesare läßt Ihnen ausrichten, daß er diese Ungeheuerlichkeit nicht dulden wird. Sie haben den Hafen von Cagliari sofort zu verlassen. Sollte das bis heute mittag nicht geschehen sein, sehen wir uns gezwungen, ein Exempel zu statuieren.“
Der Seewolf zog die Mundwinkel nach unten. „Richten Sie Ihrem Don etwas von mir aus. Daß ich ihm nämlich eigenhändig die Ohren langziehen werde, falls er sich zu irgendeiner Unverschämtheit versteigt.“
Die Kerle erblaßten vor Fassungslosigkeit.
„Unsere Liegegebühren haben wir für drei Tage im voraus bezahlt“, fuhr Hasard fort. „Ich kann mich aber nicht entsinnen, daß Ihr Don Cesare der Zahlungsempfänger gewesen sein sollte. Was den Vorfall von gestern abend betrifft, so lassen Sie sich gesagt sein, daß die Mitglieder meiner Crew sehr wohl Grund hatten, ihre Fäuste einzusetzen. Jedem, der sich diesem Schiff unerlaubt nähert, wird es ähnlich ergehen.“
Das Gesicht des Gruppenführers verzerrte sich. Er konnte seine Wut nicht verbergen. Seine Rechte fuhr zur Pistole.
Hasard hatte seinen Drehling im selben Moment gezogen.
Bob Grey folgte seinem Beispiel.
Die vier Männer Don Cesare di Montepulcianos ließen ihre Waffen stecken. Der Anführer zitterte in seiner Wut, als er Befehl zum Rückzug gab. Er hatte begriffen, daß er und seine Gruppe gegen die Feuergeschwindigkeit des sechsläufigen Drehlings nicht das geringste ausrichten konnten.
Die Turmkammer enthielt keinen einzigen Einrichtungsgegenstand.
Die Menschen, die hierher gebracht worden waren, so vermutete Blacky, hatten keine Gemütlichkeit mehr gebraucht. Es war für sie nur eine Zwischenstation auf der Reise in den Tod gewesen.
Blacky war daher gezwungen gewesen, sich auf dem kahlen Steinfußboden auszustrecken. Nur einen winzigen Vorteil hatte die Kammer: Sie war nicht feucht wie ein Verlies in einem Kellergewölbe. Dafür strömte die Kälte der Nacht fast ungehindert herein. Immerhin waren die Kerle so gnädig gewesen, ihm die Kleidung überzustreifen, bevor sie ihn aus Gigliolas Kammer verschleppt hatten.
Und sie hatten ihn nicht gefesselt.
Wahrscheinlich hatten sie nicht die geringste Sorge, daß er ihnen entwischen könne.
Wenigstens war er in der Lage, sich auf dem Boden zusammenzurollen und in den schützenden Winkel von Wand und Fußboden zu verkriechen. Es half ihm jedoch herzlich wenig. Er horchte auf den Wind, der um den Turm heulte, und versuchte, andere Geräusche wahrzunehmen. Bestenfalls war da noch das Tosen der Brandung, tief unten, am Fuß der Steilküste. Aber es mochte auch seine Einbildung sein, die ihn glauben ließ, daß er dieses Tosen hörte.
Je mehr er versuchte, seine Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren als auf die Kälte, desto wacher wurde er. Bald fror er so jämmerlich, daß er am ganzen Körper zitterte. Er wußte, während des nächsten Tages würde er möglicherweise das Gefühl haben, in der Sonnenglut ersticken zu müssen. Die Temperaturunterschiede, die ihm bevorstanden, konnten ihn allein schon umbringen, wenn es denn nichts anderes war.
Irgendwann in dieser endlos scheinenden Zeitspanne erwachte er und konnte nicht fassen, daß er trotz allem geschlafen hatte. Allein seine Erschöpfung mußte der Grund gewesen sein.
Es war hell geworden.
Unmittelbar nach dieser Erkenntnis begann er zu frieren wie nie zuvor. Sein ganzer Körper wurde von Kälteschauern regelrecht durchgeschüttelt. Er rappelte sich auf und hieb sich die Arme um den Brustkorb. Dabei hüpfte er von einem Bein auf das andere, um den Fluß seines Blutes besser in Gang zu bringen. Bei jeder Bewegung dröhnte der Schmerz, der mit seinem Bewußtsein erwacht war, auf und ab wallend durch seinen Kopf.
Er hielt inne und spähte durch eines der seewärtigen Fenster.
Der Wind hatte nachgelassen. Das vom Sonnenaufgang rötlich gefärbte Meer war spiegelglatt. Denkbar, daß ihm die Windstille die Ruhe eines kurzen Schlafes gewährt hatte.
Er hörte Schritte.
Stirnrunzelnd drehte er sich um und verharrte bewegungslos.
Es waren Schritte von mehreren Männern. Die Sohlen ihrer Schuhe oder Stiefel polterten über Holz.
Blacky blickte zu der Bohlentür der Turmkammer. Die Tür war nach außen zu öffnen. Anzunehmen, daß sich dort eine Holztreppe befand, die in winkligen Abschnitten an der Außenmauer des Turms emporführte.
Blacky überlegte nicht mehr. Er öffnete die runde Luke in der Mitte der Kammer.
Das Wasser in der Tiefe war ruhig, der Sonnenschein tauchte auch die Klippen in rötliches Licht. Wer dort unten landete, wurde zerschmettert, bevor er versank. Möglich, daß einer noch einen Rest Lebens in sich hatte, wenn er von den schroffen Felsen ins Wasser rutschte. In einem solchen Fall war der Betreffende mit gebrochenen Armen und Beinen aber nicht mehr in der Lage, sich schwimmend ans Ufer zu retten.