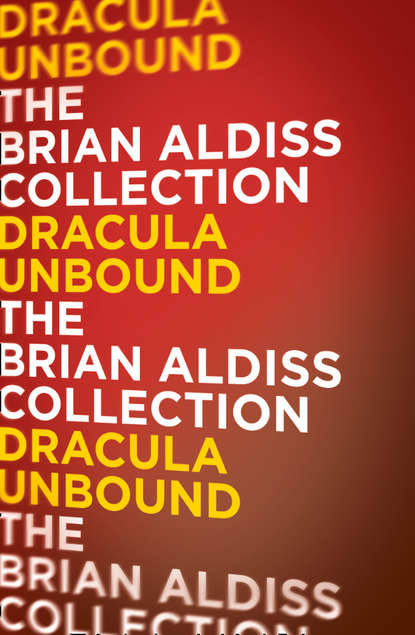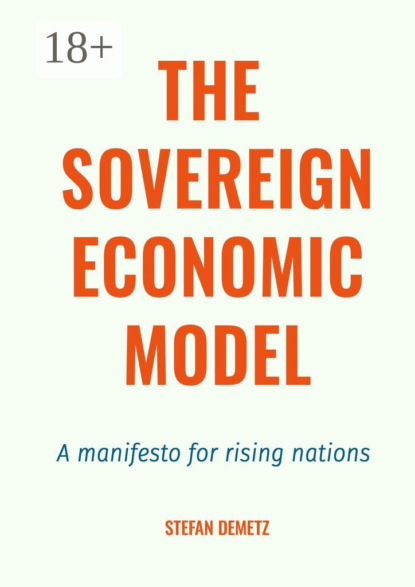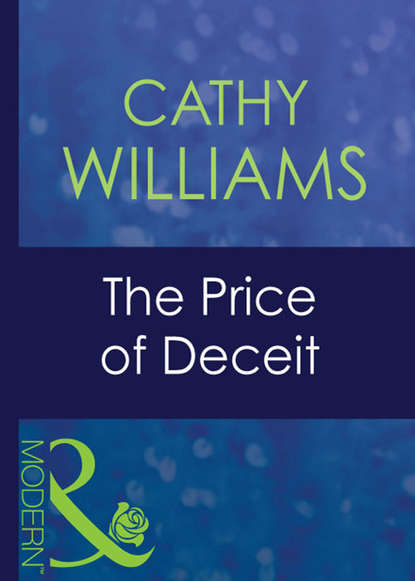Seewölfe Paket 30

- -
- 100%
- +
Es konnte nur daran liegen, daß er eine geradezu satanische Freude daran hatte, seinen Opfern so grausame Seelenqualen wie nur irgend möglich zuzufügen.
Er bereitete sich nicht die Mühe, in die Turmkammer hinaufzusteigen. Gemeinsam mit Cóstola wartete er am Fuß des Turms und ergötzte sich an den langanhaltenden Schreien der Männer, nachdem sie in die offene Luke gestoßen worden waren. Als die beiden dumpfen Aufschläge verklungen waren, wandte sich Don Marcello ab und steuerte auf den Palazzo innerhalb seines burgartigen Anwesens zu.
Emiliano Cóstola folgte ihm, nachdem er noch einen besorgten Blick auf das Meer hinausgeworfen hatte.
Es waren noch keine Verfolger zu sehen, was aber nichts besagte.
Man hatte jedoch Zeit, sich gründlich auf einen möglichen Angriff vorzubereiten.
Don Marcello zog sich in den großen Salon im oberen Stockwerk zurück und wies Cóstola an, ihm jegliche Störung vom Hals zu halten.
Der Mann mit dem Rabengesicht hatte volles Verständnis dafür, daß sein Brotgeber Zeit und Ruhe brauchte, um seine Gedanken zu ordnen und sich mit neuer Kraft gegen die Anfeindungen dieser Welt zu wappnen.
Mehr als eine halbe Stunde der Ruhe vermochte Cóstola dem Don allerdings nicht zu gewähren.
Dann war er gezwungen, in höchster Panik an die Tür zu klopfen und sie zu öffnen, ohne auf eine Erlaubnis zu warten.
„Ich habe doch gesagt …“, setzte Struzzo brüllend an.
„Don Marcello!“ schrie der Rabengesichtige. „Es hilft alles nichts! Wir werden angegriffen! Von zwei Seiten!“
Struzzo eilte mit seinem Rechtsberater auf den Wehrgang der Umfassungsmauer, um sich selbst zu überzeugen.
Von See her näherte sich die Schebecke der verfluchten Britenhunde.
Und auf dem Landweg marschierte eine Truppe heran, die an ihrer Kleidung nur zu deutlich zu erkennen war. Der Mann an der Spitze war ein beleibter, aber erstaunlich beweglicher Bursche.
Don Cesare di Montepulciano.
Die Anstrengung des Fußmarsches schien ihm jedenfalls nicht zuviel zu sein. Vielleicht lag es auch an der Wut, die ihn vorantrieb.
Außer Reichweite der Geschütze des Castello gab Don Cesare di Montepulciano seinen Männern das Zeichen zum Halten. Auf seinen Befehl hin versammelten sie sich hinter einem Waldstück am Wegesrand, wo sie – von den Bäumen geschützt – von der Burganlage aus nicht zu sehen waren.
Don Cesare hatte sechzig Männer zusammengeschart.
Jeder einzelne war mit Muskete, Pistole und Säbel bewaffnet. Eine Truppe, auf die man stolz sein konnte. In ihrem Kampfesmut waren diese Männer aus der Toskana unübertroffen.
Don Cesare ließ sie einen Halbkreis bilden.
„Wir sind kurz vor dem Ziel!“ rief er mit bebender Stimme. Sein Zorn auf den verfluchten Hund Struzzo hatte sich noch immer nicht gelegt und war eher stärker geworden. Die richtige Ausgangsbasis, um den Kerl ein für allemal zu besiegen. „Struzzo ist in die Enge getrieben worden, und er dürfte sich auch so fühlen. Halten wir uns eins vor Augen, Männer: Es ist endgültig genug damit, wie er sich aufführt. Er hat in Cagliari nicht alle Rechte für sich gepachtet. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Uns gehört die Zukunft! Wir werden den lächerlichen Figuren in diesem erbärmlichen Land zeigen, was Kultur ist. Dafür müssen wir kämpfen.“
Die Männer stimmten Bravorufe an.
Don Cesare bedankte sich mit gönnerhaften Handbewegungen.
„Wir dürfen aber nicht unvorsichtig werden“, fuhr er fort. „Das Castello des Don Marcello Struzzo ist schwer einzunehmen – vor allem wegen der Geschütze. Zwei Stück befinden sich am Haupttor, links und rechts, wie ihr wißt. Je ein weiteres auf den Wehrtürmen an der Südseite und an der Nordseite. Die Unterführer sollten jetzt Stoßtrupps einteilen, deren Aufgabe es sein wird, gleich während der ersten Angriffswelle die Geschützstellungen zu vernichten.“
Die Taktik war bereits vor dem Abmarsch gründlich erörtert worden.
Don Cesare ordnete eine halbstündige Pause an. Er hatte Zeit, sich zu dem geschlossenen Wagen zu begeben, der am Schluß der Kolonne mitgeführt wurde. Er öffnete die Tür und zog sich schnaufend auf die weichen Sitzpolster. Die Schwarzhaarige, die ihn verführerisch lächelnd erwartete, war fast noch ein Kind. Aber ihr Körper, den sie lediglich mit einem Gewand aus feiner Seide verhüllte, war der einer reifen Frau.
Sie öffnete das Gewand, wie Don Cesare es erwartete. Vor dem Kampf, das wußte sie, brauchte er sie und ihre berauschende Sinnlichkeit. Er legte seinen Gurt mit den Waffen ab. Er war ein schwergewichtiger Mann, mittelblond, von immer wieder überraschender Kraft und Ausdauer.
Doch die Freude vor dem Gefecht sollte ihm nicht gegönnt werden.
Kanonendonner rollte plötzlich heran, von See her.
Als Don Cesare die Wagentür aufstieß, war einer seiner Unterführer bereits zur Stelle.
„Schicken Sie einen Spähtrupp los“, befahl Montepulciano. „Ich will wissen, was sich da abspielt.“
Die Männer waren rasch wieder zur Stelle, nachdem sie das Castello in sicherer Entfernung umgangen hatten. Auf diese Weise erfuhr Don Cesare, daß draußen vor der Küste eine Schebecke das Feuer auf Struzzos Zweimaster eröffnet hatte.
Don Cesare war überzeugt, einen Glückstag erwischt zu haben.
Mehr als unverhoffte Verbündete konnte er sich nicht wünschen.
Er würde erst Struzzo und sein elendes Pack vernichten – und danach die Engländer, die sich in Cagliari so großspurig aufgespielt hatten.
Die Struzzo-Crew auf dem Zweimaster hatte offenbar nicht damit gerechnet, daß die Schebecke einen Angriff riskieren würde.
Deshalb waren die Kerle um Minuten zu spät ankerauf gegangen – in jenem Moment, als nicht mehr der leiseste Zweifel bestanden hatte, daß die Engländer tatsächlich das Wahnwitzige vorhatten.
Al Conroy hatte sie bereits mit der ersten Backbordbreitseite erwischt und ihnen im Vorbeirauschen noch eine Drehbassenladung in die Ruderanlage verpaßt.
Als die Schebecke wieder davonrauschte, blitzte Mündungsfeuer aus den beiden Geschützstellungen oberhalb der Steilküste auf.
Die Geschosse lagen um fünfzig Yards zu kurz.
Hasard ließ erneut Kurs auf den Zweimaster nehmen, der nun manövrierunfähig war. Im Beidrehen gab er den Feuerbefehl.
Sekunden später wummerte die Steuerbordbreitseite.
Batuti und Big Old Shane jagten Pulverpfeile von den Bogensehnen.
Die Siebzehnpfünder der Schebecke hämmerten den Zweimaster in Stücke. An Bord gab es keine Überlebenden.
Krachend detonierten die Pulverpfeile in den Geschützstellungen.
Keine weiteren Mündungsblitze zuckten dort oben auf. Die Geschützmannschaften hatten vorerst an ihrer Überraschung zu kauen.
Der Seewolf ließ die Segel wegnehmen. Pete Ballie manövrierte den Dreimaster so nahe an die Klippen vor der Steilküste heran, wie es ohne allzu großes Risiko möglich war. Unterdessen war Ferris Tucker auf dem Achterdeck mit Feuereifer dabei, seine Höllenflaschenabschußkanone aufzubauen. Al Conroy unterstützte ihn und bereitete die Ladungen und Lunten vor.
„Werft Anker!“ befahl Hasard mit klirrender Stimme. „Fiert Beiboot!“
Ben Brighton hatte sich auf das Hauptdeck begeben und überwachte das Austeilen von Waffen und Munition. Die ersten acht Mann besetzten das Beiboot. Sobald sie es geschafft hatten, das am Anlieger vertäute Beiboot des Zweimasters zu erreichen, konnte ein Pendelverkehr eingerichtet werden.
„Höllenflaschen klar zum Einsatz!“ brüllte Ferris Tucker.
„Dann setzt sie ein“, entgegnete Hasard.
Während die Männer in der Jolle mit kraftvollen Schlägen zum Ufer strebten, hatte Al Conroy die genau berechnete Lunte der ersten Höllenflasche gezündet. Behutsam legte er die mit Pulver, gehacktem Blei, Eisensplittern und rostigen Nägeln gefüllte Flasche in das Katapult.
Die Felswand der Steilküste war an dieser Stelle etwa hundert Fuß hoch. Noch einmal in gleicher Höhe ragte darüber rechter Hand der Turm auf, von dem Blacky berichtet hatte. Eine der Geschützstellungen befand sich in unmittelbarer Nähe des Turms, die zweite hundert Yards weiter südlich, an der dortigen Ecke des Anwesens.
Ferris Tucker überprüfte ein letztes Mal den eingestellten Winkel, dann löste er die Abschußkanone aus.
Zwischen den Geschützstellungen, hinter den Zinnen des Wehrgangs, tauchten Silhouetten auf, die Musketenläufe herausschoben. Von den Pulverpfeilen ließen sie sich nicht mehr beeindrucken.
Die Höllenflasche schnellte ihnen entgegen, ohne daß sie begriffen, was es war.
Batuti und Big Old Shane gingen zu Brandpfeilen über, die sie in höherem Bogen hinter die Umfassungsmauer schossen. Irgendwo dort mußte es brennbare Ziele geben.
Ferris Tuckers Schußwinkel stimmte bis auf den Zoll genau.
Mit brüllender Detonation flog die Höllenflasche etwa zehn Yards links von der Geschützstellung beim Turm auseinander. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Gellende Schreie und rückwärts taumelnde Gestalten verdeutlichten, daß sowohl die Geschützmannschaft als auch etliche der Musketenschützen außer Gefecht gesetzt worden waren.
Die nächste Höllenflasche war bereits unterwegs.
Und dann ging es Schlag auf Schlag.
Nur kläglich wenige Musketenschüsse peitschten von den Zinnen nach unten. Die Kugeln klatschten ins Wasser, ohne Schaden anzurichten.
In unablässiger Folge krachten die Höllenflaschen, während die Arwenacks bereits den Pendelverkehr mittels zweier Boote eingerichtet hatten. Die zweite Geschützstellung wurde gleichfalls ausgeschaltet. Erste Rauchschwaden stiegen hinter der Umfassungsmauer auf.
Will Thorne, der Kutscher, Mac Pellew, Old Donegal Daniel O’Flynn und die Zwillinge blieben an Bord der Schebecke zurück. Hasard setzte mit dem letzten Boot zur Küste über.
Als der Seewolf bei seinen Männern auf dem Felsenanleger eintraf, war deutlich zu hören, wie das Geschehen eine unerwartete Wende nahm.
Von der Landseite her waren Musketenschüsse, Geschützdonner und gellende Schreie zu hören.
Aber die Arwenacks hatten keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Hasard stürmte als erster die Felsenstufen hinauf. Blacky folgte ihm dichtauf. Er war von unbändigem Kampfeswillen beseelt.
Mit einer Höllenflasche sprengte Al Conroy die Luke aus mächtigen Bohlen, die oberhalb der Felsentreppe ins Innere der burgähnlichen Anlage führte. Falls sich jemand dahinter aufgehalten haben sollte, dann war er durch die Wucht der Detonation aus dem Weg geschleudert worden.
In breiter Front drangen die Arwenacks auf den Hof des Palazzo vor.
An der Landseite hatte der Kampfeslärm noch zugenommen. Voller Verzweiflung hatte Don Marcello Struzzo seine Verteidigungskräfte auf die dortigen Wehrgänge konzentriert. Er schien noch nicht einmal bemerkt zu haben, daß seine Verteidigungslinie an der Seeseite praktisch nicht mehr existierte.
Ungehindert stürmten die Männer auf das Haupthaus zu.
8.
Eine Gruppe von ungefähr zwei Dutzend Leibwächtern warf sich dem Seewolf und seinen Männern in der Halle des Palazzo entgegen.
Säbelklingen blitzten und klirrten.
Blacky sah noch, daß der rabengesichtige Halunke unter den Verteidigern des Haupthauses war. Hasard nahm ihn sich vor und streckte ihn nach einem kurzen Säbelduell nieder.
Blacky zögerte nicht, sich unbemerkt abzusondern, als er in die Nähe der breiten Treppe geriet, die zum oberen Balustradengang führte. Es war ein Instinkt, der ihn leitete. Und das Verlangen nach Rache beseelte diesen Instinkt.
Er erreichte den Treppenabsatz und lief mit blankgezogenem Säbel nach links. Die Vermutung, daß sich Struzzo zumindest innerhalb der Mauern dieses Gebäudes aufhielt, lag nahe. Er hatte keinen Grund, sich an die Front zu begeben. Andere konnten für ihn die Kastanien aus dem Feuer holen. So war es im Falle des Don Marcello vermutlich immer gewesen.
Blacky stieß die Türen nacheinander auf.
Nur die halbe Strecke des Balustradenganges brauchte er hinter sich zu bringen.
Der Salon bestach durch einen brusthohen Kamin aus wertvollem weißem Marmor.
Blacky verharrte in der offenen Tür.
Don Marcello Struzzo stand vor dem Kamin. In seiner Rechten lag eine doppelläufige Pistole, deren Stahl mit silbern ausgelegter Gravur verziert war. Die Hand des Mannes mit dem kantigen Gesicht zitterte. Das Zittern übertrug sich auf die schwere Waffe. Alles zerrte an seinen Nerven. Der Kampfeslärm von der Landseite des Castello ebenso wie die Schreie und das Säbelklirren aus der Halle des Palazzo.
Blacky hielt den Säbel gesenkt.
Der Sarde starrte ihn an, als habe er es mit einem Gespenst zu tun.
„Du täuschst dich nicht, Struzzo“, sagte Blacky eisig. „Ich bin es wirklich.“
Das Gesicht des Don verzerrte sich. Er flüsterte einen Fluch.
„Mit gegebenen Tatsachen muß man sich keineswegs abfinden“, zischte er. „Laß den Säbel fallen und ergib dich, Engländer!“
Blacky lachte spöttisch. „Du willst mich als Geisel?“
„Allerdings.“
„Schlag dir das aus dem Kopf. Daraus wird nichts.“
„Den Säbel weg!“ kreischte Struzzo. „Oder ich schieße!“
„Tu’s“, entgegnete Blacky, und er wirkte dabei völlig gelassen. In Wahrheit waren seine Nerven zum Zerreißen angespannt. „In deinem Zitterzustand würdest du nicht mal einen Pottwal auf fünf Yards Entfernung treffen.“
„Schweig!“ schrie Struzzo. „Dies ist meine letzte Warnung! Weg mit dem Säbel!“ Er strengte sich höllisch an, die Doppelläufige ruhig zu halten. Doch je mehr er sich anstrengte, desto heftiger wurde sein Zittern.
Blacky hob den Säbel und ging einen Schritt auf den Sarden zu.
Don Marcello stieß einen schrillen Wutschrei aus. Sein Zeigefinger krümmte sich jäh. Er verriß die Waffe.
Im Krachen des Schusses duckte sich Blacky unwillkürlich.
Aber er spürte nicht einmal das Sengen des Geschosses. Die Kugel war irgendwo hoch über dem Türrahmen in die Wand geklatscht.
Ruhig setzte er seinen Weg fort.
„Das war nur ein Warnschuß!“ schrie der Don mit sich überschlagender Stimme. „Die nächste Kugel trifft!“
„Daran glaubst du wohl selbst nicht“, entgegnete Blacky voller Spott.
Das ließ etwas in seinem Gegenüber zerreißen. Etwas, das die letzte Beherrschung in ihm aufrechterhalten hatte.
Sein zweiter Schuß war noch überhasteter als der erste.
Das Geschoß sirrte weit links an Blacky vorbei und zersprengte eine kleine Marmorstatue auf einem Wandsockel in tausend Stücke. Blacky sah es nur aus den Augenwinkeln heraus. Er achtete nicht weiter darauf.
Struzzos Gesicht war eine Fratze aus Angst und Wut. Er schleuderte die wertlose Pistole von sich und griff zum Dolch.
Blacky ging weiter auf ihn zu und fegte ihm die rasiermesserscharfe Waffe mit einem einzigen Hieb aus der Hand.
Struzzo wirbelte herum und riß einen Säbel an sich, der über dem Kaminsims aufgehängt war. Mit einer wilden Attacke stürmte er auf den breitschultrigen Engländer los.
Blacky gelang es geradezu mühelos, mit einem tänzelnden Schritt zur Seite auszuweichen.
Struzzo fing seinen Schwung ab und war im nächsten Sekundenbruchteil wieder zur Stelle. Mit waagerecht vorgereckter Klinge schnellte er auf den Gegner zu, der ihm immer unheimlicher wurde.
Blackys Reaktion funktionierte auch diesmal auf den Sekundenbruchteil genau. Struzzo lief in seinen Säbel hinein, wankte und kippte zur Seite weg.
Das Gefühl der gelungenen Rache, wie Blacky es sich vorgestellt hatte, entstand nicht.
Bevor er einen weiteren Gedanken fassen konnte, ertönte eine eisige Stimme von der Tür her.
„Danke, daß du mir die Arbeit abgenommen hast, Engländer. Ich werde allerdings nicht umhin können, dich mit einer Kugel dafür zu belohnen. Und in meinem Fall kannst du sicher sein, daß es keine zittrige Hand gibt, die dich rettet.“
Don Cesare di Montepulciano mußte hinter der Tür, auf dem Balustradengang, gelauert und alles mitgekriegt haben. Breit und massig füllte er den Türrahmen aus. In seiner Rechten lag ein Radschloßdrehling, ähnlich wie Hasard ihn verwendete. Gegen eine solche Waffe gab es kaum eine Chance.
Blacky erstarrte.
Sein Säbel steckte in Struzzos leblosem Körper. Und seine Pistole konnte er nicht ziehen, ohne daß Montepulciano den ersten Schuß abfeuerte.
Der schwergewichtige Toskaner trat näher, ohne den Drehling auch nur um ein Haar aus der Visierlinie zu nehmen.
Unten, in der Halle, wurde noch gekämpft.
An der Vorderseite des Anwesens versiegten die Schüsse.
Blacky hob die Hände und wich bis zum Fenster zurück. Am Rand seines Blickfelds konnte er sehen, daß da keine triumphierend brüllenden Horden waren, die auf den Hof des Palazzo vordrangen. Montepulcianos und Struzzos Kerle hatten sich gegenseitig niedergemetzelt. Die wenigen, die am Leben geblieben waren, hatten offenbar die Gunst der Stunde erkannt und sich für immer abgesetzt.
Und Don Cesare mußte in einem günstigen Moment von der Seite des Haupthauses her eingedrungen sein. Seine ursprüngliche Absicht war es wohl gewesen, den Hausherrn als Geisel zu nehmen. Jetzt blieb ihm nur Blacky, um sich gegen die Engländer durchzusetzen.
„Sie schaffen es nicht“, sagte Blacky und versuchte, äußerlich ruhig zu bleiben. „Meine Freunde werden jeden Moment hier sein.“
„Reines Wunschdenken“, entgegnete Don Cesare grinsend. „Außerdem werde ich mich freuen, sie zu sehen, denn sie werden miterleben, wie ich dich töte.“
Blacky blickte über seine Schulter.
„Sie werden nicht einmal eine Kugel aus dem Lauf kriegen“, sagte er.
Don Cesare di Montepulciano lachte schallend.
„Du glaubst, auf diesen uralten Trick falle ich herein? Mein Gott, für was hältst du mich, daß du annimmst, ich wäre so einfältig!“
Er krümmte den Zeigefinger.
Es krachte tief und wummernd. Das typische Schußgeräusch des Drehlings.
Blacky hatte sich vorsorglich zu Boden fallen lassen.
Er verspürte keinen Einschuß, und er hörte keine Kugel, die irgendwo in die Wand klatschte.
Statt dessen vernahm er das schwere Fallgeräusch eines menschlichen Körpers.
Blacky rappelte sich auf.
Don Cesare di Montepulciano lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Teppich. Der Drehling war ihm aus der Hand gefallen.
Hasard hob die Waffe auf, die der seinen so sehr ähnelte.
„Er hat die Kugel nicht aus dem Lauf gekriegt, Blacky.“
Der breitschultrige Engländer nickte und lächelte. „Ich muß mich schon wieder bedanken. Verdammt, das ist jetzt das zweite Mal, daß du im letzten Augenblick …“
Der Seewolf winkte ab.
Sie verließen den Palazzo.
Die Streitmächte der beiden Dons hatten sich gegenseitig aufgerieben. Für die Arwenacks bestand kein Anlaß, sich länger am Schauplatz des blutigen Geschehens aufzuhalten. Sie kehrten auf die Schebecke zurück und nahmen Kurs auf den Hafen von Cagliari. Denn dorthin mußten sie noch einmal. Zum einen mußten sie endlich die Positionen auf ihrer Vorratsliste abhaken. Und zum anderen gab es niemanden an Bord, der Blacky nicht jenen letzten Besuch gönnte, ohne den er die Stadt unmöglich verlassen konnte.
Dunkelheit hatte sich über die Stadt gesenkt. Die Abendluft war mild, und überall in Cagliari hielten sich die Menschen im Freien auf. Einige feierten überschwenglich, andere verbrachten die Stunden zwischen Tag und Morgen in aller Stille bei einer Flasche Wein.
Aus dem Hof des kleinen Hauses drangen die, lärmenden Stimmen bis in die Kammer hinauf. Blacky konnte Gigliola ohne Nachdenken sagen, wem jede einzelne Stimme gehörte. Edwin Carberry, Ferris Tucker, Batuti …
Porfirio Nócciolo hatte sich nicht davon abbringen lassen, die Arwenacks für den Abend einzuladen. Er hatte zwei Schweine am Spieß gebraten und eine Batterie von Weinfässern auf dem Hof aufbauen lassen.
Der Seewolf hatte schließlich zugestimmt.
Die Menschen in Cagliari waren von einer doppelten Geißel befreit. Und gerade Vater und Tochter Nócciolo hatten Grund, sich darüber zu freuen.
Niemand hatte auf Blacky und Gigliola geachtet, als die beiden sich zurückgezogen hatten.
„Hör mal!“ hauchte Gigliola und schmiegte sich an Blacky. „Kennst du diese Stimme?“
Blacky brauchte nicht lange die Ohren zu spitzen.
Denn die Stimme übertönte die meisten anderen. „Du kannst es mir glauben, Hasard, dem Tabak gehört die Zukunft! Laß uns einen Vertrag schließen. Du wirst mein Handelsagent in England und sorgst dafür, daß ich den Tabak kriege, den ich hier absetzen kann. Ich werde das Monopol für Sardinien haben! Kein Don Marcello kann mich jetzt noch daran hindern! Natürlich beteilige ich dich am Gewinn und …“
Blacky stand auf und schloß das Fenster.
Dann kehrte er zu der hübschen jungen Frau zurück, die ihn mit ausgebreiteten Armen erwartete …
ENDE

1.
Mit versteinert wirkendem Gesicht lauschte der Fischer Domingo Calafuria dem Grölen und Lachen der Piraten. Er ballte die Hände zu Fäusten und biß die Zähne aufeinander. Es fiel ihm schwer, seine Wut und Ohnmacht zu beherrschen.
Rodrigo, sein Sohn, hockte neben ihm auf dem Boden. Er hatte die Knie an den Leib gezogen und hielt die Beine mit den Händen umklammert. Der Haß verzerrte seine Züge.
Asuncion, die Frau des Fischers, und Pamela, Rodrigos Schwester, hatten sich auf einem der primitiven Nachtlager ausgestreckt. Asuncion bewegte einen Rosenkranz zwischen ihren Fingern und betete leise. Das Mädchen weinte verhalten vor sich hin.
„Diese Teufel“, flüsterte Domingo Calafuria. „Wenn sie doch alle sterben würden.“
„Den Gefallen werden sie uns nicht tun“, murmelte Rodrigo. „Seit zwei Wochen haben sie unser Dorf besetzt und erfreuen sich bester Gesundheit.“
„Sie wohnen in unseren Häusern, essen unsere Nahrung, trinken unseren Wein, schänden unsere Frauen“, sagte Domingo. „Sie schlagen uns, wenn wir uns auflehnen. Sie töten uns, wenn ihnen danach ist.“
„So ist es Pablo ergangen“, sagte Rodrigo. „Er stach einen der Hunde mit seinem Messer nieder, dann versuchte er, Olivaro zu erledigen. Aber Olivaro war schneller. Seine Klinge traf Pablo ins Herz.“
„Hör doch endlich auf“, sagte Pamela. Sie wandte den Männern ihr tränennasses Gesicht zu. „Ich kann es nicht mehr ertragen. Lieber will auch ich sterben.“
„Rede keinen Unsinn“, sagte ihr Bruder. „Bislang haben sie uns verschont.“
Asuncion Calafuria unterbrach ihr Gebet.
„Sie tun es sicherlich nicht aus purer Nächstenliebe“, erwiderte sie gedämpft. „Wenn sie wieder eins ihrer sündigen Feste feiern, werden sie auch uns holen.“
„Lieber sterbe ich“, sagte Pamela noch einmal.
„Es gibt nur einen Weg“, murmelte Rodrigo. „Wir müssen uns befreien und fliehen.“
„Wie willst du das anstellen?“ fragte seih Vater.
„Mir fällt schon noch etwas ein.“
„Urbano hat es versucht“, gab Pamela zu bedenken. „Urbano ist ein mutiger Mann. Sie haben ihn gefaßt und halb totgeschlagen. Er ringt noch immer mit dem Tod.“
Sie schwiegen und lauschten dem Wind, der mit zunehmender Kraft über die Dächer der Häuser orgelte. Das Rauschen der See war deutlich zu vernehmen. Draußen braute sich ein schwerer Sturm zusammen.
Domingo wußte, daß es ein Orkan werden würde. Er war in diesem Dorf geboren und aufgewachsen und hatte schon mit vier Jahren auf den Planken gestanden. Er spürte die See mit jeder Faser seiner Nerven und hatte einen unterschwelligen Instinkt für jede Entwicklung.
Domingo Calafuria und seine Familie hockten in dem Keller unter dem größten Haus des Dorfes. Über ihnen lärmten Olivaro und die Piraten. Die Kerle wußten, daß beim Sturm so manches Schiff die Insel anlaufen würde.
Jede Bucht war als Nothafen recht – aber kein Seemann ahnte, daß im Süden von Mallorca eine blutrünstige Bande lauerte, die auf solche Beute nur wartete.
Olivaro und seine Kerle überfielen jedes Schiff, schnitten der Mannschaft die Gurgeln durch und plünderten alles aus. War der Segler gut in Schuß, dann rissen sie sich auch diesen unter den Nagel.