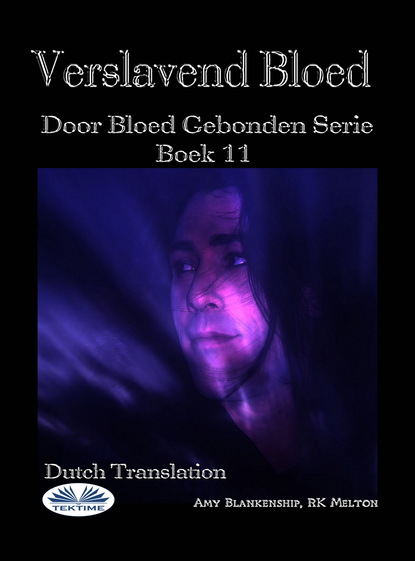Seewölfe Paket 7
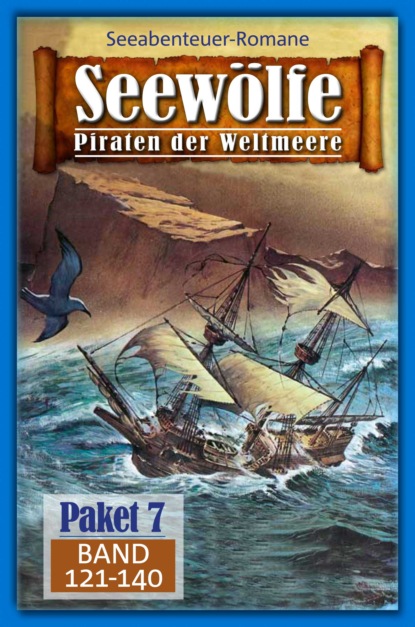
- -
- 100%
- +
„Si, Capitan. Eine Frage bitte.“
„Fragen Sie!“
„Was geschieht, wenn wir herausfinden, daß Wilde das Schiff angegriffen haben?“
De Aragon lächelte hochmütig. Seine Mundwinkel krümmten sich verächtlich.
„Daß Sie diese Frage überhaupt stellen, Lopez. Eine Antwort darauf erübrigt sich fast, und Sie werden sich diese Antwort auch denken können. Selbstverständlich werden wir zu einer Strafexpedition rüsten und dieses anmaßende Gesindel bis auf den letzten Mann ausrotten. Das geschieht in diesem Fall im Auftrag seiner Allerkatholischsten Majestät, des Königs von Spanien.“
„Aber – aber“, stotterte Lopez, „wir haben doch keinen regulären Auftrag dazu.“
„Einen derartigen Auftrag haben wir immer, Lopez“, sagte De Aragon überheblich. „Das ergibt sich von selbst.“
Lopez kannte seinen Capitan. De Aragon behandelte seine Leute nicht gerade schlecht, aber er verstand keinen Spaß, wenn es um unerforschte Länder oder Eingeborene ging. Dann heimste er im Auftrag der Krone alles zusammen, ohne Rücksicht auf Verluste, und dann war für ihn alles Gesindel, dem man Anstand beibringen mußte. Zumeist brachte er ihnen diesen Anstand mit den Schiffskanonen bei, und der Rest wurde von den Seeleuten besorgt, einfachen Männern, die nicht im Kriegsdienst standen.
Bei Lopez war das anders. Er verabscheute Gewalt, und es war ihm peinlich, sich das von den Einheimischen zu nehmen, was ihnen nicht zustand, und sie anschließend auch noch zu „bekehren“, wie De Aragon sich ausdrückte.
Andererseits, überlegte Lopez, geschah diesen Wilden ganz recht, wenn sie sich anmaßten, Schiffsbesatzungen zu überfallen, die vielleicht nichts anderes wollten als Trinkwasser und Proviant.
Er grübelte über das Thema nicht weiter nach. Auf diese Art behielt er ein ruhiges Gewissen, denn alle Entscheidungen nahm De Aragon ihm ohnehin ab.
Einen Ankerplatz fanden sie jedoch nicht. Rings um die Insel fiel der Meeresboden steil ab in unergründliche Tiefen, und an die Insel selbst traute De Aragon sich nicht heran, aus Angst, die „Tierra“ würde auf ein unsichtbares Riff laufen.
„Was ist mit Ihnen, Lopez?“ hörte er die harte Stimme des Capitans neben sich. „Sie haben doch etwas auf dem Herzen, Sie wollen etwas loswerden, nicht wahr?“
Für Lopez war das Thema Strafexpedition längst erledigt. Er brauchte nur Befehlen zu gehorchen, aber etwas anderes beschäftigte ihn seit einer ganzen Weile.
„Ja, ich – ich wollte zuerst nicht darüber sprechen. Es handelt sich um diesen Virgil.“
De Aragon beugte sich neugierig vor.
„Ja – was ist mit ihm?“
„Ich weiß nicht recht, Capitan, aber da war noch der andere Tote auf der Insel.“
„Lassen Sie mich keine Rätsel raten, Lopez. Reden Sie, was hat es mit dem Mann auf sich?“
„Dem anderen Mann fehlten ein Bein und der Arm.“
De Aragon kniff die Augen zusammen. Sein Gesicht verschloß sich.
„Zum Teufel“, entfuhr es ihm endlich, „wollen Sie damit etwa sagen, daß dieser Virgil seinen Kumpan gefressen hat?“
„So drastisch wollte ich es nicht ausdrücken, Capitan. Auf der Insel gibt es sonst nichts zu essen, außer einer Handvoll unreifer Kokosnüsse. Mich schaudert bei dem Gedanken, einen Mann an Bord zu haben, der vielleicht …“
„Allerdings, doch darüber will ich nicht urteilen. Wer weiß, welches Drama sich auf der Insel abgespielt hat. Hoffentlich werden wir es bald erfahren. Es kann ja aber auch sein, daß der andere seine Gliedmaßen bei dem Kampf verloren hat und schon tot war, als sie die Insel erreichten.“
Das hoffte Lopez auch, denn wenn er darüber nachdachte, drehte es ihm den Magen um. Aber was wußte er schon von Leuten, die ohne Wasser und Lebensmittel auf einer winzigen Insel dahinvegetierten.
Zwei Stunden später war Virgil bei Bewußtsein, und zwar auf eine Art, die sich der Feldscher nicht erklären konnte.
De Aragon ging nach achtern und blickte mit gemischten Gefühlen den Mann an, der ihn eher an eine Leiche als an ein menschliches Wesen erinnerte.
Der Mann hockte aufrecht in der Koje und schien zu grinsen.
„Ich begreife das nicht“, sagte der Feldscher, „normalerweise müßte er tot sein. Aber er benimmt sich so, als fehle ihm nicht das geringste.“
„Schon gut. Hauptsache, er kann reden.“
De Aragon schickte den Feldscher hinaus und wandte sich dem Mann zu, der ihn ruhig und gelassen anblickte.
„Ich bin der Kapitän“, sagte er. „Sie befinden sich an Bord der ‚Tierra‘, nachdem wir Sie von der Insel geholt haben.“
„Die Insel“, sagte Virgil ausdruckslos. „Haben Sie den Steuermann auch mitgenommen? Antonio heißt er.“
„Das war der Steuermann des Schiffes? Er ist tot, Sie müßten das doch wissen.“
De Aragon musterte den Mann scharf, doch keine Reaktion erfolgte.
Virgil nickte nur. „Ich dachte es mir fast.“
Seine Stimme klang ruhig und fest. Nur beim Atmen rasselte es in seiner Brust.
„Erzählen Sie, was sich an Bord zugetragen hat, Virgil. Was ist aus der Mannschaft und dem Schiff geworden?“
Virgil blickte zu Boden. Lange Zeit gab er keine Antwort.
„Wir landeten an der Küste von Kalimantan oder wie die Insel heißt, wenn es überhaupt eine Insel ist. Wir wollten Wasser und Proviant an Bord nehmen.“
„Es ist eine Insel, eine sehr große. Was geschah dann?“
Virgils Hände zitterten plötzlich. Über seinen Körper, lief ein kühler Schauer. Sein Gesicht war von Angst gezeichnet.
„Ein Trupp ging an Land“, sagte er keuchend. „Sie sollten sich nach Wasser und Früchten umsehen. Als der Trupp bis zum späten Nachmittag nicht zurück war, ließ der Capitan eine Suchmannschaft zusammenstellen.“
„Und die kehrte ebenfalls nicht zurück?“
„Nein, wir haben nichts mehr von den Männern gehört.“
„Weiter“, sagte der Capitan drängend.
Virgil bereitete es sichtlich Mühe, zu sprechen. Seine Worte stockten, manchmal brach er mitten im Satz ab und starrte vor sich hin.
„Schließlich waren wir nur noch zwölf Mann an Bord. Wir alle hatten Angst, und so befahl der Capitan, daß jeder schwer bewaffnet wurde. Er ließ Schüsse aus den Culverinen abfeuern, aber wir erhielten keine Antwort. Die ganze Insel schwieg und schien wie ausgestorben zu sein. Ein weiterer Trupp ging vorsichtig an Land, und diese Männer kehrten wenig später auch zurück. Sie brachten Köpfe mit.“
„Köpfe?“ fragte De Aragon entsetzt.
„Ja, auf der Insel gab es Wilde, die unsere Leute in einen Hinterhalt lockten und ihnen die Köpfe abschlugen. Die Körper waren jedoch nirgends zu finden. Sie müssen sie mitgenommen haben.“
„Kannibalen, Menschenfresser“, sagte De Aragon. „Bestien in Menschengestalt.“ Er schüttelte sich angewidert.
„Mir – mir ist so merkwürdig“, sagte Virgil. „Warum wird es plötzlich so dunkel?“
„Sie haben sich überanstrengt“, erwiderte der Capitan mitfühlend. „Legen Sie sich wieder hin, ich lasse Ihnen etwas zu essen bringen.“
Virgil schüttelte den Kopf.
„Nein, nein, ich muß das loswerden“, sagte er hastig. „Jetzt kehrt auch die Erinnerung wieder. Wir fanden von den Wilden keine Spur mehr, aber wir sahen ein Dorf, das sie verlassen hatten. Nachts schwirrten plötzlich Brandpfeile durch die Luft, und plötzlich waren sie da, an Deck. Das Schiff wimmelte von nackten Leibern, und diese Teufel erschlugen einen nach dem anderen, obwohl wir alle Waffen einsetzten, die wir hatten.“
De Aragons Gesicht war zu einer steinernen Maske geworden. Die Wangenmuskeln traten scharf hervor.
„Wissen Sie, wo der Ort liegt?“ fragte er.
„Weiter südlich, es ist, glaube ich, nur das eine Dorf, jedenfalls das allererste. Glauben Sie mir, Senor Capitan, ich habe nie in meinem Leben etwas Schlimmeres gesehen. Wenn wir zehn von ihnen umgebracht hatten, tauchten zwanzig andere auf. Der Steuermann und ich sprangen ins Wasser und zogen uns in das Boot, in dem auch eine Muskete lag. Ein paar konnten wir noch töten, dann entdeckten sie uns in dem Moment, als einer von ihnen gerade den Capitan erschlug. Die Galeone muß untergegangen sein, denn sie stand in hellen Flammen, als wir mit dem Boot lossegelten. Außer uns beiden hat keiner das Massaker überlebt.“
De Aragon ließ sich seinen unbändigen Zorn nicht anmerken. Er stand auf und nickte.
„Einen Augenblick, Virgil.“
Er ging an Deck und rief Lopez herbei.
„Lassen Sie auf den alten Kurs zurückgehen, Lopez. Wir laufen die Küste an und segeln dicht daran entlang. Jeder Fetzen Tuch wird gesetzt.“
„Si, Senor Capitan, sofort.“
Lopez stellte keine Fragen, aber er ahnte, was vorgefallen war.
De Aragon kehrte in die achtere Kammer zurück und bot Virgil einen Rotwein an, doch der wollte nichts essen und erst recht nichts mehr trinken.
„Ich brauche nichts mehr“, sagte er, „mit mir geht es bald zu Ende, ich fühle das.“
Seine magere Hand griff nach dem Arm des Capitans, und er sah ihm beschwörend in die Augen.
„Wenn Sie das Dorf anlaufen, Senor, dann nehmen Sie sich vor den Teufeln in acht, die ehrbaren Männern die Köpfe abschlagen und ihre Körper verschleppen, um sie zu fressen, sonst ergeht es Ihnen, wie es uns ergangen ist.“
„Keine Angst, wir sind gewarnt. Ich sorge mich um Sie, Virgil, Sie müssen etwas trinken!“
„Vielen Dank. Ich habe mir auf der verdammten Insel den Tod geholt. Er hockt in mir, er lauert auf mich.“
„Quatsch, Sie sind über den Berg, mit Ihnen geht es aufwärts. Erzählen Sie mir, was sich auf der Insel abgespielt hat.“
Virgil lächelte gequält. „Ich sehe es wieder ganz deutlich vor mir. Merkwürdig, nicht wahr? Antonio starb nach ein paar Tagen.“
De Aragon hielt den Atem an, er sagte kein Wort.
„War er schwer verletzt?“ fragte der Capitan schließlich, als Virgil nicht weitersprach.
„Nein, ihm fehlte nichts, er war nur erschöpft wie ich auch. Er muß an Erschöpfung, Hunger und Durst gestorben sein, und ich war jetzt ganz allein. Als ich den Geruch nicht mehr aushielt, schleppte ich seine Leiche ins Meer, doch bald darauf kehrte sie wieder zurück. Eine Welle warf ihn an den Strand. Die Haie müssen seinen Körper zerfetzt haben.“
Jetzt ist das auch geklärt, dachte der Capitan. Dieser Mann mußte durch tausend Höllen gegangen sein.
Normalerweise war es bei De Aragon nicht üblich, daß er sich fast leutselig mit einem Seemann unterhielt. Aber das hier war ein ganz besonderer Fall, und ihm stand ein Mann gegenüber, der mehr Bildung hatte als seine ganze Crew zusammen. Daher war seine Sorge um Virgil echt und entsprang einem natürlichen Bedürfnis.
Er ließ sich noch erklären, wie lange sie unterwegs gewesen waren, und versuchte danach in etwa die Entfernung auszurechnen. Aber er konnte sich auch nach dem Dorf richten, dem einzigen an dem Küstenstreifen, wie Virgil versicherte.
„Legen Sie sich wieder hin“, befahl er. „Wir segeln jetzt nach Kalimantan und werden dieses Dorf finden. Und dann gnade Gott diesen Bestien. Ich werde dort aufräumen.“
Virgil war zurückgesunken und schlief. Immer noch rasselte es in seiner Brust.
Vielleicht schläft er sich gesund, dachte der Capitan. Ein Kerl von solch unglaublicher zäher Kondition würde es überleben, daran zweifelte er keine Sekunde.
Als er an Deck trat, segelte die „Tierra“ unter vollem Zeug nach Süden, der Insel entgegen, und am späten Abend wurde erneut Land gemeldet.
Als es dämmerte, ließ De Aragon bei einer Tiefe von neun Faden ankern. Er wollte nicht mehr weitersegeln, um das Dorf der Menschenfresser nicht zu verfehlen.
An Deck gingen die ganze Nacht über acht Mann Wache, und zwei umruderten alle Viertelstunde in dem kleinen Beiboot das Schiff. De Aragon paßte auf, ihm sollte nicht das gleiche Schicksal widerfahren wie den anderen. Bei ihm war ein Überraschungsangriff durch die Wilden fast auszuschließen.
3.
Bei Tagesanbruch wurde der Anker eingeholt, und die Zweimastgaleone segelte dicht unter Land weiter.
Es hatte sich bei der Mannschaft herumgesprochen, was Virgil erlebt hatte, und daß der Capitan plane, die Höllenbrut auszuräuchern, wie er sich ausdrückte.
Die Leute brannten darauf, Rache zu nehmen.
De Aragon befahl dem Koch, eine kräftige Brühe für den entkräfteten Mann zu kochen und trug sie selbst nach achtern.
Virgil lag immer noch in der gleichen Stellung in der Koje, aber sein Atem rasselte nicht mehr.
Vorsichtig versuchte De Aragon ihn zu wecken, und als Virgil nicht reagierte, drehte er ihn herum.
Er sah in zwei gebrochene Augen, die verschleiert ins Nichts blickten. Virgil war tot.
Der Capitan schluckte. Mitleid mit dem armen Kerl stieg in ihm auf. Er erinnerte sich der Worte von gestern, als Virgil behauptete, er brauche nichts mehr, er würde ohnehin bald sterben.
Erschüttert kehrte er an Deck zurück, in der Hand die Muck mit der heißen Brühe.
„Diablo“, sagte er laut, nahm die Muck und schleuderte sie in einem Wutanfall über Bord. Dann winkte er Lopez herbei.
„Der Mann ist gestorben, Lopez. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Sagen Sie dem Segelmacher Bescheid, er soll die Leiche einnähen. Nachher werden wir ihn bestatten.“
Der Steuermann war fassungslos.
„Virgil tot?“ fragte er verdutzt. „Aber gestern lebte er noch“, fügte er wenig geistreich hinzu.
„Viele, die gestern noch lebten, sind heute tot“, antwortete De Aragon, und wieder erschien dieser herablassende Ausdruck in seinem Gesicht, der den Steuermann ärgerte.
Der Tote wurde aus der Kammer geholt. In der Kuhl begann der Segelmacher damit, die Leiche in festes Segelzeug einzunähen.
Schweigend stand der größte Teil der Crew herum. Sie alle bedauerten diesen Mann, und inzwischen kannte auch jeder seine abenteuerliche Geschichte.
De Aragon übergab ihn nicht einfach der See, indem sie ihn über Bord stießen.
Er nahm sich die Zeit, ließ die Segel aufgeien, bis das Schiff keine Fahrt mehr lief und leicht in den Wellen dümpelte. Aus dem Laderaum wurde eine hölzerne Rutsche geholt, auf die sie den in Segelleinen genähten Mann legten.
Eine Minute herrschte Schweigen. Der Capitan sprach ein paar kurze Sätze und schloß mit den Worten: „Gott empfohlen, der seiner Seele gnädig sei. Amen!“
„Amen“, antwortete dumpf der ganze Chor harter Seeleute.
Die Rutsche wurde geneigt. Der verhüllte Körper glitt in die blaugrüne See, als hätte er es eilig, den Grund zu erreichen.
Eine Weile konnten sie das Bündel verfolgen, dann deckte die See es zu und ließ es verschwinden.
Die ins Gei gehängten Segel wurden gesetzt, und die „Tierra“ nahm wieder Fahrt auf.
Erst am nächsten Tag meldete der Ausguck das Dorf, das sich in einer kleinen Bucht versteckt zwischen Mangrovendickichten befand. Es waren Hütten, die teilweise auf langen Stämmen im Wasser standen, aber es gab auch andere, die man an Land in das Dickicht hineingebaut hatte.
Capitan De Aragon ließ beidrehen und ging in den Wind. Dabei beobachtete er das Dorf, sah aber keinen einzigen Eingeborenen.
„Es muß das Dorf sein, von dem Virgil erzählte“, sagte er zu Lopez. „Sind die Culverinen geladen, sind an alle Männer genügend Waffen verteilt worden?“
„Si, Senor Capitan. Ich erwarte Ihre Befehle.“
Die „Tierra“ hatte auf jeder Seite drei Siebzehn-Pfünder-Culverinen, an denen die Männer standen. Die Stückpforten waren hochgezogen, doch noch bevor De Aragon näher an die Bucht heranmanövrieren konnte, sahen sich die Männer besorgt und erstaunt zugleich an.
Es war wie verhext. Der Wind begann zu drehen und wurde böig. Kleine harte Wellen entstanden im Wasser. Der ablandige Wind drückte die Galeone sanft, aber unnachgiebig wieder vom Land fort.
De Aragon fluchte unterdrückt. Er biß die Zähne zusammen und wartete. Sie hatten Zeit.
4.
Es war der erste März 1585, als die „Isabella VIII.“ unter dem Seewolf Philip Hasard Killigrew nach fast tausend Meilen, die sie von Manila über Palawan geführt hatten, die Rieseninsel Kalimantan erreichte.
An diesem frühen Morgen hockte der schwarzhaarige, schlaksige Moses Bill im Ausguck, der Bengel, wie er an Bord von allen genannt wurde.
Außer Wasser hatte er tagelang nichts gesehen, und so war er für jede noch so kleine Abwechslung dankbar, die diesmal in Gestalt des Kutschers erschien.
Er schlurfte aus dem Mannschaftsraum an Deck, gähnte laut und ausgiebig, reckte seine magere Brust heraus und angelte dann mit einer Lederpütz nach Wasser.
Bill schaute ihm aus seiner luftigen Höhe zu und grinste, als der Kutscher zum zweiten Mal gewaltig das Maul aufriß und gähnte, als wolle er die „Isabella“ einschließlich der überlangen Masten verschlingen.
Er trug nur eine Hose, und die wurde jetzt klatschnaß, als er sich die Pütz mit Meerwasser kurzerhand über den Schädel stülpte, daß es an allen Seiten von ihm hinuntertroff. Danach schüttelte er sich wie ein nasser Hund und verschwand in der Kombüse, wobei er das Schott offenließ.
Bill fand Gefallen daran, die Seewölfe zu mustern, wenn sie an Deck erschienen, manche frisch und ausgeschlafen, andere knurrig und verpennt. Inzwischen kannte er von jedem einzelnen die morgendlichen Angewohnheiten.
Batuti, der alte O’Flynn, Gary Andrews, der ehemalige Schmied von Arwenack, Big Old Shane und Al Conroy schliefen in diesen tropischen Breiten bei ruhiger See meist an Deck, und als der Kutscher jetzt in seiner Kombüse verschwunden war, schliefen sie alle noch weiter.
Der Schiffszimmermann Ferris Tucker, zum Beispiel, überlegte Bill gerade, hatte immer die Angewohnheit nach dem Aufstehen zuerst eine ganze Weile schweigend am Schanzkleid zu stehen und ziemlich grimmig auf das Wasser zu blicken.
Matt Davies und Pete Ballie begrüßten sich meist immer mit: „Na, du alter Affenarsch!“ Smoky verschwand regelmäßig und ziemlich schnell auf dem Bordklo.
Carberry hingegen, der Zuchtmeister und Profos, ließ meist gewaltige Blähungen ab und unternahm nach der Morgenwäsche seine Wanderung durch das Schiff.
Land war immer noch nicht zu sehen, als der Kutscher mit einem Abfallkübel auf dem Deck erschien.
Entweder hatte er noch nicht ausgeschlafen, oder er war in Gedanken versunken, denn er wanderte mit dem Eimer direkt nach Luv, um ihn auszuleeren.
Der Kutscher würde den ganzen Dreck um die Ohren kriegen, überlegte der Bengel, denn er kannte den Bordspruch der „Isabella“, der von Big Old Shane stammte, und den auch der Profos gern gebrauchte, und der da hieß: „Wer gegen den Wind pißt, kriegt nasse Hosen.“
Das wollte er dem Kutscher gerade zurufen, doch der hatte es jetzt ebenfalls bemerkt, schüttelte den Kopf und ging nach Lee hinüber.
Er holte weit aus – und warf den Abfallkübel einschließlich Inhalt über Bord. Dann beugte er sich ungläubig über das Schanzkleid, blickte dem entschwindenden Kübel nach und begann laut und lästerlich zu fluchen.
Der Bengel amüsierte sich köstlich, denn nach dem lautstarken Gefluche des Kutschers erwachten Batuti und ein paar andere.
„Was is, Kutscher“, schrie der Gambia-Neger, „warum groß schreien mitten in Nacht? Du besoffen, he?“
„Quatsch keinen Quatsch, du triefäugige Miesmuschel!“ rief der Kutscher erbost. „Es ist heller Tag, Zeit, daß du endlich mal ausgepennt hast und die anderen auch.“
„Müßt ihr lausigen Meermänner morgens immer so schreien?“ begann der alte O’Flynn zu wettern und erhob sich grummelnd. Er hatte ebenfalls ziemlich laut geschrien, und so blieb es nicht aus, daß auch die letzten Schläfer erwachten und sich gegenseitig anbrüllten, was denn los sei und weshalb es, verdammt noch mal, schon wieder Krach gäbe.
Das lockte schließlich den Profos an Deck, Edwin Carberry, der sein gewaltiges Amboßkinn vorreckte und die Kerle einen nach dem anderen, ungnädig musterte.
„Hoppauf, ihr karierten Affenärsche“, sagte er und blickte nach oben, dem grinsenden Bengel genau in das Gesicht.
„Hast du im Ausguck auch nicht gepennt?“ rief er hinauf.
„Nein, Mister Carberry!“
Bill wartete darauf, daß der Profos das übliche Geräusch von sich gab, doch diesmal gähnte er nur, begann seinen Inspektionsgang und ging nach achtern.
„Die Schoten etwas dichter holen“, sagte er kurz, als er zurückkehrte. „Seht ihr das denn nicht von selbst, ihr lausigen Kanalratten, was, wie?“
Die Schoten, das am meisten beanspruchte Tauwerk an Bord, wurden dichter geholt, und der Profos nickte zufrieden. Er vergaß auch nicht, einen Blick in die Kombüse zu werfen, wo der Kutscher in zwei riesigen eisernen Pfannen Speck ausbriet.
„Ist dir eine Laus über die Leber gekrochen?“ fragte Carberry, als er des Kutschers mißmutiges Gesicht sah.
„Nee, aber ich habe aus Versehen den Abfallkübel über Bord geschmissen.“
„Das tust du doch jeden Tag.“
„Dann würde ich jeden Tag einen neuen Kübel brauchen. Nicht den Inhalt, doch den auch, aber den Kübel gleich mit.“
„Sei froh, daß du an dem Kübel nicht auch noch mit drangehangen hast“, sagte Ed grinsend. „Sonst brauchen wir jeden Tag einen neuen Kutscher.“
Der Kutscher, dessen eigentlicher Name der ganzen Crew bis heute ein ungelöstes Rätsel war, fand das gar nicht witzig.
„Kein Mensch versteht mich“, beklagte er sich, „von euch lausigen Kerlen kriegt man nur dämliche Antworten. Wo, zum Teufel, soll ich denn jetzt den Abfall aufbewahren? Ich kann doch nicht mit jeder Handvoll Dreck über das Schiff laufen.“
Carberry klopfte ihm mit seiner mächtigen Pranke auf die Schulter, daß der Kutscher fast in die Knie ging.
„Ferris hat da totsicher eine Lösung“, sagte er ernst. „Ich werde nachher mit ihm reden. Er wird dir ein Loch bis zum Kielschwein bohren, und dann kannst du den Abfall direkt von der Kombüse aus unters Schiff ins Meer werfen.“
Der Kutscher stutzte, dann griff er hitzig nach der Pfanne.
„Wenn das Ding nicht so schwer wäre“, sagte er grimmig, „würde ich es dir über den Schädel donnern.“
„Dann brauchst du jeden Tag eine neue Pfanne“, sagte Ed grinsend und ging davon, einen Kutscher zurücklassend, der in übelster Weise die unschuldigen Ahnen des Profos beleidigte.
Das Bordleben nahm seinen normalen Verlauf.
Vor einer Weile war der Seewolf auf dem Achterdeck erschienen, ebenso Ben Brighton, der nur ein paar Stunden geschlafen hatte.
Aus dem Meer schob sich langsam das Flammenrad der Sonne, die gelbe und rötliche Strahlen über das Wasser warf, das an einigen Stellen wie Silber aussah.
Dieser frühe Morgen war immer der schönste Teil des Tages, das jedenfalls empfanden die meisten.
Dann duftete es aus der Kombüse, daß ihnen das Wasser im Mund zusammenlief. Dann hing der Geruch nach Teer, Holz und Salzwasser über dem Schiff, dann war noch deutlich das Knarren, Ächzen und Stöhnen des Schiffes zu hören, dann war es angenehm frisch und man freute sich auf den beginnenden Tag.
Aber das alles wurde durch eine leichte Sorge überlagert, und die ging besonders dem Kutscher an die Nieren, obwohl sie die gesamte Crew betraf.
Sie hatten schätzungsweise tausend Meilen hinter sich, ein verdammt langer Törn mit harten Stürmen, eintönigen Kalmen, in denen sie tagelang auf Wind gewartet hatten, und der ihnen wechselweise dann wieder so stark um die Ohren blies, daß sie alle Mühe hatten, das Schiff sicher zu führen.
Jetzt wurde der Proviant knapp, und in den Wasserfässern herrschte Ebbe. Der Rest des Wassers schmeckte auch dementsprechend, als sich winzige grüne Fäden darin gebildet hatten.
Es gab Reis an Bord, tonnenweise, Reis, den sie aus dem Land des Großen Chan mitgebracht hatten, aber jetzt hing ihnen der Reis zum Hals heraus, und die verdammten Hagelkörner, wie Carberry sie nannte, verpappten einem den Magen. Und der alte O’Flynn hatte stur behauptet, wenn sie das Zeug auf ewig fressen müßten, dann würden sie alle gelb im Gesicht werden wie die Chinesen, die es auch davon hätten.
Der Kutscher warf in das kochende Wasser Teeblätter, damit sich die abgestandene Brühe besser trinken ließ, und in einem Anfall von Großmut goß er etwas Rum dazu, nicht viel, aber doch so, daß es den Geschmack spürbar anhob.
Anschließend ging der Kutscher mit einer heißen Muck voll Tee nach achtern, um sie dem Seewolf zu bringen. In der Kuhl fing Ben Brighton ihn allerdings ab.