Seewölfe Paket 7
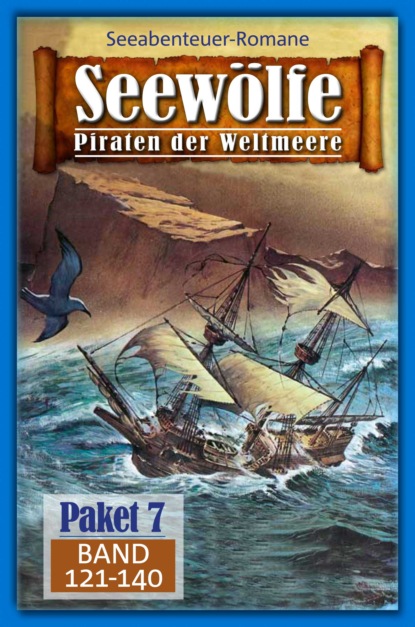
- -
- 100%
- +
„Vorsicht!“ brüllte Shane laut, aber da war es schon zu spät.
Shane hatte Sand rieseln sehen, doch seine Warnung nutzte dem gewichtigen Profos nichts mehr, denn auch er trat auf eine der raffiniert angelegten Fallgruben, von denen es hier nur so wimmelte und die man meist zu spät sah, wenn überhaupt.
Mit einem Fluch, der Carberry alle Ehre antat, sauste der Profos abwärts. Er hieb mit den Armen um sich, doch bevor er noch Luft holen konnte, war er schon hart gelandet. Von oben rieselte Sand nach und bedeckte seinen Schädel.
„Jetzt könnt ihr meinetwegen lachen!“ brüllte Ed. „Und wenn ihr euch beruhigt habt, könnt ihr mich hochziehen.“
Es lachte jedoch niemand, das Lachen war ihnen gründlich vergangen, denn die meisten waren nur um Haaresbreite dem sicheren Tod entronnen.
Als sie Ed hochhievten, brach die Grube immer weiter ein, und immer wieder fiel der Sand nach.
Hier hatten die Wilden Unmengen von Sand ausgehoben, tiefe Gruben angelegt und die Innenseite mit lehmdurchsetzten Fasern aus Kokos verstärkt, damit sie nicht zusammenbrachen. Der heiße Sand trocknete das Gemisch steinhart.
Über die Grube waren verdorrte Palmwedel gelegt worden, eine Lage quer, die nächste anders herum. Darüber befand sich wieder eine dünne Schicht aus Fasern, und darauf hatten sie Sand gehäuft. Niemand sah diese Gruben, und das entschuldigte auch ihren buchstäblichen Reinfall.
Die Hütten fielen brennend auseinander, glühende Teile landeten im Wasser und verlöschten. Jetzt brannten nur noch die Pfähle, auf denen die Hütten gestanden hatten.
„Ich glaube, die haben die Schnauze voll“, sagte Ed, wobei er Sand ausspie und seine Worte mit lästerlichen Flüchen spickte.
„Vor allem sind sie in nächster Zeit beschäftigt“, meinte der Seewolf. Mit der rechten Hand massierte er sein Genick, das immer noch höllisch schmerzte.
„Und für uns war es eine Lehre, wieder einmal“, fügte er bitter hinzu. „Das zeigt, daß man nie auslernt.“
„Mit derart raffinierten Methoden hat auch niemand gerechnet“, sagte Shane. „Wer denkt schon an Fallgruben und Netze, Würgeseile und Gitter, wenn er an Land geht.“
Hasard hatte genau den gleichen Gedanken wie Ben Brighton vorhin, und er sprach ihn auch aus.
„Dieses Davonrennen der Wilden war ein genau einkalkulierter Faktor. Das erweckte den Eindruck, als hätten sie furchtbare Angst vor uns, und damit lockten sie uns an Land. Uns wäre es ebenso ergangen wie den Spaniern, die vielleicht auch hier massakriert und dann an Stämme im Innern des Dschungels weitergereicht wurden. Da drüben steht noch eine Hütte“, sagte er unvermittelt und zeigte mit der ausgestreckten Hand auf eine kleine Hütte, die versteckt am Rand des Dschungels stand.
„Wir sehen sie uns einmal an, die Eingeborenen kehren so schnell nicht zurück, die hat die Angst fast wahnsinnig werden lassen. Nehmt aber trotzdem eure Waffen zur Hand und folgt mir ganz dicht am Wasser, da kann es wegen der ständig auflaufenden Flut keine Fallgruben geben.“
„Und nicht unter Palmen wandeln“, setzte Carberry hinzu, „sonst hängt ihr als Kokosnüsse in den Wipfeln.“
Der Trupp watete vorsichtig durchs Wasser, wo nichts zu befürchten war und es keine Gruben gab.
Vor der Hütte blieben sie stehen, blickten in den Dschungel, hielten die Waffen schußbereit und lauerten.
Es war eine längliche, mit Palmenwedeln gedeckte Hütte, die auf der rechten Seite offen war.
Hasard blickte hinein.
Aus der Froschperspektive grinsten ihn vier Schrumpfköpfe an, die an langen Fäden bis zum Boden hingen.
Die Tsantas waren auf Faustgröße zusammengeschrumpft und sahen schrecklich aus mit den zugenähten Lippen und den langen Haaren.
Auf der Rückseite der Hütte hing ein ganzes Bündel.
„Europäer“, sagte Smoky schlukkend, „mit Sicherheit Spanier oder Portugiesen, die in die Falle gelaufen sind.“
Deutlich waren die Gesichtszüge zu erkennen, und bei dem Anblick kroch den abgebrühten Männern das Grauen über den Körper. Fast jeder kriegte eine Gänsehaut oder ein ekelhaftes Ziehen im Genick.
„Das könnten wir sein“, sagte der Seewolf. „Genauso wäre es auch uns ergangen, wenn Ben nicht so blitzschnell eingegriffen hätte.“
Immer wieder suchten sie mißtrauisch den Dschungel ab, ob sich etwas rührte oder etwas zu erkennen war.
Tiefe Stille herrschte, die erst durchbrochen wurde, als Carberry mit ein paar wütenden Tritten die Hütte in Trümmer legte, bis nur noch ein paar schmächtige Balken übrig blieben.
„Zurück an Bord“, sagte Hasard. „Wir segeln weiter.“
Schweigend kehrten sie ans Wasser zurück, bestiegen das Boot und warfen einen letzten Blick auf die Toten, die am Strand lagen.
Es war mehr als ein Dutzend.
Etwas später enterte Hasard auf, gefolgt von den anderen, die Ben vorwurfsvoll und mit derben Worten empfing.
„Immer müßt ihr wie die Wilden losrennen“, sagte er. „Genau darauf haben diese Teufel doch nur gewartet. Ging das nicht in eure verdammten Holzköpfe hinein?“
„Laß sie“, sagte Hasard. „Ich habe es ihnen schon erklärt, und jeder hat die Schrumpfköpfe gesehen, die in der kleinen Hütte hingen.“
Proteste wurden laut. Luke Morgan streckte seinen Schädel vor, auf dem nur spärliche Haare sprossen.
„Sollen wir vielleicht zusehen, wie unsere Kameraden einfach abgemurkst werden? Wir mußten etwas unternehmen!“
„Klar, das sehe ich ja auch ein, aber dazu soll man seinen Verstand gebrauchen und sich nicht von wilder Wut leiten lassen, so wie du Hitzkopf“, sagte Ben. „Dein Grips muß dir doch sagen, daß es noch mehr Fallen gibt und auch die nächsten wie blinde Hühner hineinstolpern.“
Big Old Shane legte dem zornigen Bootsmann die Hand auf die Schulter.
„Ich bin auch losgerannt“, sagte er. „Mitunter gehen einem die Nerven durch, ist es nicht so?“
„Jedenfalls hast du die Idee mit den Brandsätzen gehabt“, sagte Carberry, „und das war eine verdammt gute Idee. Die ist es schon wert, daß man darauf einen Schluck trinkt. Wir haben da ein feines spanisches Schnäpschen an Bord.“
„Wir gehen ankerauf“, sagte Hasard. „Oder wollt ihr warten, bis diese Burschen zurückkehren?“
Zwischendurch erkundigte sich der Kutscher hartnäckig nach Verletzungen und war fast enttäuscht, daß es keine gab, bis auf ein paar Prellungen und leichte Schmerzen.
„Und dir, Sir, fehlt dir auch wirklich nichts?“ fragte er den Seewolf.
„Überhaupt nichts“, versicherte Hasard. „Leichte Kreuzschmerzen, mehr nicht. Das vergeht von selbst.“
„Ihr müßt es ja wissen“, knurrte der Kutscher. „Ich möchte nur wissen, weshalb ich den ganzen medizinischen Kram gelernt habe, wenn ich ihn nicht anwenden kann.“
Der Anker wurde eingeholt, die Segel gesetzt.
Die Kanonen drohten immer noch zum Strand hin, an dem jetzt die restlichen Pfähle schwarz verkohlten.
Kein Eingeborener zeigte sich. Der Schrecken mußte ihnen bis ins Mark gefahren sein, und das blanke Entsetzen hatte sie tief in die Wälder getrieben.
Langsam glitt die „Isabella“ aus der Bucht, bis sie das offene Meer erreichte.
Dann segelte sie weiter nach Süden.
Am dritten Tag, seit sie die Bucht der Kopfjäger verlassen hatten, wurde Tandjung Datu erreicht.
Der Kutscher maß Carberry schon seit geraumer Zeit mit vorwurfsvollen Blicken.
„Sag bloß keinem an Bord, daß wir wieder die nächste Bucht anlaufen sollen, um Proviant zu ergattern“, herrschte Ed den Kutscher an, der merklich blaß wurde.
„Wenn wir nichts mehr zu fressen haben, mampfen wir Reis und Salzfleisch. Das ist immer noch besser, als wenn wir irgendwo als Schrumpfköpfe an Schnüren hängen und uns gegenseitig dämlich angrinsen. Hasard wird mit Sicherheit hier keine Bucht mehr anlaufen.“
„Aber den Karten nach ist das ein größeres Kaff“, widersprach der Kutscher, „da werden auch schon andere Schiffe Proviant gefaßt haben.“
„Was verstehst du schon von Seekarten! Bist du vielleicht schon mal hier gewesen, was, wie?“
„Du vielleicht?“
„Das ist etwas anderes“, behauptete Ed und starrte voraus auf die Ansiedlung, die sich ihren Blicken bot.
Ein kleines portugiesisches Schiff lag dort vor Anker. Allem Anschein nach hatten die Portugiesen diese Ansiedlung gebaut.
Ed zuckte zusammen, als Hasards Anweisung erfolgte, das Kaff anzulaufen.
Der Kutscher rieb sich die Hände und grinste.
„Hasard ist eben ein Gentleman“, sagte er. „Er wird sich nach bewährter Manier als Spanier einschleichen und sich mit Proviant versorgen, da fresse ich den Großmast, wenn das nicht stimmt.“
Der Kutscher ließ den Großmast stehen, denn es gab nicht die geringsten Schwierigkeiten, als sie vor Anker gingen und der Seewolf genau handelte, wie er es prophezeit hatte.
Gegen Gold und Silber wurden sie problemlos verproviantiert, es gab nicht die geringsten Schwierigkeiten. Keiner verfiel auf die Idee, sie etwa für Engländer zu halten. Noch am selben Abend konnte die „Isabella“ frisch versorgt ihre Reise fortsetzen.
Der Seewolf ging auf Westkurs und segelte von Tandjung Datu auf die Straße von Malakka zu.
Wohin sie da allerdings gerieten, wußte keiner genau zu sagen, denn die Karten gaben für den Großen Ozean, der dahinter begann, nicht viel her.
Aber bisher hatten sie sich immer durchgebissen und zurecht gefunden, und Hasard zweifelte nicht daran, daß es diesmal anders werden sollte.
Sie fanden immer ihren Weg.
Fußnote
1) Kalimantan — das heutige Borneo.
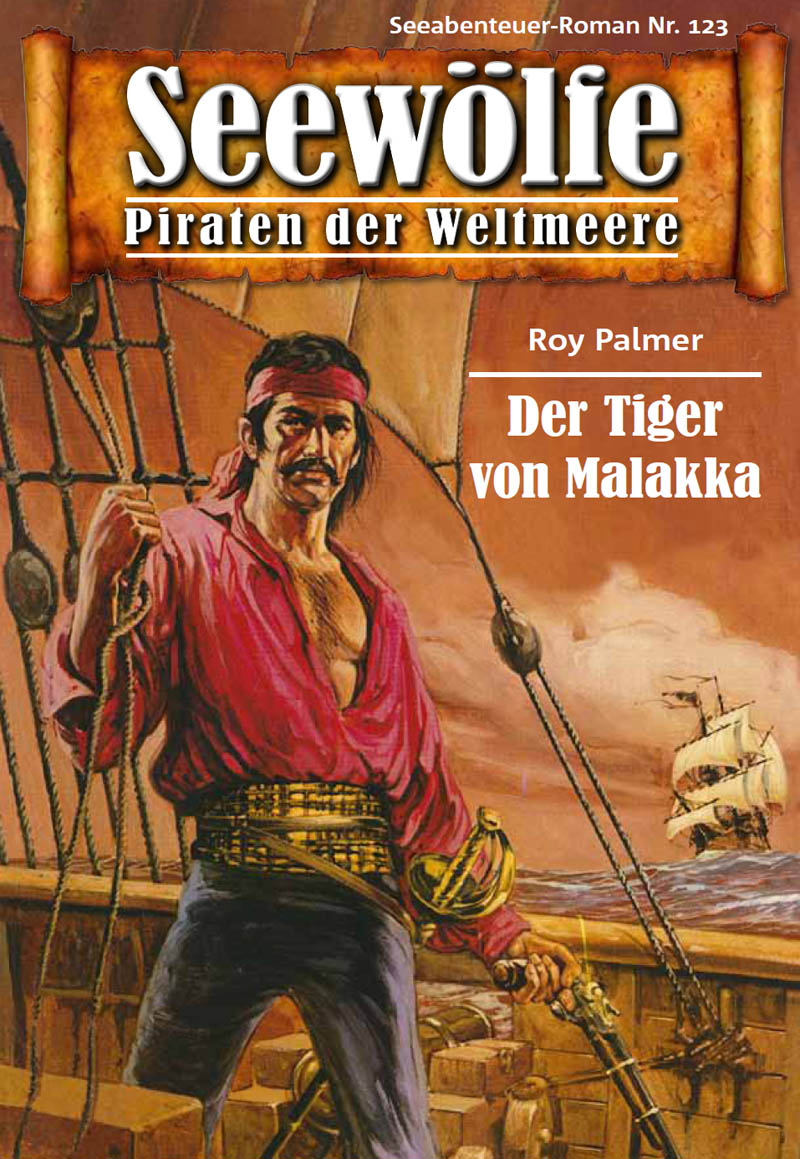
1.
Einer der bärtigen, eisengepanzerten Eindringlinge hob die Waffe, die die malaiischen Fischer als Feuerrohr zu bezeichnen pflegten. Er stieß mit dem hölzernen Kolben zu, und Otonedju, der Dorfälteste, hatte das furchtbare Gefühl, ein Wasserbüffel oder ein ähnlich großes Tier habe ihn in den Rücken getreten.
Otonedju taumelte aus seiner Hütte. Vier, fünf unstete Schritte weit, dann strauchelte er und stürzte von dem flachen, überdachten Vorbau in den Staub. Obwohl er seine Hände vorstreckte, schlug er hart auf. Ein ächzender Laut der Qual und des Entsetzens löste sich von seinen Lippen.
Die spanischen Soldaten eilten ihm nach. Aus allen Richtungen tauchten sie auf. Sie schienen überall zu sein und alles ihrer Willkür zu unterwerfen. Jeden Funken des Widerstandes brachten sie zum Erlöschen.
Sie umringten Otonedju und schrien auf ihn ein.
„Wo ist der Tiger?“
„Wo hält sich der Hund versteckt?“
„Rede, elender Bastard, oder du bist des Todes!“
Otonedju hörte durch ihr Gebrüll hindurch das Rufen der Frauen, Kinder und alten Leute des Dorfes. Nein, er gab sich keinen Illusionen hin. Die Spanier würden sie bei dem wilden Bestreben, das zu erfahren, was sie wissen wollten, nicht verschonen. Zuerst befragten sie die Männer, die die Spitze des Dorfes darstellten, dann die niedrigeren Chargen aus der Hierarchie der kleinen, fest zusammenhaltenden Gemeinschaft, die Krieger und die Fischer – zuletzt schließlich die Schwachen, Wehrlosen.
Dennoch war Otonedju nicht gewillt, über irgend etwas Auskunft zu geben. Er wußte, was das Ziel der weißgesichtigen, schwarzbärtigen Männer mit den Brustpanzern und Eisenhelmen war. Doch selbst wenn sie ihn über die Ausbeute des Fischfanges der vergangenen Tage hätten aushorchen wollen, so hätte er ihnen kein Sterbenswörtchen darüber verraten. Schweigen war keine Notwendigkeit, sondern eine Tugend, und mit jedem Zugeständnis, das man dem weit überlegenen Gegner gewährte, verlor man einen Teil seiner Manneswürde.
Otonedju fühlte sich von großer Ruhe erfüllt.
Er trachtete davonzukriechen, ein Stück weiter auf den rondellartigen Platz inmitten der Hütten des Inseldorfes zu. Ganz einfach nur, um dem Feind zu beweisen, daß er sich nicht fürchtete und seinen Stolz aufrechterhielt.
Aber ein Fuß zuckte vor, ein Stiefel traf Otonedjus rechte Körperseite, und der alte Mann blieb unter großen Schmerzen liegen.
Otonedju blickte durch wallende Schleier vor seinen Augen zu dem Stiefel. Der schwingende Fuß hatte sich wieder zu dem anderen, zweiten gesellt, und die Stimme, die zu dem Leib über den beiden gehörte, schrie noch einmal: „Rede!“
Otonedju verstand dieses spanische Wort, wenn er auch sonst nur noch ein paar Brocken von dem kannte, was die Männer sagten. Otonedju begriff, denn ihm war von Anfang an klar gewesen, wen diese Männer suchten und was sie vernichten wollten, doch er erwiderte nur ein Wort in seiner Sprache: „Stirb!“
Der Sprecher, ein hochgewachsener und ehrgeiziger Teniente namens Savero de Almenara, schaute auf und wandte den Kopf.
„Der Dolmetscher soll kommen!“ rief er. „Ich glaube, dieser Kerl will sagen, was er weiß. Das würde uns viel Arbeit ersparen.“
Sofort näherte sich der Batak Siabu. Er hatte sich von den Fremden bekehren und überzeugen lassen, trug spanische Kleidung und tat alles, aber auch alles, um den Spaniern untertan zu sein. Otonedju hatte schon vor dem Auftauchen des Trupps von Siabu gehört, und er verachtete ihn aus tiefstem Herzen. Nichts war in Otonedjus Augen fluchwürdiger als das Verhalten eines solchen Überläufers und schäbigen Opportunisten.
Siabu, der sich seines Ansehens bei den Eingeborenen durchaus bewußt war, kniete neben dem alten Mann nieder und sagte: „Also sprich. Erzähl uns, was du über den Tiger weißt, wo er sich aufhält. Wir wissen, daß er ein Versteck auf dieser Insel hat. Du kannst dir und deinem Stamm viel Ärger ersparen, wenn du mitarbeitest, Otonedju.“
Otonedju stemmte sich hoch, drehte sich und setzte sich auf den trockenen Untergrund. Es hatte den Anschein, als sei er geläutert und würde sich nun nicht mehr widerspenstig zeigen wie vorher, aber das war eine Fehldeutung seines Mienenspiels.
„Mitarbeiten?“ wiederholte er in seiner Muttersprache.
„Du wirst es nicht bereuen“, entgegnete Siabu.
„Erkläre mir, um welche Art von Arbeit es sich handelt.“
Siabu glaubte, einen höhnischen Unterton aus den Worten des Dorfältesten zu vernehmen, aber er erwiderte trotzdem: „Das weißt du doch. Wir suchen den Tiger. Du kennst ihn.“
„Ja.“
„Gut. Ist er hier?“
„Ihr habt euch im Dorf umgesehen“, sagte Otonedju. „Ihr seid in unsere Hütten eingedrungen und habt keine Achtung gezeigt, vor keinem von uns. Habt ihr einen Tiger entdeckt?“
„Nein. Er muß sich irgendwo auf der Insel verkrochen haben“, sagte Siabu. „Wo?“
„Ein Tiger ist eine große, gefährliche Bestie mit vier Beinen und gestreiftem Fell“, sagte der alte Mann auffallend ruhig. „Ein solches Tier hat auf dieser Insel nie existiert. Hast du sonst noch Fragen, Verräter, den die Rache der Götter zerreißen wird?“
Siabu fuhr hoch. „Teniente, er hält uns zum Narren!“ schrie er in schlechtem Spanisch. „Und er beschimpft mich!“
„Die Dämonen des Wassers werden eure Schiffe verschlingen“, sagte Otonedju, und er spürte, wie ihn Genugtuung durchströmte. Sie war so groß, daß er sogar seine Schmerzen vergaß.
„Ich bringe dich um!“ brüllte der Batak, immer noch auf spanisch, so daß Otonedju den Wortlaut nicht verstehen konnte.
Das war auch nicht erforderlich. Der Dorfälteste konnte sich denken, was dem Batak vorschwebte, es gehörte keine besonders reiche Phantasie dazu.
„Gut“, erwiderte der Teniente de Almenara in diesem Augenblick. „Ich überlasse den Kerl dir. Du weißt, wie du ihn zum Sprechen bringen kannst. Gibt er nach, läßt du ihn auspacken und erledigst ihn anschließend. Bleibt er störrisch, hältst du dich nicht mehr lange mit ihm auf.“
„Ich danke Ihnen, Teniente“, erwiderte Siabu.
Er zog seinen Parang, ein kurzes, vorn breit auslaufendes und leicht gekrümmtes malaiisches Schwert. Es war das einzige Zeichen seiner eigentlichen Abstammung, mit dem er sich noch versah. Mit dieser Waffe wußte er ausgezeichnet umzugehen.
Otonedju hatte bei früheren Stammesfehden ebenfalls den Parang geführt und sich damit Respekt und Siege verschafft. Auch im Umgang mit dem Kris, dem schlangenförmig gewundenen Dolch, war er gut. Immer noch. Nur hatten ihm die Spanier seinen wertvollen, alten Kris abgenommen, als sie gelandet und in das Dorf eingedrungen waren. Mit vorgehaltenen Feuerwaffen war das keine Schwierigkeit gewesen.
Scheinbar entrückt blickte Otonedju zu der Bucht unterhalb des Dorfes. Dort lagen die Schiffe, von denen aus die spanischen Soldaten übergesetzt waren, drei Dreimaster, dort, unter mildblauem Himmel auf silbrig glitzerndem Wasser. Nicht weit entfernt in seichteren Gefilden ragten die Bambusgestelle aus der See, mit denen sich die Eingeborenen ihren Fang zu sichern pflegten. Dort waren sie noch vor kurzem gewesen, um alles für die Nacht vorzubereiten, dort drüben jenseits des felsigen Ufers und der Landzunge, wo vor einer Stunde noch keiner von ihnen geahnt hatte, daß der Nachmittag das Böse, das vernichtende Unheil bringen würde.
Dann waren die drei Schiffe plötzlich dagewesen, sehr nahe. Sie hatten sich um die Insel herumgeschlichen. Ihre Besatzungen hatten den Bewohnern des Dorfes nicht die Chance gelassen, sich zurückzuziehen. Kein Gedanke etwa daran, Körbe, Gitter und Reusen loszulassen und mit den Booten die Flucht zu ergreifen. Wie schnell hätten die Spanier ihre Beute zu Wasser gestellt.
Ins Dorf hatten sich die Fischer zurückgezogen, und allein dies war in den Augen der Spanier ein halbes Schuldgeständnis.
Der Teniente und die Soldaten wichen etwas zurück. Otonedju schien Siabu willenlos ausgeliefert zu sein.
Aber dann, als keiner mehr damit rechnete – selbst der Batak nicht –, schnellte der alte Mann hoch. Er tat das erstaunlich flink und mit einer Gewandtheit, die man ihm gar nicht mehr zugetraut hätte. Eben das war es, was sich jetzt zu Siabus Nachteil entwickelte. Der Dolmetscher hatte nicht damit gerechnet, von dem Alten angesprungen zu werden.
Otonedju hatte das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Er schoß an der Gestalt des Bataks hoch, seine knochigen Finger packten das Handgelenk und die Hand, die das Heft das Parangs hielt. Ein Ruck, ein Schrei aus Siabus Mund, und Otonedju hatte ihm das scharfe Kurzschwert entrungen.
Die Klinge zuckte durch die Luft. Der Batak reagierte jetzt. Er krümmte sich, verlagerte dabei das Körpergewicht nach hinten und versuchte, dem Bereich des Parangs zu entgehen.
Es gelang nur ansatzweise. Der Parang zeichnete ein rotes Mal in Siabus Gesicht, quer über die Wange. Dann raste er über seine Schulter wie ein Dämon, der brennende Spuren sät.
Brüllend ließ sich der Batak auf den Rücken fallen. Nur so rettete er sein Leben.
Der Teniente hatte seine Miqueletschloß-Pistole gezückt, spannte den Hahn und legte auf Otonedju an. Die Musketen und Arkebusen der Soldaten hoben sich in Zielrichtung auf den alten Mann. Otonedju konnte bereits das tödliche, hohle Auge ihrer Mündungen sehen.
Ein Schrei gellte durch das Dorf. Eine schöne junge Frau hatte ihn ausgestoßen – Otonedjus Tochter.
Otonedju ließ von dem Batak ab, obwohl er ihm, dem Verräter und verhinderten Mörder, gern das Herz durchbohrt hätte. Wieder schimmerte die Klinge in der Luft, dann, ganz unversehens, verließ das Heft des Parangs Otonedjus Hand. Ein Blitz zuckte über den Dorfplatz und traf den ungeschützten Hals eines Soldaten, der gerade mit der Muskete auf den alten Mann abdrükken wollte.
Otonedju duckte sich und stürmte seiner Tochter entgegen, die von zwei Soldaten gehalten wurde.
Der Parang steckte tief im Hals des Musketenschützen, der Mann sank zu Boden. Schüsse krachten. Der Teniente brüllte wie verrückt. Kugeln umzirpten Otonedju, trafen ihn aber nicht.
Otonedjus Tat löste im Dorf eine Kette von Reaktionen aus. Krieger zückten ihre Waffen, die sie vor den Spaniern hatten verbergen können. Aus Verstecken, die die Eindringlinge noch nicht entdeckt hatten, brachen plötzlich die Gestalten junger Männer hervor. Im Nu tobte ein säbelndes, schrilles Inferno.
Otonedjus Tochter riß sich mit der Wildheit eines verzweifelten, in die Enge getriebenen Raubtiers von ihren Bewachern los. Ehe die beiden Soldaten sie wieder packen konnten, hatte der Dorfälteste sie erreicht und warf sich ihnen ohne Waffe entgegen.
Es wäre sein Ende gewesen, hätten nicht zwei junge Krieger in das Handgemenge eingegriffen.
Die Männer, Frauen, Kinder und Greise des kleinen Fischerdorfes brachten es fertig, sich von der Übermacht zu lösen und die Flucht in den Urwald der Insel anzutreten. Sie entwischten den Schüssen, die ihnen nachpeitschten, den Piken und Speeren, die ihnen nachgeschleudert wurden.
Kochend vor Zorn fuchtelte der Teniente Savero de Almenara mit seiner leergeschossenen Pistole in der Luft herum. Für einen Augenblick stand er unschlüssig. Dann wies er auf die leeren Hütten.
„Anzünden“, stieß er keuchend hervor. „Alles niederbrennen!“
Von kristallklarer Bläue war der Himmel über der „Isabella VIII.“. Er schien hier höher als anderswo zu sein, und auf unerklärliche Weise schien man der überirdischen Bestimmung näher zu sein.
„So klar und heiter war die Luft nur in Peking“, sagte Ben Brighton auf dem Achterdeck der großen Galeone. „Dabei befinden wir uns hier in den Tropen.“
Hasards Finger lösten sich von der Five-Rail. Er drehte sich zu seinem ersten Offizier und Bootsmann um. „Du darfst nicht die Jahreszeit vergessen, Ben. Der Frühling beginnt gerade erst, außerdem haben wir Wind aus Nordosten.“
„Ja, vielleicht weht er von Korea und dem Gelben Meer herüber. Alles in allem scheint ein ruhiger Törn vor uns zu liegen, bis wir den Indischen Ozean erreichen.“
Hasard musterte Ben nachdenklich, bevor er antwortete. „Sag mal, glaubst du wirklich, daß die Malakkastraße so friedlich und paradiesisch ist? Bist du allen Ernstes davon überzeugt?“
„Na, Sturm scheint uns jedenfalls nicht bevorzustehen.“
„Davon spreche ich auch nicht.“
Ben kratzte sich am Hinterkopf, wobei sich seine Mütze ein wenig tiefer in die Stirn schob. „Also schön, ich geb’s zu. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wir sind schon in viele paradiesische Gegenden geraten, die sich dann als wahre Hölle entpuppt haben. Am besten sage ich gar nichts mehr.“
Big Old Shane war zu ihnen getreten. „Nach Borneo, nach diesem elenden, von Kopfjägern verseuchten Kalimantan, kann uns so leicht nichts mehr erschüttern.“
Auch Old Donegal Daniel O’Flynn, der gerade aus Richtung Heck anmarschierte und sich erstaunlich geschickt auf seinen Krücken über Deck bewegte, pflichtete dem bei.
„Praktisch bedeutet das, daß wir uns von dem guten Wetter und den feinen Windverhältnissen nicht verblenden lassen dürfen“, sagte er mit säuerlicher Miene. „Hinter jedem Inselchen, auf das wir von jetzt an stoßen, können Kannibalen, Kopfjäger oder irgendwelche Freibeuter lauern. Oder Dons.“
„Meinetwegen, aber hör mit den Kopfjägern auf“, erwiderte Ferris Tucker. „Von denen habe ich gründlich die Nase voll, und ich kriege immer so ein merkwürdiges Jucken am Hals, wenn ihr die Hundesöhne erwähnt.“ Er rieb sich tatsächlich am Hals – was einige Heiterkeit bei den Männern hervorrief.
Keiner von ihnen dachte mit Begeisterung an Kalimantan zurück. Nach dem Abenteuer in Manila, nach mehr als tausend Meilen Törn, nach Stürmen, Kalmen, hundert Entbehrungen hatten sie im März 1585 endlich die große Insel erreicht und sich dort etwas mehr erhofft als nur menschenfeindliche Umgebung und mörderische Gefahren, die im Verborgenen lauerten.
Aber sie hatten die bittere Realität hinnehmen müssen.
Zunächst hatte sich Kalimantan als gänzlich ungeeignet zum Proviant- und Wasserfassen erwiesen. Undurchdringliche Mangrovendikkichte überwucherten die Ufer, dahinter erstreckten sich feuchtheiße Urwälder, scheinbar bis ins Unendliche.
Der Seewolf war mit seiner „Isabella“ weitergesegelt und hatte auf diese Weise das Dorf entdeckt, das zu sehen er sich im nachhinein nie wieder gewünscht hätte. Offensichtlich panikartig waren die eingeborenen Dajaker vor ihnen geflüchtet – und zu spät hatten die Männer der Galeone die Fallen gewittert: getarnte Gruben, Fallnetze, Würgeseile und aus den Palmenwipfeln niederfallende Bambusgitter. Nur mit Mühe hatten sie sich wieder freikämpfen können.






