Seewölfe Paket 7
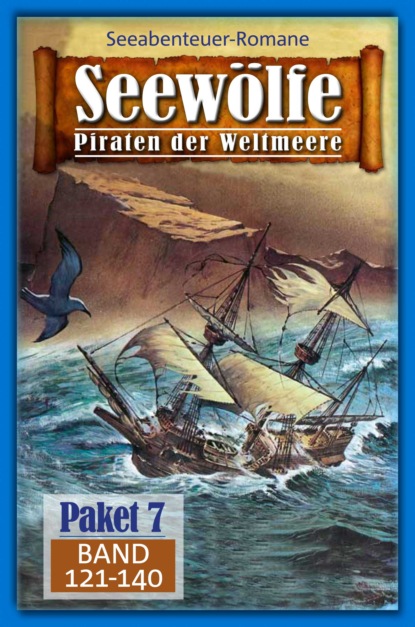
- -
- 100%
- +
Hasard zuckte mit den Schultern. Warum noch darüber herumgrübeln? Vermeiden ließen sich solche unliebsamen Begegnungen nun einmal nicht, man mußte immer darauf vorbereitet sein. Deswegen war er auch froh, wenn seine Männer ihre gesunde Skepsis beibehielten.
Er stieg auf das Quarterdeck hinunter und suchte das Ruderhaus auf. Hier stand Pete Ballie in Gesellschaft all der Karten, die der Seewolf seit Formosa und den Philippinen an der Rückwand des Decksgebäudes festgepinnt hatte.
Ausgezeichnete Karten waren das. Ohne sie wäre Hasard auf die Straße von Malakka gar nicht aufmerksam geworden. Er warf einen prüfenden Blick auf den Kompaß, nahm seine Hilfsmittel für die Navigation zur Hand und stellte noch einmal die Position fest. Dann verglich er die Position mit dem Kurs, den er auf den Karten abgesteckt hatte. Soweit es die Berechnung der Route und deren Einhaltung betraf, verlief alles genau nach Plan.
Eine der Karten hatte Hasard von Sun Lo, dem Mönch von Formosa, als Geschenk erhalten. Die anderen hatten ihm die Spanier in Manila „ausgehändigt“, höchst unfreiwillig allerdings. Sie mußten noch immer eine Höllenwut auf ihn haben, und sie würden alles daransetzen, ihn wieder zu stellen.
Vorläufig allerdings hatten sie den Anschluß verloren. Die Spur der „Isabella“ verschwand für die Verfolger irgendwo zwischen den Sunda-Inseln. Die Chance, daß sie ihn wiederfanden, war äußerst gering. Genausogut konnten sie nach der bekannten Nadel im Heuhaufen suchen.
Hasard hätte sie herausfordern oder ihnen irgendwo eine Falle stellen können. Aber er war nicht scharf darauf, die Kriegsschiff-Verbände von Manila wiederzutreffen. Früher oder später würden sich die Dons ohnehin wieder präsentieren, wenn auch mit anderen Schiffen, in Form anderer Gesichter, anderer Taktiken und Hinterhältigkeiten – er rechnete damit, sie noch vor dem Erreichen des Indischen Meeres wiederzusehen.
Ohne die Karten, soviel stand fest, hätte Hasard sich statt durch die Malakkastraße eher durch jene Passage getastet, die zwischen den Inseln Sumatra und Java lag.
„Na ja“, sagte der Seewolf. „So ein großer Umweg wäre das eigentlich auch nicht gewesen, Pete.“
„Was denn, Sir?“
„Die Selat Sunda. Die Sunda-Straße.“
„Bestimmt nicht.“
„Dann frage ich mich, welchen Vorteil wir jetzt gewinnen.“
Pete stülpte die Unterlippe vor und blickte voraus. „Wahrscheinlich ist es der bequemere Törn. Und das ist doch sehr wichtig für uns.“
„Möglich, daß wir auch um ein paar Erfahrungen reicher werden, die uns die Sunda-Straße nicht bietet.“
Old O’Flynn war Hasard nachgestakt, er schaute zum Ruderhaus herein und grinste.
„Du hast ja auch einen ganz schönen Sarkasmus am Leib“, meinte er.
Hasard begegnete seinem Blick. „Mußt du denn immer alles negativ auslegen?“
„Du kennst mich doch.“
Hasard lachte. „Donegal, du bist wirklich unverbesserlich. So wie du die Dinge siehst, erreichen wir Old England sowieso nie wieder, oder?“
„Nun fang du nicht auch noch an“, entgegnete der knorrige Alte wider Erwarten. „So ein Miesmacher bin ich ja nun auch wieder nicht. Wenn wir nicht auf Grund laufen, von einem Sturm zerschmettert werden, ersaufen, an einer Seuche krepieren oder von den Dons massakriert werden – dann laufen wir garantiert heil und unversehrt die Heimat an.“
„Aha. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir die Spanier unterwegs wieder um einige ihrer Reichtümer erleichtern? Wäre das nicht nach deinem Geschmack?“ erkundigte sich der Seewolf.
„Klar“, erwiderte O’Flynn. Dann pochte er jedoch mit einer seiner Krücken auf die Decksplanken. „Nur einen Haken hat die Sache. Wir liegen schon zu tief. Unsere Lady hat ihren Bauch schwer vollgeladen und geht mit einem Riesenschatz schwanger. Wenn du noch mehr dazulädst, säuft sie glatt ab und überläßt uns den Haien zum Fraß.“
Sie grinsten sich an, und auch Pete Ballie fing an zu lachen. Die Stimmung an Bord war ausgezeichnet, und das war die wichtigste Voraussetzung für ein harmonisches Leben auf See, wenn alles ruhig verlief und Langeweile sich einzustellen drohte. Stürme und Kämpfe schmiedeten die Männer so fest zusammen wie nie, aber wenn allzu lange Stille und Müßiggang herrschten, wurde die Crew leicht mürrisch. Dann war es gut, zu flachsen und zu unken und von Dear Old England zu reden, als läge sie nicht Tausende von Meilen entfernt, sondern gleich hinter der nächsten Ecke.
Carberry, seines Zeichens Profos und unumschränkter Herrscher über die Kuhl, hatte seine ureigene Art, den Gegebenheiten zu begegnen. Wenn so ein „Schlabbertörn“ gefahren wurde wie heute, ließ er entweder die „Isabella“ von vorn bis achtern aufklaren, brüllte die Crew an, daß die Schotten aus ihren Fassungen zu fallen drohten, brachte Sir John, dem karmesinroten Aracanga, neue Unanständigkeiten bei oder gab seine ewigen Kalauer zum besten.
Hätte man ihn wegen dieser allenthalben bekannten Geschichten als schrullig bezeichnet, wäre er sofort explodiert. Keiner sollte es sich einfallen lassen, Edwin Carberry, den Zuchtmeister und Hüter der Borddisziplin, zu kritisieren oder gar zu beleidigen. Die Bande hatte zu kuschen und ergebenst zu lauschen, wenn Carberry sein Seemannsgarn spann.
So dachte er jedenfalls.
Dem Äquator waren sie jetzt wieder nahe, wie Carberry nach eingehendem Studium der Karten im Ruderhaus festgestellt hatte. Obwohl der Monatserste verstrichen war, konnte man durchaus noch jemanden in den April schicken. Zweifacher Anlaß für den Profos also, nach einem willfährigen Opfer Ausschau zu halten.
Carberry schritt nicht, er stapfte über Deck. Sein Blick verharrte auf Bill. Der Schiffsjunge schickte sich gerade an, in den Großmars aufzuentern. Dort sollte er den Ausguck Bob Grey ablösen.
Carberry stoppte den Moses.
„He!“ rief er. „Bill, komm mal her, Söhnchen!“ Er blieb mit gegrätschten Beinen stehen und glich die Schiffsbewegungen aus. Als Bill, der schon nach den Luvhauptwanten gegriffen hatte, sich jetzt umdrehte und anmarschierte, setzte Carberry seine bedeutungsvollste Miene auf und sagte: „Hör zu, halte nach den Wegweisern Ausschau, die uns die Richtung zum Äquator zeigen, verstanden?“
„Mister Carberry“, erhob Bill einen schwachen Einwand.
Der Profos ließ sich nicht bremsen. „Wir sind jetzt nahe dran, und du kriegst was hinter die Löffel, Söhnchen, falls du die Hinweisschilder verpennst, die überall in der See aufgestellt sind“, fuhr er fort.
Bill nahm seinen ganzen Mut zusammen. „Mister Carberry, ich habe meine Äquatortaufe schon hinter mir.“
„Wie? Was? Als ob ich das nicht wüßte. Halt den Mund und rede nur, wenn du gefragt wirst.“ Carberry holte zu einem schwungvollen Vortrag über den Zaun aus, durch den der Verlauf des Äquators rund um die Erde gekennzeichnet war, über das Gatter, das hier ganz aus Bambusrohr gearbeitet war und das man erst durchbrechen mußte, um auf die andere Seite zu gelangen.
Aber Bill holte ganz tief Luft und rief: „Also nein, bei allem Respekt, auf die Geschichten falle ich nicht mehr herein. Tut mir leid, Mister Carberry. Bitte mich abmelden zu dürfen.“
Der Profos war richtig erschüttert. Eine Weile stand er finster schweigend da, und Bill befürchtete schon das Schlimmste. Dann sagte Carberry aber nur: „Also gut, hau ab, mein Sohn.“
Bill kehrte zu den Luvwanten zurück und kletterte in den Webeleinen hoch, froh, einem brüllenden Donnerwetter des Profos’ entgangen zu sein.
Sir John ließ sich auf der Profosschulter nieder, aber sein Herr scheuchte ihn weg.
„Verschwinde, du Schnarchhahn“, fuhr er den bunten Vogel an. „Sieh zu, daß du Land gewinnst.“ Wirklich, um Carberrys Stimmung war es jetzt nicht mehr zum besten bestellt.
Er trat zu dem jungen Dan O’Flynn, der sich gerade auf dem Rand der Kuhlgräting niedergelassen hatte.
„Jetzt wird der Bengel auch schon frech“, sagte Carberry verdrossen. „Das hat er von dir gelernt. Seit du nur noch selten als Ausguck oben im Mars hockst, läßt die Disziplin zu wünschen übrig. Eines Tages stauche ich euch Kakerlaken alle zusammen, daß euch Hören und Sehen vergeht.“
Dan hatte den Dialog zwischen Carberry und dem Schiffsjungen natürlich verfolgt. Ihm lag schon eine spöttische Erwiderung auf der Zunge, aber dann sagte er sich, daß man’s nicht übertreiben solle.
„Ed“, entgegnete er daher beinah sanft. „Laß doch. Bill ist dabei, sich zum vollwertigen Decksmann zu mausern. Gerade du hast ihn doch sonst immer unter deine schützenden Fittiche genommen.“
„Meine was? Der Teufel soll den Burschen holen.“
„Na ja. Jedenfalls mußt du verstehen, daß Bill an deine haarsträubenden Schauermärchen nicht mehr glauben will.“
Der Profos wollte einen lauten Fluch loslassen, aber Dan redete weiter, ehe er dazu kam: „Außerdem – wir berühren den Äquator sowieso nicht. Es erübrigt sich also, davon zu sprechen. Wir segeln knapp nördlich an ihm vorbei, bevor wir durch die Straße von Malakka stoßen. Erst später, in der Indischen See, werden wir ihn wohl überqueren.“
„O’Flynn, du Schlauberger“, sagte der Profos. „Du hältst dich wohl für oberklug, was, wie?“
Sie hätten sich jetzt doch gestritten, wenn sich Bill, der Bob abgelöst hatte, nicht aus dem Großmars gemeldet hätte. Klar drang seine Stimme aufs Deck hinunter.
„Land in Sicht! Steuerbord voraus!“
2.
Nach dem Verlassen Borneos war es wirklich der erste Zipfel Erde, den die Seewölfe wiedersahen. Sie traten ans Schanzkleid ihres Schiffes, hoben Kieker vor die Augen und hielten mit gemischten Gefühlen Ausschau.
Hasard stand am Steuerbordschanzkleid im vorderen Bereich des Achterdecks. Er ließ das Spektiv sinken und sagte zu Ben, Ferris und Shane, die sich hinter ihm befanden: „Kein Festland, eine Insel, wie ich erwartet habe. Die Angaben auf den Karten erweisen sich wieder als ausgesprochen präzise.“
„Wir haben also den Kepulauan Riau vor uns?“ fragte Ferris Tucker.
„Ja, den Riau-Archipel.“ Hasard nahm noch einmal das Spektiv zu Hilfe und präzisierte dann: „Es muß sich um eine der kleineren, am weitesten nach Osten versetzt liegenden Inseln handeln.“
„Wir laufen sie nicht an?“ Ben Brighton warf Hasard einen Seitenblick zu.
„Ich habe es nicht vor. Haben wir Proviant- oder Trinkwasserprobleme, Ben?“
„Zur Zeit nicht.“
„Fast in der ganzen Malakkastraße befinden sich Inseln“, sagte der Seewolf. „In den nächsten Tagen haben wir also noch ausreichend Gelegenheit, uns an Land die Beine zu vertreten.“
„Sir!“ schrie Bill plötzlich. „Auf der Insel sehe ich etwas, das – ich glaube, das ist Feuer!“
„Ich ziehe dir die Haut in Streifen ab, wenn du dich nicht klarer ausdrückst, du karierter Decksaffe!“ brüllte Carberry von der Kuhl.
Hasard schaute noch einmal durch sein Spektiv, konnte im Rund der Optik aber keinen Feuerschein erkennen.
„Der Junge täuscht sich“, murmelte er. „Vielleicht hat ihn irgendein Sonnenreflex irritiert.“
Bill meldete sich jetzt aber wieder: „Sir, da brennt was ab, ich sehe es ganz deutlich!“
Hasard begab sich daraufhin auf die Kuhl, steckte das Spektiv weg und enterte selbst in den Großmars auf. Er kletterte zu Bill hinter die Segeltuchverkleidung der großen Plattform, spähte mit dem Glas nach West-Nord-West und bestätigte Sekunden später: „Es stimmt, Bill. Der Brand scheint am Leeufer der Insel entfacht worden zu sein, also im Südwesten. Daher konntest nur du ihn von deinem erhöhten Standort aus sehen.“
„Ja, Sir“, antwortete der Junge aufgeregt. „Was hat das Feuer zu bedeuten?“
Der Seewolf beobachtete unverwandt die Flammen, die einen wabernden Teppich über die Konturen der Insel legten. Er wußte sich selbst noch keinen Reim auf die Erscheinung zu bilden, hatte aber bereits beschlossen, die Sache nicht unbeachtet zu lassen.
Welche Ursachen mochte es für den Brand geben? Selbstentzündung? Nein, der tropische Regenwald war so feucht, daß jede Glut, die der Sonnenglast eventuell hineinfraß, sofort wieder erlöschen mußte.
Hatten Eingeborene das Feuer gelegt, um Teile der Flora abzufackeln, um vielleicht Lichtungen zu schaffen, auf denen sie neue Häuser bauen und Pflanzungen einrichten konnten? Hasard hielt auch das für sehr unwahrscheinlich. Meistens gaben sich die Eingeborenen mit dem zufrieden, was sie ihrer Umgebung so abgewinnen konnten, und mit dem Feuer scherzten sie auf keinen Fall. Was den Anbau von Früchten und Gemüse betraf, würden die Inselbewohner dafür keinesfalls einen Kahlschlag schaffen, denn sie waren mit Sicherheit Fischer, allenfalls noch Jäger.
Menschen schienen aber auf jeden Fall die Urheber der Feuersbrunst zu sein. Hasard erinnerte sich daran, daß Sun Lo, der Mönch von Formosa, ihm über gewisse Riten der Malaien berichtet hatte, bei denen Feuer eine wesentliche Rolle spielte.
Auf Bali, einer Insel weiter im Osten, sollten Tote beispielsweise an hölzernen Tiersymbolen aufgehängt und dann verbrannt werden, wobei es seltsamerweise sehr lustig zuging.
Fand dort, auf dem kleinen Eiland, ein derartiger Ritus statt? Für die Seewölfe wäre es kein Grund gewesen, sich die Angelegenheit aus der Nähe zu betrachten. Die Eingeborenen wollten bei einem solchen Zeremoniell gewiß nicht gestört werden.
„Möglich, daß es sich um Lagerfeuer handelt, Sir“, sagte Bill.
„Am hellichten Tag? Kaum. Außerdem lodern die Flammen zu hoch.“ Der Seewolf senkte das Spektiv. „Irgend etwas stimmt da nicht, und ich würde einiges darauf verwetten, daß unsere lieben Freunde, die Spanier, die Hände im Spiel haben. Weißt du was? Ich bin neugierig.“
„Das heißt …“
„Wir laufen die Insel an und sehen nach, wer das Freudenfeuer angezündet hat – und warum.“ Hasard richtete sich auf, beugte sich über die Großmarsumrandung und teilte den von unten heraufblickenden Männern seine Anweisungen mit.
Carberry ließ die Schoten noch etwas dichter holen, und Pete Ballie bewegte das Ruderrad. Die „Isabella VIII.“ luvte an und fuhr, mit Steuerbordhalsen und auf Backbordbug liegend, hoch am Wind auf Kurs West-Nord-West auf die Insel zu.
Hasard harrte im Großmars aus und ließ das Feuer nicht mehr aus den Augen.
Die Soldaten hatten auch die letzte Hütte in Brand gesetzt, und der Teniente Savero de Almenara schritt vor der glutigen, heißen Flammenwand dem zehn Mann starken Trupp entgegen, der die Dorfbewohner in den Inselwald hinein verfolgt hatte.
Ein Sargento war der Anführer des Trupps. Etwas außer Atem meldete er dem Teniente: „Nichts, nichts und wieder nichts. In dem verdammten Dschungel verliert sich jede Spur. Mag der Teufel wissen, wohin sich dieses Drecksvolk verkrochen hat.“
„Wir finden es heraus“, sagte de Almenara gepreßt. „Wir kriegen diese Bastarde, das schwöre ich euch – bei meiner Ehre.“ Er war ein echter Hidalgo, der Abkömmling einer verarmten Adelsfamilie andalusischen Geblüts, und in Sachen Stolz und Ehrgeiz schlug sein Herz besonders hoch. „So groß ist die Insel nicht“, erklärte er. „Wir stöbern sie auf, alle, und dann gnade ihnen Gott!“
Er wandte sich mit geballten Händen der Bucht zu.
Das Dorf lag schätzungsweise zwanzig Fuß über dem Meeresspiegel und war von den malaiischen Fischern klugerweise auf einer Anhöhe errichtet worden, damit die Flut den Hütten nichts anhaben konnte und man etwaige Angreifer schon von weitem sichten konnte.
An diesem Nachmittag hatte der Vorteil, von einem erhöhten Punkt auf die See zu blicken, den Eingeborenen allerdings nichts genutzt.
Der Teniente de Almenara sah sich vor die unerfreuliche Aufgabe gestellt, den Kommandanten des Verbandes über den Mißerfolg der ersten Verfolgung zu unterrichten. Hatte der Comandante Arturo Diaz Escribano schon bei der gelungenen Flucht der Dorfbewohner getobt, so würde er jetzt zweifellos mit de Almenaras Degradierung drohen und einen Heidentanz veranstalten.
De Almenara biß sich auf die Unterlippe. Er wußte, daß er beobachtet wurde. Der Kommandant und die Kapitäne der beiden anderen Schiffe rührten sich nicht von den Achterdecks ihrer dickbäuchigen Galeonen. Sie hielten ihre Fernrohre unablässig auf das Dorf gerichtet und hatten natürlich verfolgt, wie der Sargento mit seiner Gruppe zurückgekehrt war.
Jetzt verlangten sie näheren Aufschluß über den Verlauf der Aktion.
De Almenara handelte gewissermaßen unter dem Zwang der Situation. Wären die Dinge etwas anders verlaufen, hätte er dem Kommandanten keineswegs über jeden seiner Schritte Meldung erstatten müssen. So aber …
Abwartend schaukelten das Flaggschiff „Santissima Madre“, die „Santa Barbara“ und die „San Juan“ auf den kleinen Wellen der Bucht. Ihre hölzernen Leiber und Masten schienen eine Botschaft zu dem Teniente herüberzuschikken: Versager! Versager!
De Almenara haßte sie plötzlich, diese Schiffe.
Und er verfluchte den Auftrag, der ihn auf diese elende Insel geführt hatte.
„Isla de la mierda“, fluchte er, stampfte mit dem Fuß auf und drehte sich sodann zu einem seiner Untergebenen um. „Vorwärts, lauf zu den Booten, laß dich zur ‚Santissima Madre‘ übersetzen und teile dem Comandanté mit, daß wir die Eingeborenen aus den Augen verloren haben – daß wir aber den ganzen Urwald abbrennen und sie wie die Füchse ausräuchern werden, verstanden?“
„Si, Senor“, erwiderte der Soldat und rückte ab. Savero de Almenara suchte unterdessen mit dem Blick Siabu, den Batak.
Der hockte drüben, am Beginn der felsigen Landzunge, und ließ sich vom Feldscher der „Santa Barbara“ verarzten. Tiefe Schnitte hatte ihm Otonedju mit dem Parang beigebracht. Siabu hatte ziemlich viel Blut verloren, saß mit verzerrter Miene da und war bleich unter seiner braunen Hautfarbe geworden.
Der Teniente verspürte nicht das geringste Mitleid mit ihm. Seiner Meinung nach trug der Batak die Schuld daran, daß der Dorfälteste sich überhaupt hatte befreien können. Und erst Otonedju hatte ja den Widerstand der anderen Krieger entfacht.
De Almenara wollte Siabu aufscheuchen und zu sich beordern. Er suchte nach einer Möglichkeit, seine Wut an jemandem auszulassen, und der eingeborene Dolmetscher schien das richtige Objekt dafür zu sein.
Doch in diesem Augenblick sichtete de Almenara das fremde Schiff.
Siabu und der Feldscher konnten es nicht sehen, weil sie ihre Gesichter dem Teniente zugewandt hielten. Die Soldaten um de Almenara waren zu sehr mit dem Betrachten des knisternden Feuers beschäftigt, um der See ihre Aufmerksamkeit zu widmen – und in der Bucht wurde man des Schiffes schon gar nicht gewahr, weil die felsige Landzunge den Ausblick auf den heranrauschenden Segler versperrte.
So war der Teniente der einzige, der das Herangleiten der großen Galeone mit den überhohen Masten und den auffallend niedrigen Aufbauten bemerkte.
Savero de Almenara hätte den Melder, der in diesem Moment in eins der am Ufer liegenden Beiboote stieg, stoppen können, um die Nachricht über das Auftauchen des Schiffes an ihn weiterzugeben. Aber es gab einen direkteren Weg, die Verbandsführung über die Neuigkeit zu unterrichten.
Der Teniente hob einfach nur beide Hände und gab ein Zeichen zur „Santissima Madre“ hinüber.
Arturo Diaz Escribano registrierte die Gebärde. Überrascht zog er die Augenbrauen hoch. Eine Galeone im Süden, hatte der Teniente signalisiert. Wer? Der Kommandant erwartete keine Verstärkung, keinen Besuch. Er war an diesem Morgen mit klaren Anweisungen aus Bengkalis auf Sumatra ausgelaufen und hatte auch zwischenzeitlich keinen Hinweis darüber erhalten, daß irgendein spanisches Schiff mit seinem Verband zusammentreffen solle.
Sein Mißtrauen war geweckt.
„Das Großsegel setzen“, befahl er.
Der Zuchtmeister auf der Kuhl gab den Befehl an die Mannschaft weiter, und sofort stürzten alle auf ihre Stationen.
Die „Santissima Madre“ war nicht in der Bucht vor Anker gegangen, Escribano hatte mit dem Schiff beweglich bleiben wollen, um den Landtrupp gegebenenfalls durch das Feuer der Kanonen unterstützen zu können.
So drehte die Galeone jetzt ihren Bug nach Süden, legte sich platt vor den Wind und verließ langsam die Bucht. Auf diese Weise glitt die Landzunge an den Spaniern vorbei, und die Aussicht öffnete sich ihnen auch auf jenen Bereich, der hinter dem felsigen Auswuchs der Insel lag.
So entdeckten auch sie nun den großen Dreimaster, der hart am Wind liegend an den pfeilförmigen Bambusgestellen im Wasser vorbeizog, die die Malaien zum Fischfang benutzten. Das Schiff ließ die leichten Boote der Eingeborenen Steuerbord achteraus liegen, sie begannen im Kielwasser der Galeone zu tanzen.
Als das Schiff sich anschickte, die Landzunge zu runden, hatte der spanische Kommandant die Flagge von Kastilien und Léon in seinem Großtopp entdeckt.
Der Ausguck im Hauptmars der „Santissima Madre“ rief eine gleichlautende Meldung.
Escribano, ein mittelgroßer Mann mit pechschwarzem, dichtem Haupthaar und einem ebenso dunklen und prachtvollen Knebelbart, blickte zu seinem Bootsmann.
„Das scheint ein Handelsfahrer zu sein“, sagte er. „Entweder braucht er unsere Hilfe, oder er ist von weitem auf das Feuer aufmerksam geworden und nähert sich aus Neugierde. Ich glaube, wir können ihn unbesorgt heran lassen.“
„Mich überrascht die seltsame Bauweise des Schiffes“, erwiderte der Bootsmann.
„Neue Schiffstypen entstehen, und das Mutterland schickt uns Segler in die Kolonien herüber, über deren Aussehen wir nur staunen können“, meinte Escribano. „Ich schätze, wir haben es mit einer Galeone zu tun, die unterwegs nach Manila ist. Daß wir in Bengkalis nichts von ihr erfahren haben, liegt wahrscheinlich daran, daß sie erst heute morgen – nach unserem Auslaufen – dort vorbeigesegelt ist. Meines Erachtens könnte sie die Vorhut eines ganzen Verbandes darstellen, der noch vor Termin die Malakkastraße erreicht hat.“
Der Bootsmann zuckte mit den Schultern. „Wie Sie meinen, Comandante. Ich finde nur, das Ganze ist etwas zu vage ausgedrückt – mit Verlaub gesagt.“
Escribano verzog den Mund. „Das verbitte ich mir. Ich weiß, Sie denken an Piraten, aber weder die malaiischen Freibeuter noch die Seeräuber anderer Nationalitäten verfügen in diesen Gewässern über so große und so hervorragend in Schuß gehaltene Schiffe. Das kann nur ein echter Spanier sein.“
Soviel Überzeugung hatte der Bootsmann nichts entgegenzusetzen.
Er schaute nur unausgesetzt zu dem fremden Schiff hinüber, während der Kommandant aus den Toppen der „Santissima Madre“ signalisieren ließ, der große Dreimaster solle mit verringerter Fahrt in die Bucht einlaufen und sich auf Rufnähe dem Flaggschiff nähern.
Der Bootsmann grübelte nach, wo er schon einmal von einem außergewöhnlichen Schiff mit überhohen Masten hatte reden hören.
Zweifellos in Bengkalis.
Aber Bengkalis war ein winziger Hafen und ziemlich verlorener Posten auf einer Rieseninsel, die gerade erst richtig erschlossen wurde, und viele Dinge, die beispielsweise in Manila als Botschaften verfaßt wurden, drangen nur unvollkommen bis dorthin.
So kam der Batelero trotz allen Nachsinnens nicht darauf, daß man es bei, dem Fremden mit Spaniens Feind zur See Nummer eins zu tun haben könnte, mit einem gewissen Philip Hasard Killigrew.
Hasard war wieder aus dem Großmars abgeentert. Er hatte genug gesehen und gab jetzt die letzten Kommandos an Carberry, Ben Brighton, Ferris Tucker, Shane und Dan, die alle erforderlichen Vorbereitungen für die bevorstehende Zusammenkunft betrafen.
Heimlich und in aller Stille wurde zum Gefecht gerüstet. Als die „Isabella“ langsamer werdend auf das Flaggschiff zusteuerte, war jedes Geschütz an Oberdeck fix und fertig geladen. In den Kupferbecken glühte das Holzkohlenfeuer, jeder Mann stand auf seinem Posten.
Die Galeone, die soeben die Inselbucht verlassen hatte, schien das Flaggschiff des Dreierverbandes zu sein. Hasard blickte mit dem Spektiv zu dem imposanten Zweidecker hinüber und zählte die Stückpforten. Es waren zwölf. Vierundzwanzig Kanonen führte der Segler also, und sicherlich handelte es sich um 17-Pfünder-Culverinen, keine leichten Kaliber. Den Namen des dickbauchigen Schiffes vermochte der Seewolf nun auch zu lesen: „Santissima Madre“.
Er blickte nach rechts in die Bucht und taxierte auch die beiden anderen, etwas kleineren Galeonen. Je sechzehn Geschütze trugen sie auf ihren Decks, hinzu gesellten sich jeweils zwei Demi-Culverinen beziehungsweise Minions in Bug und Heck.






