Seewölfe Paket 7
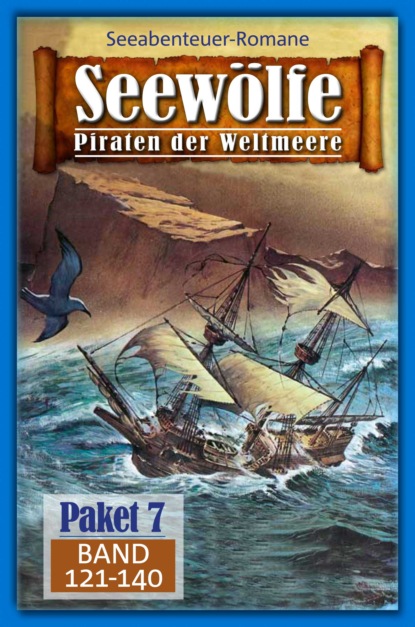
- -
- 100%
- +
An dieser Pier legten sie nun an und warteten. Es gehörte mehr als Hartgesottenheit dazu.
Von der Stadt her näherten sich Soldaten und Zivilisten, ausnahmslos bewaffnete Leute. Die Stadtgarde verschaffte sich Platz und stürmte die Piers, als könne sie von hier aus etwas ausrichten.
Jeden Augenblick konnten die Seewölfe entdeckt werden, in Sekundenschnelle konnte ihre Maske fallen und ihr gefährliches Spiel aufgedeckt werden.
Den hochrädrigen Karren hatten sie im Innenhof der Stadtkommandantur stehen lassen, und von hier aus war es für Blacky, Al, Sam, Luke, Dan und Matt keine Schwierigkeit mehr gewesen, zur Hafenfeste zu gelangen.
Hier befand sich das Hauptquartier des Hafenkapitäns – ihr Ziel. Hasard hatte ihnen aufgetragen, den biederen Amtsstuben der noch verstaubteren Beamten und Offiziere einen „Höflichkeitsbesuch“ abzustatten. Er versprach sich etwas davon.
Blacky und Luke Morgan in der Verkleidung spanischer Soldaten betraten das wuchtige, klotzartig aus großen Quadern errichtete Gebäude, als im Hafen der Feuerzauber losging. Sie blieben stehen und sahen sich an.
An ihnen vorbei stürmte plötzlich ein Pulk Soldaten.
„Alarm!“ schrie jemand, wer, ließ sich nicht mehr feststellen. „Ein Überfall auf den Hafen! Zwei Schiffe sinken!“
„Nichts wie hin!“ rief Luke, der vermeintliche Katalone.
Sie ließen die Kompanie an sich vorbei, dann schlüpften sie in das festungsgleiche Haus. Al Conroy und Sam Roskill folgten ihnen auf einen Wink Blakkys hin. Dan O’Flynn und Matt Davies standen draußen Wache. Alle sechs hatten sie ihre bislang vorzüglich verborgenen Pistolen gezückt. Jeder führte zwei mit, darunter auch die kostbaren Modelle, die Dan von der „Sao Paolo“ mitgenommen hatte.
Blacky, Luke, Al und Sam genossen in den Amtsstuben der Hafenverwaltung nahezu Narrenfreiheit. Jetzt, da die Wache abgerückt war, brachen sie Schränke, Pulte, Truhen und Kästen auf. Leider ohne Erfolg. Blacky lief auf einen Flur hinaus, entdeckte eine Treppe und nahm die Stufen, ohne zu zögern.
Das große Zimmer, in das er wenig später im Obergeschoß eindrang, barg mehrere Überraschungen zugleich. Da war einmal der bärtige Mann, der gerade in seine Uniform stieg und fürchterlich fluchte. Seiner Montur nach konnte er nur der Hafenkapitän von Manila sein. Blacky und die hinter ihm hereinstürmenden Luke, Al und Sam verzichteten darauf, sich vorzustellen. Sie hatten viel mehr für die zarten Ladys übrig, die sich gerade kreischend zurückzogen – drei an der Zahl. Sie waren die zweite Überraschung – leicht und offenherzig gekleidete, von der Natur großzügig bediente Mätressen für die Silvesternacht.
Die dritte Überraschung war ein Vitrinenschrank, der Schriftrollen barg. Blacky hielt den erstarrenden Kapitän in Schach. Luke warf den davoneilenden Frauenzimmern noch einen entsagungsvollen Blick nach, seufzte ein langgezogenes „Schade“ und trat dann vor den verglasten Schrank. Er wollte auf das Schloß feuern, aber Al Conroy bremste ihn. Blacky hob die Pistole und zielte auf die Stirn des Hafenkapitäns.
„Den Schlüssel, Caballero“, sagte er.
Wenig später untersuchten sie den Inhalt des Vitrinenschrankes und steckten sich die größten und ausführlichsten Karten zu, als die sich ein Teil der sorgsam gehüteten Dokumente entpuppt hatte.
Luke Morgan schlug den Capitán nieder, dann ergriffen sie alle vier die Flucht. Unten in der Gasse vor dem Gebäude trafen sie sich mit Dan und Matt, und gemeinsam hetzten sie zum Hafen, um die nördlichste Pier zu suchen.
Blacky und Luke konnten sich dank ihrer Kostümierung durch eine Menschenmenge boxen, die den Zugang zum Hafen verstellte. Immer dichter ballte sich die Traube aus Leibern zusammen, selten hatte es in der Silvesternacht in Manila eine derartige Vorstellung gegeben. Auf der Reede duellierten sich die Galeonen, zwei Spanier gegen einen tolldreisten, offenbar wahnsinnigen Eindringling. Der dritte Spanier wollte auch eingreifen, aber er schickte sich kaum zum Auslaufen auf die offene Reede an, da zuckte ein Stakkato von Feuerblitzen von seiner Bordwand auf, mischte sich mit schwarzen Rauchschwaden, mit Gebrüll und wirbelnden Trümmern, Geschützfragmenten, Menschenteilen.
Vor dieser Kulisse gelangten Blakky und seine fünf Begleiter an die nördlichste Pier. Sie sahen die Schaluppe liegen und erkannten Hasard und die anderen, aber ein Trupp Soldaten rückte soeben auf die Kameraden los.
Blacky reagierte augenblicklich. Er feuerte seine Pistolen ab, duckte sich und gab auch Al, Sam, Luke, Dan und Matt die, Möglichkeit, auf die Gegner zu schießen. Im Krachen der Waffen sanken die Spanier auf der hölzernen Pier zusammen.
Blacky ließ die fünf Kameraden an sich vorbei und sprang als letzter in die zum Ablegen bereite Schaluppe.
Die Stadtgarde rollte ein leichtes Geschütz heran, als sie Distanz zwischen sich und die Pier legten. Nicht schnell genug schob der Nordostwind die Seewölfe auf ihre „Isabella“ zu, der Schuß der Garde mußte sie vorher erwischen.
Hasard zündete einen der Brandsätze, die er vorsichtshalber mitgenommen hatte. Es zischte, weißes Feuer verließ die Schaluppe und tanzte wie ein Irrwisch auf den Anleger zu. Mitten in die Menge der Widersacher stob das verheerende Feuer, und die Seewölfe entkamen.
Ben Brighton ließ auf die Spanier feuern und manövrierte die „Isabella“ hin und her, aber er hatte die ganze Zeit über Bedenken, die Kameraden in der Schaluppe zu gefährden. Erst als Hasard und die zwölf unter Ausnutzung der Verwirrung, die die Explosion auf der dritten Kriegsgaleone gesät hatte, glücklich zur „Isabella“ zurückgelangten und hastig an Bord aufenterten, konnte Ben sämtliche Register ziehen.
Mit vereinten Kräften heizten die Seewölfe ihrem erklärten Todfeind ein. Der Himmel über Manila färbte sich dunkelrot. Zwei Handelsschiffe sanken, ein Kriegssegler mit hervorragender Armierung brannte lichterloh und ging ebenfalls unter, indem er nach Backbord krängte und flutweise Wasser aufnahm – dann, schließlich, loderte noch eine Kriegsgaleone, weil Shane und Batuti sie mit Brand- und Pulverpfeilen beschossen hatten.
An diesem Punkt des Gefechts wandte sich die „Isabella“ der Ausfahrt der Bucht zu. Hasard wollte in die Nacht fliehen, bevor sein in kurzer Zeit zum zweiten Male gründlich repariertes Schiff lädiert wurde.
Als sie auf die Mole zurauschten, gab es jedoch eine herbe Überraschung. Von See her näherte sich ein großer Schatten, ein schnittiges, gut bestücktes Schiff, dessen Kapitän sich ihnen tollkühn entgegenwarf und versuchte, ihnen den Fluchtweg zu versperren.
Hasard kannte das Schiff nicht, er hatte es nie zuvor gesehen.
Und er ahnte auch nicht, wer sich zum Kapitän dieser Dreimast-Galeone ernannt hatte – Lucio do Velho. Er war bereit, die „Santa Luzia“ und die komplette Mannschaft samt Ignazio, dem Mann aus Porto, zu opfern, wenn er dadurch nur den verhaßten Gegner zur Strecke bringen konnte – Spaniens Feind Nummer eins.
„Drehbassen!“ schrie Hasard.
Smoky und Al Conroy begrüßten den Ankömmling mit zwei gezielten Schüssen. Danach trat Batuti vom Vormars aus in Aktion und sandte Brandpfeile zur „Santa Luzia“ hinüber.
Do Velho, dem das Grollen der Kanonen und der Feuerschein über Manila von weitem bereits gezeigt hatten, daß er zu spät erschien, um die Obrigkeiten zu warnen – do Velho ließ abfallen und präsentierte dem Gegner die Backbordbreitseite.
Seine schlimmsten Befürchtungen hatten sich bewahrheitet – der Seewolf hatte die Festung Spaniens auf den Philippinen angegriffen. Eine bodenlose Dreistigkeit, die dem Portugiesen aber selbstverständlich genau recht war. Jetzt konnte er beweisen, welche Fähigkeiten in ihm steckten, wie er einen Korsaren Englands abservieren würde!
Aber von der „Isabella“ huschte plötzlich etwas Gleißendes, Flirrendes zu der „Santa Luzia“ herüber. Ein Brandsatz aus den geheimen Werkstätten am Hof des Großen Chan, von dessen Werden und Existenz, Beschaffenheit und Funktion do Velho bisher nicht die geringste Ahnung gehabt hatte.
Mitschiffs schlug das Geschoß bei der Galeone „Santa Luzia“ ein, und sofort rasten gefräßige Flammenbündel weiß, grell und heiß über das Oberdeck. Fassungslos begriff do Velho unter dem Schreien seiner Männer, daß er den Seewolf wieder unterschätzt hatte.
Der „Isabella“ gelang der Durchbruch, obwohl einige beherzte Portugiesen trotz des himmelan fauchenden Feuers noch an die Geschütze zurückstürzten und sie zündeten.
Keine Kugel traf die „Isabella.“
Sie verließ die Bahia de Manila endgültig, ging an den Wind und verschwand in südlicher Richtung in der Nacht.
Hasards Schiff konnte alle Verfolger abhängen. Ein langer Törn begann. Er führte die Seewölfe über Palawan, die südwestlichste Philippinen-Insel, bis hinunter nach Borneo, nach Tandjung Datu Hier mußten Trinkwasser und Proviant an Bord gemannt werden, hier gönnte der Seewolf sich und seinen Männern endlich wieder eine Ruhepause. Verspätet holten sie jetzt, im Januar 1585, die Silvester- und Neujahrsfeier nach, vergaßen Manila und dachten an daheim, unter anderem auch an Plymouth, die „Bloody Mary“ und den spekkigen Nathaniel Plymson.
In Manila hatte ein zorniger Lucio do Velho den Obrigkeiten berichtet, was sich seit Formosa zugetragen hatte. Er, der geborene Mime, brachte dies alles so überzeugend vor, daß man ihm eine Sondervollmacht aushändigte, die ihn fortan als Seewolf-Jäger Nummer eins auswies.
Er erhielt ein großes, neues Schiff, eine hervorragend ausgerüstete Galeone. Zum Kommandanten wurde er befördert, und auch Ignazio, der Mann aus Porto, stieg ein paar Sprossen auf der Leiter der Hierarchie auf.
Do Velhos Auftrag lautete, den Seewolf weiterhin zu jagen, zu stellen und dem Oberkommando der Armada zu überführen – tot oder lebendig.
Do Velho wußte, daß er diese Aufgabe mit Ehrgeiz und Eifer weiterverfolgen würde. Einmal hatte er dem Seewolf bereits eine tödliche Falle gestellt, die dem Mann und seiner Crew fast den Tod gebracht hatte. Vielleicht gelang es beim zweiten Male besser.
Philip Hasard Killigrew wußte von dieser Entwicklung nichts, gleichwohl war ihm aber klar, daß er immer mehr Feinde im Nacken sitzen haben würde. Die Dinge spitzten sich zu, der Feind war bis zur Weißglut gereizt – wie auch im fernen Europa der Konflikt zwischen England und Spanien immer rascher seinem explosiven Höhepunkt entgegenstrebte.
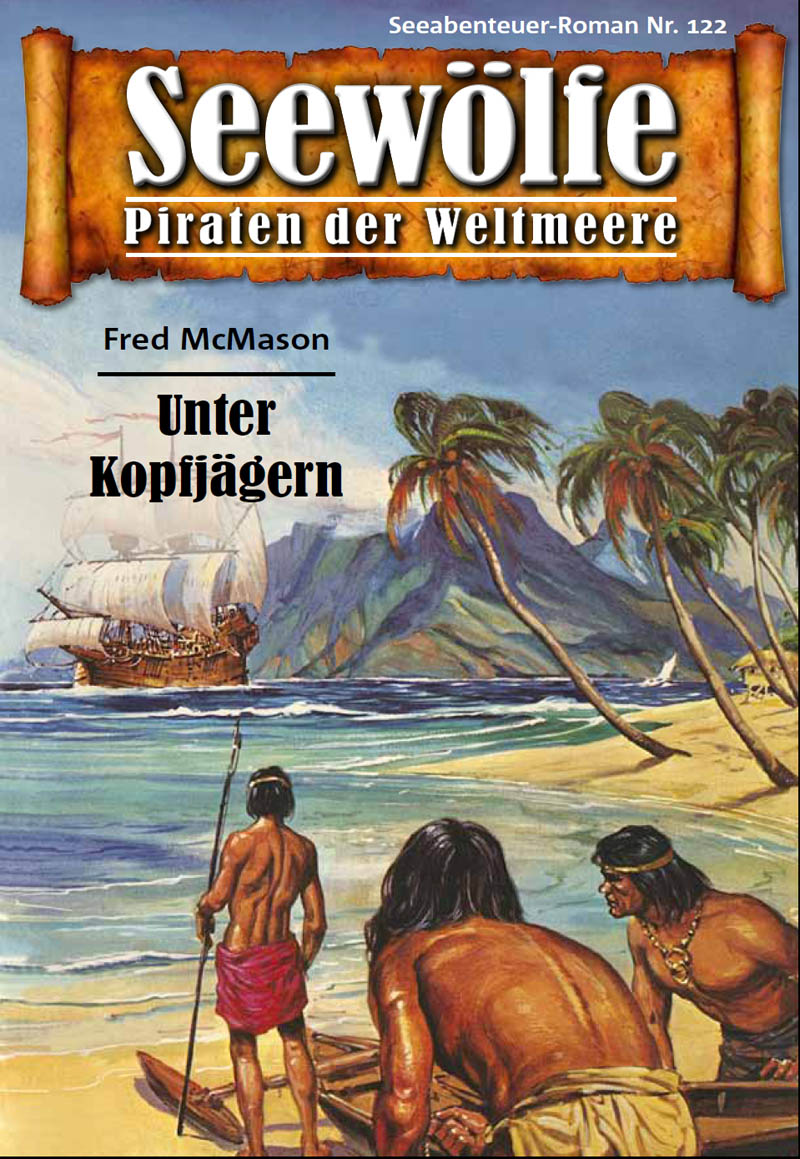
1.
Nach dreitägiger Irrfahrt erreichten sie nachts die Insel. Daß es eine Insel war, wußte keiner der beiden, sie waren so benommen, ausgehungert und halb verdurstet, daß sie kaum merkten, wie ihr kleines Boot auf den Sand stieß, wie eine Welle es hochhob und schließlich ganz auf den flachen Strand trieb.
Sie taumelten auf festes Land zu, warfen sich in den feinkörnigen Sand und blieben liegen. Mehr als zehn Stunden schliefen sie ununterbrochen. Dann wurde Virgil Romero von der Sonne gekitzelt und fuhr mit einem leisen Schrei hoch.
Seine Lippen waren aufgeplatzt, die Haut gedunsen und seine Vorderzähne so locker, daß er sie ohne Mühe mit den Fingern hätte herausziehen können.
Sein Schrei weckte Antonio, den Steuermann, und dieser Schrei wirkte so ansteckend, daß Antonio ebenfalls aufsprang und in wilder Panik davonlaufen wollte.
Virgil hielt ihn fest und starrte in das vertraute Gesicht, das jetzt so fremd wirkte.
Ein vier Tage alter Bart aus schwärzlichen Stoppeln bedeckte das Gesicht des Steuermanns. Seine Wangen waren eingefallen, seine Augen lagen tief in den Höhlen, und Salzwasser und heiße Sonne hatten sein Gesicht verbrannt. Virgil sah die Haut in Fetzen von diesem Gesicht herunterhängen.
„Wir sind – in Sicherheit“, sagte er mühsam lallend. Seine Stimme war ein heiseres Krächzen, sein Hals brannte bis hinunter in den Magen.
„Ich habe entsetzlichen Durst“, klagte Antonio und sah sich wieder gehetzt um.
Niemand war zu sehen. Anscheinend waren sie allein. Man hatte sie auch nicht mehr verfolgt, seit ihrer überstürzten Flucht.
Es dauerte eine Weile, bis sie begriffen, daß es hier keine Kopfjäger mehr gab.
Vor ihnen dehnte sich weißer Strand, knapp eine halbe Meile lang. Dann schien der Strand hart nach links zu laufen und verschwamm vor ihren Blikken.
„Ich glaube, wir sind auf einer Insel“, sagte Virgil. „Und diese Insel scheint verdammt klein zu sein.“
„Durst“, murmelte der Steuermann schwach. „Nur einen Tropfen Wasser, es zerfrißt mir die Eingeweide.“
Seine tief in den Höhlen liegenden Augen glänzten fiebrig, seine pelzige Zunge schob sich zwischen den Lippen hervor und versuchte sie zu benetzen.
An Bord der „Nuestra Madonna“ war er immer der harte Kerl gewesen, dachte Virgil. Da hatte er die anderen wissen lassen, wer der Steuermann war, und nicht gezögert, brutal hinzulangen, auch wenn kein besonderer Anlaß vorhanden gewesen war.
Aber jetzt war er ein kraftloses Bündel, halbtot vor Angst und dem Wahnsinn nahe. Ein Feigling, dachte Virgil, einer der sich nicht mehr zurecht fand.
Am liebsten hätte er es diesem Lumpenhund heimgezahlt, doch hier war nicht der richtige Ort und nicht die Zeit dafür. Sie waren aufeinander angewiesen und mußten zusammenhalten, wenn sie überleben wollten. Und, verdammt, sie wollten überleben, nachdem sie diesen Teufeln in Menschengestalt entkommen waren.
„Zuerst das Boot auf den Sand“, sagte Virgil, „sonst treibt es ab, und wir sind erledigt.“
„Zuerst Wasser“, protestierte der Steuermann schwach.
„Zuerst das Boot!“ schrie Virgil.
Der Steuermann fügte sich widerspruchslos.
Es wurde eine höllische Plackerei, das leichte Boot höher auf den Sand zu ziehen, bis die Wellen es nicht mehr erreichten. Mit letzten Kräften schafften sie es. Virgil beschwerte den Anker, den er in den Sand grub, zusätzlich mit einem Stein.
„Wasser“, jammerte der Steuermann. „Ich will nicht krepieren.“
„Verdammt noch mal, ich auch nicht. Steh jetzt auf, dann suchen wir Wasser“, sagte Virgil und riß den apathisch dahockenden Steuermann an den Armen hoch.
Mehr taumelnd als gehend, manchmal auf allen vieren kriechend, bewegten sie sich am Strand entlang.
Über ihnen flirrte erbarmungslos die Sonne, der Sand heizte sich auf. Kleine Krebse flohen vor ihnen und verschwanden eilig in den Sandlöchern, wenn die Männer sich näherten.
Sie erreichten die Stelle, wo der Strand aufhörte und nach links lief. Dicht hinter dem Strand standen ein paar Palmen, niedrige Büsche und kleine Blumen, deren blutrote Blüten einen entsetzlichen Duft verbreiteten.
Virgil kniff die Augen zusammen. Ein leises Stöhnen entrang sich seiner Brust, aber er riß sich zusammen und kroch weiter.
Nach einer weiteren halben Meile bot sich ihnen immer noch das gleiche Bild. Es gab ein paar Palmen, einige Sträucher und eine größere Bodenerhebung, die dicht bewachsen war.
„Wir gehen im Kreis“, sagte der Steuermann, „da vorn liegt ein Boot.“
„Ja, da vorn liegt ein Boot“, sagte Virgil schweratmend. „Und das ist das Boot, mit dem wir hier gelandet sind. Jetzt weißt du, wo wir sind, und ich weiß es auch. Der liebe Gott persönlich hat uns in den Arsch getreten.“
Der Steuermann begriff immer noch nicht. Sein zitternder Finger deutete auf das Boot.
„Sie holen uns, diese Teufel!“ schrie er. Wie besessen rannte er plötzlich los, doch schon nach wenigen Schritten fiel er kraftlos in den Sand und heulte.
Virgil hockte sich neben ihn, seine Augen waren leer, glanzlos und starrten in die Ferne, wo sich bis zum Horizont nichts weiter als eine endlos glitzernde Wasserfläche erstreckte.
„Eine Insel“, murmelte er, „eine kleine verdammte Insel, und es gibt nicht einen einzigen Tropfen Wasser.“
Blicklos waren seine Augen auf das Boot gerichtet. Sie hatten die winzige Insel einmal in ganz kurzer Zeit umrundet und befanden sich jetzt wieder am Ausgangspunkt.
Wasser? Davon hatten sie mehr als genug, es ließ sich nur nicht trinken. An die Kokosnüsse, die in den Palmwedeln hingen, reichten sie nicht heran. Die befanden sich in unerreichbarer Ferne.
„Ich will was zu trinken“, jammerte der Steuermann nach einer Weile erneut und zerrte wütend an Virgils Arm.
Der stieß ihn hart von sich und schrie ihn mit hochrotem Kopf an. „Es gibt hier kein Wasser, verdammt! Hier hat es nie welches gegeben, und es wird auch nie etwas geben. Wir werden hier verrecken, todos los santos.“
Die Hitze wurde immer unerträglicher. Antonio lag im Sand und rührte sich nicht. Virgil schleppte sich kraftlos zu der Kokospalme hinüber und ließ sich in deren Schatten fallen.
Der Durst höhlte ihn aus, fraß in ihm und trocknete das Blut in den Adern, bis er glaubte, er bestände nur noch aus Staub.
Spätestens morgen würden sie elend krepieren, wenn nicht ein Wunder geschah. In dieser Gluthitze überlebte man nicht lange, wenn es kein Wasser gab.
Er sah sich um, starrte auf die übelriechenden Blüten und dachte nach. Wenn hier Blumen wuchsen, mußte es auch Wasser geben, eine winzige kleine Quelle nur, wovon sonst sollten sich diese Pflanzen ernähren?
Er begann mit der Suche, dabei warf er immer wieder einen Blick zu den großen Nüssen, die in schwindelerregender Höhe über ihm in dem Wedel der Palme hingen. Sie waren noch nicht ganz reif, aber das war nicht weiter wichtig. Wichtiger war, wie man sie kriegte.
Zuerst buddelte er mit beiden Händen wie besessen in dem Sand bei den Pflanzen, doch der Sand war trocken und heiß, und von dem Geruch, den die Blüten verströmten, wurde ihm schlecht.
„Madre de Dios“, betete er laut, „laß es auf dieser beschissenen Insel Wasser geben! Jeden Tag nur einen Schluck!“
Er wühlte weiter wie ein Tier. Er hatte ein tiefes Loch gebuddelt, über dem er mit dem Oberkörper hing. Schweiß rann ihm über das Gesicht, verklebte ihm die Augen, aber er gab nicht auf und grub weiter, bis seine Hände auf etwas Kühles stießen. Seine Finger wurden feucht, dann naß. Mit einem irren Auflachen erkannte er vor sich tief im Boden ein Rinnsal, das aus dem Sand quoll und einen Teil des Bodens bedeckte.
Als er sich vorbeugen wollte, wurde er zur Seite gerissen. Eine Hand packte ihn, schleuderte ihn fort, ein Fuß trat nach ihm.
Der Steuermann warf sich in das Loch. Sein Gesicht war vom Wahnsinn gezeichnet, seine Hände hielt er wie Klauen gestreckt abwehrbereit zur Seite.
Virgil hatte seine letzten Kräfte verbraucht. Er lag halb auf der Seite im Sand und stöhnte leise.
„Du verdammter Hund“, murmelte er immer wieder. „Laß mir auch einen Schluck, ein paar Tropfen nur!“
Antonio zuckte zurück, als hätte er einen Hieb ins Gesicht erhalten. Erstaunlich rasch kroch er aus dem Loch heraus, Sand auf den Lippen, in den Augen. Sandige Brühe troff ihm aus dem rechten Mundwinkel, und er spuckte.
„Salzwasser!“ heulte er laut. „Und ich habe fast alles gesoffen.“
Virgil konnte kein Mitleid mit ihm empfinden. Der Steuermann hätte ihm keinen Tropfen übriggelassen, wäre es Süßwasser gewesen.
Der Steuermann erbrach sich, aber so sehr er auch zuckte und bebte, er brachte nur ein paar Tropfen heraus. Das schwächte ihn so, daß er wieder in den Sand fiel und sich nicht mehr rührte.
Auch Virgil wollte sich erschöpft und ausgelaugt wieder in den Schatten lehnen, als ihn ein Gedanke durchzuckte, der seine Lebensgeister schlagartig aufpeitschte.
Im Boot lag eine Muskete!
Er lief los, stolperte, fiel der Länge nach hin und raffte sich wieder auf, bis er das Boot erreichte.
Ja, die Muskete lag noch da, sie hatten sie auf ihrer überstürzten Flucht mitgenommen, als sie sich gegen die Wilden gewehrt hatten. Mit der Muskete konnte er ein paar Kokosnüsse herunterschießen, und wenn sie nur eine oder zwei erwischten, dann würde das in jedem Fall ihr Leben verlängern. Virgil hatte von einem spanischen Schiffbrüchigen gehört, daß man ein ganzes Jahr lang leben konnte, wenn man jeden Tag nur eine einzige Kokosnuß verzehrte.
Die nächste Enttäuschung versetzte ihm einen fast körperlich spürbaren Schlag. Das Pulver war naß und matschig, ein unbrauchbarer dunkler Brei. Er goß die dunkle Suppe vorsichtig auf die Ducht und wartete darauf, daß die Sonne es trocknen möge.
Antonio rührte sich nicht. Es hatte den Anschein, als würde er den morgigen Tag nicht mehr erleben, und er selbst, Virgil, konnte sich trotz seiner besseren Kondition ausrechnen, wann es auch mit ihm soweit war.
Er fühlte sich hundeelend und war den Tränen nahe. Einmal begann er laut zu fluchen, dann wieder betete er laut und inbrünstig, und schließlich verfluchte er Gott und die Welt.
Drei Tage hatten sie gebraucht, um diese verdammte Insel zu erreichen. Drei Tage mindestens würden sie auch wieder brauchen, um zum Festland zu gelangen, wo es Trinkwasser gab.
Aber da gab es auch die Kopfjäger und Menschenfresser, die sie unbarmherzig jagen würden.
Nein, es war nicht zu schaffen, entschied er. Sie würden auf See verdursten oder hier, es blieb sich gleich. Hier hatten sie wenigstens die Wilden nicht zu fürchten.
Alle Augenblicke sah er nach, ob das Pulver trocken war. Es klebte langsam zu einer kuchenartigen Masse zusammen, war im Innern aber immer noch feucht.
Die Hitze nahm zu. Mörderisch heiß schickte die Sonne sengende Strahlen zur Erde. Selbst im Schatten war es kaum zum Aushalten. Die heiße und schwüle Luft legte sich beklemmend auf die Lungen.
Gegen Mittag zerbröselte Virgil einen Teil des Pulvers und lud mühsam und mit gequollenen Händen die Muskete.
Doch das Pulver entzündete sich nicht, er konnte tun, was er wollte, es gab keinen Blitz, nichts.
Wütend und enttäuscht warf er die Muskete ins Boot zurück.
Danach versuchte er es mit Steinen, und als er damit ebenfalls keinen Erfolg hatte, rüttelte er wie besessen am Stamm der Palme, ohne daß es etwas einbrachte.
Schließlich versuchte er sie zu erklimmen. Er schaffte nur ein paar Schritte, dann hielten seine Hände nicht mehr fest, er konnte nicht zupacken, verlor den Halt und stürzte kopfüber in den heißen Sand.
Der Tobsuchtsanfall, der dann folgte, zehrte seine letzten Kräfte auf. Dort hoch oben hing das, was sein Leben verlängerte, kühle süßliche Milch, die seinen Durst löschte, Fruchtfleisch, das seinen Hunger stillte, aber es war so weit entfernt wie der Mond.
Zwei Stunden lang lag er reglos da, mit pochendem Herzen, rasselndem Atem und jagenden Lungen, dann verfiel er auf die Idee, den Stamm der Palme zu kappen.
Er kroch zu dem Steuermann hinüber und riß ihm das Messer aus dem Hosenbund. Antonio rührte sich nicht, er hatte sich in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr bewegt. Vielleicht war er tot, oder das Salzwasser hatte ihm den Rest gegeben.
Mit dem Messer hieb er wütend und knurrend wie ein gereizter Hund immer wieder in den Stamm der Palme. Er hieb zu, als hätte er seinen Todfeind vor sich, immer und immer wieder.
Aus dem zerfetzten Stamm rann etwas Flüssigkeit. Virgil preßte die aufgesprungenen Lippen daran und begann gierig zu saugen.
Er spürte, wie neue Kraft in ihm aufloderte, und wie besessen hackte er weiter. Er hatte nicht gedacht, daß das Holz dieser Palme so unglaublich hart und zäh war und sich immer nur winzige Späne herausfetzen ließen.
Aber mit dem weiteren Abspänen sickerte auch immer wieder etwas von dieser Flüssigkeit aus dem Stamm, die ihm neues Leben verlieh.
Nach einer Ewigkeit hörte er auf. Diese Arbeit war allein nicht zu schaffen, und er sah nicht ein, daß sich der lausige Steuermann im Sand ausruhte und nichts zur Arbeit beitrug. Schließlich kam er ja auch in den Genuß der Früchte, sobald die Palme gefällt war.
Er stieß ihn mit dem Fuß an.
„Steh auf“, sagte er heiser. „Hilf mir, den Stamm zu fällen, du fauler Hund! Dann haben wir Milch, kühle Milch!“
Antonio ächzte leise und sah aus blicklosen Augen in den Himmel.
„Wasser!“ brüllte Virgil ihn an, um seine Lebensgeister zu mobilisieren, doch der Steuermann begriff nicht mehr, was er wollte. Ein häßliches Grinsen hatte sich um seine Mundwinkel eingekerbt, in den blicklosen Augen lag ein fast spöttischer Ausdruck.










