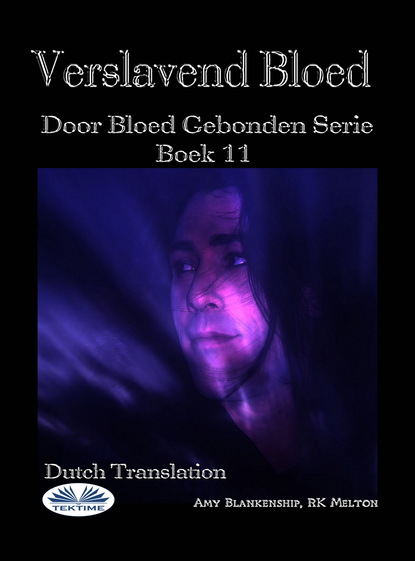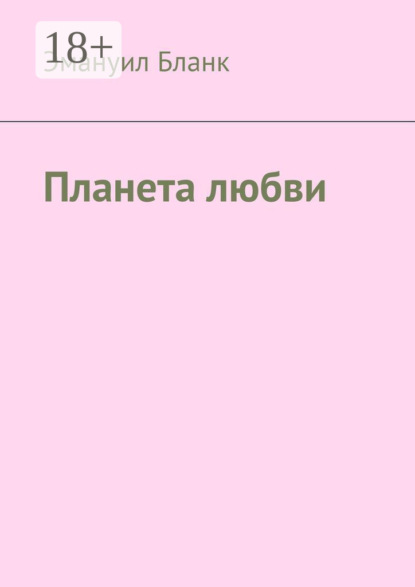Seewölfe Paket 7
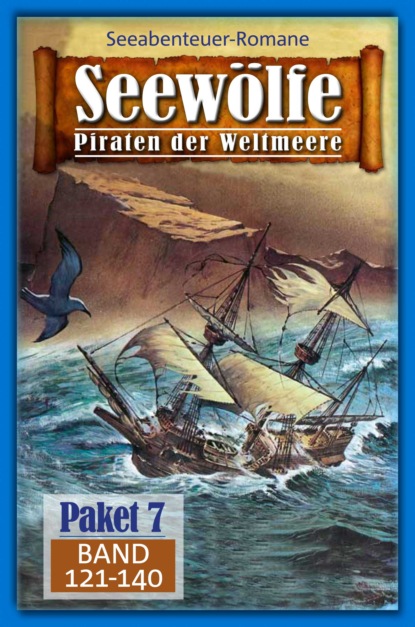
- -
- 100%
- +
Virgil zuckte mit den Schultern und wollte sich abwenden. Geschieht dem Kerl ganz recht, sagte eine innere Stimme in ihm. Um den ist es nicht schade. Warum sollst du dich mit ihm abrackern?
Aber da war auch noch eine andere Stimme, und die appellierte an sein Gewissen.
Du kannst ihn nicht verrecken lassen. Ihr seid durch tausend Höllen gegangen. Hilf ihm! Gib ihm etwas zu trinken!
Virgil ließ sich auf die Knie fallen und starrte in das aufgedunsene dreckige Gesicht des Mannes.
Helfen! Hatte das noch einen Sinn? Der Steuermann würde es doch nicht überleben. Weshalb sollte er den kostbaren Saft mit ihm teilen.
„Grins nicht so!“ fuhr er ihn an, doch dann hatte die andere innere Stimme gesiegt.
Mühsam, fluchend und schwitzend, schleppte er den Mann zu der Palme hin und drückte sein Gesicht an den Stamm, hielt ihn im Genick fest und drückte.
Antonio hieb in wilder Gier die Zähne in den Stamm, seine Lippen preßten sich darauf, er stöhnte leise.
Als Virgil ihn losließ, fiel er zurück in den Sand.
Etwas später, die Sonne stand jetzt senkrecht am Himmel, brach das Messer ab.
Virgil starrte es ungläubig an, lachte heiser und begann am ganzen Körper zu zittern.
„Das darf nicht sein“, stammelte er, „Madonna, gib, daß es nicht wahr ist!“
Ein kleiner scharfkantiger Stumpf ragte nur noch aus dem Heft.
Zuerst wollte der spanische Seemann aufgeben, aber der Palmensaft hatte doch seine Lebensgeister geweckt und ihn ermuntert.
Diablo, vielleicht geht es auch mit diesem Stumpf hier, überlegte er. Er brachte es nicht fertig, sich einfach hinzulegen und auf das Ende zu warten. Er wollte kämpfen, solange noch ein winziger Funke Leben in ihm war.
Nachts wurde es unangenehm kühl. Tagsüber war die Hitze nicht zum Aushalten gewesen, doch jetzt kroch eisige Kälte durch Virgils Körper.
Er hockte vor der Palme, wiegte seinen Oberkörper und stieß den Messerstumpf rhythmisch in das faserige Holz. Immer wieder hieb er zu, bis der Mond über dem Wasser stand und silbrige Muster auf die kleinen Wellen zeichnete.
Ein paarmal schlief er vor Erschöpfung ein. Wenn er dann erwachte, rasten heiße und kalte Wellen durch seinen Körper. Fieber, dachte er, das Fieber hat mich gepackt, deshalb friere und schwitze ich abwechselnd, denn in diesen südlichen Breiten wurde es nachts gar nicht kalt.
Als der Morgen über dem Meer heraufdämmerte, erwachte Virgil schweißgebadet. Alpträume hatten ihn geplagt. Wilde waren hinter ihm hergelaufen und hatten versucht, seinen Kopf abzuhacken, wie sie es bei den anderen getan hatten.
Fieber schüttelte ihn. Er biß die Zähne aufeinander und fror erbärmlich.
Dann sah er nach dem Steuermann, blickte in die grinsende Fratze, sah die offenen Augen, die blicklos in den Himmel starrten, und wußte, daß Antonio kein Wasser mehr brauchte.
Der Steuermann war tot. Virgil befand sich jetzt allein auf einer winzigen Insel irgendwo in der Nähe der Insel Kalimantan.
„Eine Toteninsel“, sagte er kichernd. Dann deutete er mit dem ausgestreckten Finger auf den toten Antonio.
„Du hast dich davongeschlichen“, sagte er anklagend, „bist einfach abgehauen. So einfach hast du dir das gemacht!“
Er befand sich in einem merkwürdigen Zustand zwischen Schlafen und Wachsein, einem Halbdämmer, das die Konturen der Insel verzerrte, das den Toten mitunter hoch in den Himmel zu heben schien. Manchmal stand auch die ganze Insel auf dem Kopf oder schwebte zwischen weit entfernten Wolken am Horizont dahin.
Dann wankte er über die Insel, durchquerte sie, lief am Strand entlang und suchte erneut nach Wasser oder Tieren.
Aber auf der kleinen Insel gab es keine Tiere. Kein Vogel war zu sehen, nichts regte sich zwischen den kleinen Pflanzen.
Er war allein in einer unwirklichen Stille, allein mit Antonio, der sich so heimlich davongeschlichen hatte. Vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt, dachte er, wenn er einen lichten Augenblick hatte.
Immer wieder irrte er umher, blickte sehnsüchtig zu den Kokosnüssen und kratzte mit dem abgebrochenen Messer weiter am Stamm der Palme.
Am dritten Tag hatte er es immer noch nicht geschafft. Der Stamm war teilweise zerfetzt, aber er fiel nicht um, und er gab auch nur noch ein paar Tropfen von dem Saft her, der sein Leben rettete.
Müde, mit knurrendem Magen erklomm er die kleine Erhebung der Insel und blickte sich aus glanzlosen Augen um.
Wasser, wohin das Auge sah. Wasser, auf dem goldene Strahlen tanzten, das von silbrigen Wellen glitzerte, Wellen so klein wie krause Haare.
Ein Schreck durchzuckte ihn plötzlich, als er das Schiff sah.
Es lief mit vollen Segeln aus nördlicher Richtung genau auf die Insel zu. Es war ein Dreimaster, der eine mächtige Bugwelle vor sich herschob. Und die Segel waren so prall vom Wind gefüllt, daß die Masten sich unter dem Druck bogen.
Es ging nur kein Wind, überlegte Virgil. Wie konnte das Schiff also so schnell segeln?
Mit klopfendem Herzen lief er zum Strand hinunter und wartete. Doch als er einmal einen Blick auf Antonio warf und dann wieder zum Meer blickte, war das Schiff verschwunden.
Er konnte es nicht glauben, suchte wieder den Hügel auf, sah nach allen Himmelsrichtungen. Nichts, es gab kein Schiff, es hatte nur in seiner Phantasie existiert, oder er war einem Trugbild zum Opfer gefallen.
In der Nähe der Palme lag ein ekelhafter süßlicher Geruch in der Luft, der sich wie eine Wolke am Boden ausgebreitet hatte.
Sein leerer Magen drehte sich um, es würgte ihn, und als er ein paar Schritte in Antonios Richtung ging, wußte er, woher der ekelhafte Geruch stammte. Die Sonne zersetzte Antonios Körper.
Apathisch aß er von den Fasern des Palmenstammes, kaute sie und schlang sie hinunter. Danach ging er wieder an die Arbeit, aber der Geruch wurde immer unerträglicher.
Er hielt es schließlich nicht mehr aus, so übel wurde ihm, aber er konnte diesen Platz auch nicht verlassen, denn nur hier hingen die halbreifen Kokosnüsse.
Also mußte Antonio weg.
Es kostete ihn außer Kraft auch Überwindung, den toten Steuermann an den Armen zu packen und ihn ins Wasser zu schleifen. Dabei hatte Antonio immer noch dieses höhnische Grinsen im Gesicht, als lache er ihn aus.
Erst im Wasser wurde der Körper leichter. Virgil ging so weit mit ihm hinaus, bis er nicht mehr stehen konnte. Dann ließ er den Steuermann treiben, der auch gleich unterging.
Jetzt konnte er seine mühevolle Arbeit fortsetzen, doch kaum hatte er den Strand erreicht, als er Getümmel im Wasser sah. Um die Stelle, an der Antonio versunken war, huschten Schatten hin und her.
„Haie“, sagte er heiser. „Gott sei deiner armen Seele gnädig, Steuermann!“
Bis zum Abend hatte er es immer noch nicht geschafft, die Palme zu fällen, und so gab er es für heute auf. Morgen würde der Stamm stürzen, er schwankte jetzt schon, wenn man an ihm rüttelte.
Doch in dieser Nacht fand Virgil nur wenig Schlaf und warf sich alle Augenblicke unruhig hin und her. Er hatte Angst, denn er sah, wie der Steuermann wieder an den Strand zurückkehrte und dicht am Wasser liegenblieb. Ein Bein und der rechte Arm fehlten.
Auch am nächsten Morgen lag er noch so da, und Virgil verfluchte ihn und die Haie, die es nicht geschafft hatten, ihn draußen zu behalten.
Verbissen nahm er sich wieder den Stamm vor. Der Durst ließ ihn halb wahnsinnig werden, an den nagenden Hunger dachte er nicht mehr. Nur einen Schluck Wasser, einen winzigen nur, so betete er ständig vor sich hin.
Gegen Mittag schrie er vor Freude laut auf. Im Stamm war ein hartes Knakken zu hören, die Palme neigte sich und stürzte dann in den Sand.
Virgil fühlte sich wie neugeboren, als er zu dem großen Wedel rannte und wie ein Irrer, laut kreischend, grüne Kokosnüsse abriß. Er warf sie in die Luft, tanzte herum und lachte, riß immer wieder die Arme hoch und gebärdete sich wie toll.
Mit feierlichem Ernst ging er daran, eins der drei Löcher mit dem Messerstumpf aufzubohren. Dann setzte er die Nuß an die Lippen und trank gierig, schlürfte und schmatzte.
Zu seiner grenzenlosen Enttäuschung gab sie nicht viel her. Es war wirklich nur ein winziger Schluck, nicht einmal ein Mundvoll. Doch er labte ihn, und so zerschlug er die Nuß und fiel gierig über das harte Fleisch her. Die leeren Schalen warf er in den Sand und öffnete die nächste, etwas später die dritte.
Erst nach der vierten Nuß sah er sich ernüchtert um. Jetzt hatte er noch sieben, mehr hatte die Palme nicht getragen.
Wenn er jeden Tag nur eine Nuß aß, konnte er sieben Tage überleben, rechnete er sich aus. Trieb er es aber so wie heute, dann war seine Zeit in zwei Tagen abgelaufen, denn die Nüsse an den beiden anderen Palmen, die noch auf der Insel wuchsen, waren erst winzig klein und noch lange nicht reif. Diese hier schien einen besonders günstigen Standort zu haben.
An einem der nächsten Tage ging die Veränderung mit Antonio rapide voran. Sein Fleisch zerfiel und die Knochen wurden sichtbar. Dieser grausige Anblick veranlaßte Virgil, auf die andere Seite der Insel zu gehen. Begraben konnte er den Steuermann nicht, dazu fehlte ihm jegliches Gerät, und mit den Händen ein Loch in den steinigen Sand zu buddeln, dazu konnte er sich nicht durchringen, denn dann mußte er ihn anfassen.
Seine restlichen drei Kokosnüsse nahm er mit und hütete sie wie einen kostbaren Schatz.
Aus den mittlerweile trockenen Wedeln der Palme hatte er sich im Sand ein Lager bereitet, in das er abends hineinkroch und sich wie ein krankes Tier versteckte.
Er wußte nicht, wie es weitergehen sollte. Noch fühlte er sich einigermaßen wohl, das Fieber hatte sich nicht mehr gemeldet, aber die grelle Sonne ließ seine Haut aufplatzen und überall kleine Wunden entstehen.
Immer wieder achtete er auf Wolken, die Regen versprachen, doch wenn wirklich mal eine am fernen Horizont auftauchte, dann war sie etwas später schon wieder verschwunden.
Wie lange er sich jetzt auf der Insel befand, wußte er nicht mehr. Vielleicht eine Woche? Er hatte jeglichen Zeitbegriff verloren.
Danach ging es ständig mit ihm bergab. Ein paar Tage war er, wie in Trance versunken, auf der Insel herumgelaufen, dann wieder beschäftigte er sich stundenlang mit dem Pulver und der Muskete. Einen Sinn darin sah er nicht, er konnte keine Tiere jagen und die Muskete auch nicht verwenden. Dennoch gab er sich mit einem Eifer der Sache hin, der an Wahnsinn grenzte.
Mitunter verlor Virgil das Bewußtsein, wachte dann irgendwo am Strand wieder auf und begriff nicht, wo er sich befand. Er starrte auf das Gerippe des Steuermanns und sprach mit ihm.
„Wir müssen zurück, Steuermann“, sagte er dann, „die warten bestimmt nicht länger auf uns. Los, steh auf!“
Da Antonio keine Anstalten unternahm, aufzustehen, brüllte und schrie er mit ihm, nannte ihn einen gottlosen Nichtstuer und faulen Lumpenhund, der sich nur ausruhen wollte, ohne an seine Pflicht zu denken.
Wahnsinn befiel ihn. Er sah Schiffe auf dem Meer fahren, sah Seeleute, die ihm zuwinkten, und erblickte große Fässer an Deck, die mit klarem frischen Wasser gefüllt waren. Und als er bittend die Hände ausstreckte und ihm niemand etwas zu trinken gab, nahm er die Muskete und feuerte auf das Schiff.
Danach brach er zusammen.
2.
Der Kapitän der Zweimastgaleone „Tierra“, Jesus Maria de Aragon, blickte seit einer Viertelstunde durch das Spektiv und musterte das lächerlich kleine Eiland, das sich an Backbord befand.
Zu sehen gab es nicht viel. Dicht am Wasser lag eine umgestürzte Palme, ein paar Büsche befanden sich in der Nähe und etwas Dunkles lag in Wassernähe.
Aber sie alle hatten deutlich einen Knall gehört, dessen Ursprung nur von dieser kleinen Insel stammen konnte.
De Aragon gab dem Rudergänger Befehle, und die Galeone, die mit achterlichem Wind auf Südostkurs lief, ging in den Wind und luvte an.
„Es muß jemand auf dieser Insel sein“, sagte De Aragon zu seinem ersten Offizier. „Jeder von uns hat diesen Schuß gehört.“
„Si, Capitan“, erwiderte Lopez, „der Schuß war deutlich zu hören, aber vielleicht war es die Palme am Strand, die umstürzte und diesen Knall vortäuschte.“
De Aragons Lippen wurden zwei schmale Striche.
„Verursachte, wollten Sie sagen, Senor Lopez“, verbesserte der Capitan. „Aber es geht schlecht an, daß eine Palme umstürzt und man den Knall erst sehr viel später hört. Lassen Sie dort vorn Anker werfen. Nehmen Sie das Boot, zwei Männer und rudern Sie hinüber. Ich will wissen, was da vorgeht.“
Lopez nickte, schüttelte aber anschließend sofort den Kopf.
„Wie soll dort jemand überleben, Capitan?“ fragte er leise.
„Das weiß Gott allein, Lopez, deshalb werden wir nachsehen.“
Die Tiefe in Inselnähe ließ sich nicht aussingen, es mußten mehr als hundert Faden sein. De Aragon verzichtete auf das Ankermanöver und ließ die „Tierra“ in den Wind gehen.
Lopez und zwei Männer bestiegen etwas später das Boot und pullten durch mäßig bewegte See dem Inselchen entgegen.
De Aragon lehnte am Schanzkleid des Achterkastells und verfolgte das Geschehen mit dem Spektiv. Die anderen Männer der Crew blickten ebenfalls zu dem Landstrich hinüber.
Der Ausguck wurde gewechselt, der Posten enterte ab und ließ sich beim Capitan melden.
„Es ist möglich, daß ich mich täusche, Senor Capitan“, sagte er, „aber es hat den Anschein, als läge auf der anderen Seite der Insel ein kleines Boot. Man kann über die Insel blikken, aber ein paar Sträucher verdekken die Sicht.“
„Sie sind sich nicht sicher?“
„Nein, deshalb verzichtete ich auf eine Meldung. Wenn es ein Boot ist, dann ist es nicht größer als eine Nußschale.“
„Lopez wird es entdecken“, murmelte der Capitan, „er wird die Insel ganz sicher umrunden.“
Lopez ließ zuerst auf den Strand zuhalten. Die Insel veränderte ihr Gesicht, sobald man näher heranpullte. Anfangs sah sie langgestreckt aus, dann wieder beschrieb sie einen Bogen. Jedenfalls wanderte die umgestürzte Palme aus seinem Blickfeld. Es hatte den Anschein, als wandere sie heimlich davon.
Verblüfft über das Phänomen schüttelte er den Kopf. Die Insel ließ er dabei keine Sekunde aus den Augen.
„Da liegt jemand“, sagte er laut, und die beiden Seeleute wandten die Köpfe, um an Land zu blicken.
„Weiterpullen!“ herrschte Lopez sie an. „Etwas mehr nach Backbord, ihr Strolche!“
Das Boot lief knirschend auf den Strand, und Lopez sprang mit einem Riesensatz in den körnigen Sand.
Zwischen niedrigen Büschen erkannte er eine Gestalt und zuckte zusammen, als er das Gesicht und den Körper sah.
Die beiden Seeleute, die ihm schweigend gefolgt waren, bekreuzigten sich hastig. Breitbeinig blieben sie vor dem ausgemergelten Mann stehen, der sich nicht rührte.
Neben ihm im Sand lag eine Muskete, aus der der kürzlich erfolgte Schuß stammen mußte.
Aber hatte dieser Mann überhaupt noch die Kraft gehabt, eine Muskete abzufeuern? Seinem Zustand nach zu urteilen, war das einfach unmöglich.
Sein Gesicht war eingefallen wie das einer Mumie, die Augen lagen in tiefschwarzen Höhlen, und ein struppiger, mit Sand verklebter Bart bedeckte sein ausgemergeltes Gesicht, von dem Hautfetzen herunterhingen. Der Mann bestand fast nur noch aus Haut und Knochen, überall an seinem Körper waren eitrige Wunden zu sehen.
„Ein Landsmann von uns“, sagte Lopez erschüttert. Er sah es an der zerfetzten Kleidung, die ebenfalls nur noch aus traurigen Resten bestand.
Er bewegte sich nieder, horchte an der Brust des unbekannten Mannes und richtete sich wieder auf, nachdem er schweigend genickt hatte.
„Er lebt noch, wahrscheinlich ist er halb verdurstet und verhungert, und vielleicht kriegen wir ihn nicht mehr durch. Aber der Capitan wird sicher gern seine Geschichte hören. Nehmt ihn vorsichtig auf und bringt ihn ins Boot. Einer bleibt bei ihm, der andere geht mit mir zur Südseite hinüber.“
Unendlich vorsichtig wurde der Bewußtlose aufgehoben und zum Boot getragen, wo sie ihn hinlegten.
Normalerweise hätte Lopez jetzt schnellstens zurückkehren müssen, denn jede Minute zählte für den Unbekannten. Aber er sagte sich, daß es jetzt auch nicht mehr darauf ankäme, denn genausogut hätten sie die Insel ja auch etwas später anlaufen können.
Mit eiligen Schritten lief er voraus, bis er die Insel zur Hälfte umrundet hatte.
Dann sah der Seemann, wie Lopez stehenblieb, als hätte ihn eine unsichtbare Faust getroffen.
Daß dort ein kleines Boot lag, registrierte er fast nur im Unterbewußtsein. Aber er sah den Mann oder vielmehr das, was von ihm noch übrig war, und er schluckte hart.
Vor ihnen im Sand lag ein Gerippe, an dem nur noch ein paar Fetzen ausgedorrtes Fleisch hingen. Reste einer zerfetzten Hose bedeckten die unteren Knochen.
Lopez sagte kein Wort, stumm blickte er auf das Gerippe und wandte sich dann um, um nach dem Boot zu sehen. Dabei fiel sein Blick auch auf die umgestürzte Palme, und er entdeckte die Schalen von zerschlagenen Kokosnüssen.
„Furchtbar“, stammelte der Seemann. „Sie hatten kein Wasser und nichts zu essen. Dann lieber im Kampf fallen.“
„Du sagst es“, murmelte Lopez.
Das Boot war leicht angeschlagen, es zog Wasser, aber es war noch bedingt seetüchtig. Am Heck fand er den Namen und zuckte unwillkürlich zusammen.
„Nuestra Madonna“, stand da in leicht verwaschener Farbe.
„Schnell, zurück an Bord“, sagte er, drehte sich um und lief los. Er achtete nicht darauf, ob der Seemann ihm folgte.
‚Nuestra Madonna‘, dachte er immer wieder, als er in das Beiboot sprang. Der Spanier aus Cadiz war mit ihnen zusammen vor mehr als zwei Jahren losgesegelt. Das letzte Mal hatten sie ihn auf einer der japanischen Inseln getroffen.
Etwas Furchtbares mußte geschehen sein. Vielleicht war der Mann im Boot, der sich jetzt stöhnend bewegte, der einzige Überlebende der ganzen Mannschaft.
Sie pullten sofort los, mit allen Kräften legten sie sich in die Riemen.
Der Unbekannte wurde nach oben gehievt, dann enterte auch Lopez auf, gefolgt von den beiden Seeleuten.
De Aragon blickte aus schmalen Augen auf den halbtoten Mann, dann sah er seinen Ersten an.
„Erzählen Sie!“
„Wir fanden ihn zwischen Büschen, er war es, der die Muskete abgefeuert hat, Capitan. Noch ein Mann befindet sich auf der Insel, aber er ist schon seit einigen Tagen tot. Die beiden stammen von der ‚Nuestra Madonna‘!“
Der Capitan, ein hagerer schlanker Mann von vierzig Jahren, zuckte sichtlich zusammen.
„Von der ‚Nuestra Madonna‘ stammen sie? Woher wissen Sie das?“
„Am Strand liegt ein kleines Beiboot, auf dem der Name steht. Die beiden haben es hoch auf den Sand gezogen, aber es ist leck.“
Inzwischen hatte der Capitan Anweisung gegeben, daß sich der einzige Mann an Bord, der etwas von Medizin verstand, um den Kranken kümmern solle.
Jetzt wurde Virgil in den Schatten gelegt, und man flößte ihm kleine Schlukke Wasser ein.
De Aragon stand mit abwesendem Blick dabei, und versuchte sich in Gedanken auszumalen, was hier passiert sein mochte.
Ein Beiboot mit zwei Männern, die eine Muskete bei sich hatten und hier auf dieser kleinen Insel gelandet waren, mußten nicht unbedingt Meuterer gewesen sein, die man ausgesetzt hatte. Dann hätten sie sicher nicht das Boot behalten dürfen. Außerdem pflegte der Capitan der „Nuestra Madonna“ Meuterer an die höchste Rah des Schiffes hängen zu lassen. Der Capitan war in der Beziehung nicht zimperlich.
Nein, hier hatte sich etwas anderes abgespielt, den Mann umgab ein Rätsel, das De Aragon gern gelöst hätte.
Er blickte wieder in das Gesicht des Mannes, der sich jetzt unruhig hin und her bewegte.
„Wird er es überleben, Miguel?“ fragte der Capitan den Mann, der sich um den Unbekannten kümmerte.
„Er hat hohes Fieber und die Auszehrung. Ich weiß nicht, ob er die nächsten Stunden überleben wird.“
„Sie werden alles tun, damit er überlebt.“
Lopez blickte den Capitan an.
„Anweisung zum Weitersegeln, Capitan?“ fragte er leise.
„Nein. Vorerst noch nicht.“ De Aragon winkte ab. „Wir kreuzen hier und tasten uns dabei an die Insel heran, bis wir Ankergrund haben. Das wäre alles. Lassen Sie die Mannschaft in der Kuhl zusammentreten, Lopez.“
„Si, Senor!“
Lopez wunderte sich, weil er nicht wußte, was der Capitan plante.
Etwas später starrten einundzwanzig Männer stumm auf den Mann im Schatten, der mehr als halbtot war.
De Aragon schritt die Front der Mannschaft ab. Die Hände hatte er auf den Rücken gelegt.
„Seht euch diesen Mann genau an“, befahl er. „Versucht, ihn euch ohne Bart vorzustellen, etwas voller im Gesicht. Hat ihn schon mal jemand gesehen?“
De Aragon wollte sich Gewißheit verschaffen, ob er es hier mit einem Besatzungsmitglied der „Nuestra Madonna“ zu tun hatte oder nicht. War das nicht der Fall, hatte er auch keine Lust, weitere Nachforschungen anzustellen. Kannte ihn aber jemand aus seiner Crew, und das war sogar höchst wahrscheinlich, weil die Kerle ständig zusammengehockt hatten, dann wollte er das Geheimnis um das spanische Schiff lüften, koste es, was es wolle.
Geduldig wartete er ab und drängte keinen, auch wenn sie lange vor dem Mann standen und ihn anblickten.
Andererseits vermochte De Aragon sich nicht vorzustellen, daß es sich um fremde Männer handelte. Wie sollten die wohl zu dem Beiboot gekommen sein?
Ein Mann meldete sich.
„Verzeihung, Senor“, sagte er, „ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte Virgil sein, ein Seemann aus dem Norden Spaniens. José glaubt auch, ihn zu kennen.“
„Vortreten, alle beide!“
Gehorsam traten die beiden Männer heran.
„Hatte dieser Virgil irgendein besonderes Kennzeichen? Habt ihr mal etwas bemerkt? Seht ihn euch genau an, ich will wissen, was hier vorgefallen ist.“
„Virgil hatte die Ohrläppchen durchstochen, Senor Capitan. Ein Feldscher hat ihm gesagt, daß er dann besser hören würde, er war auf einem Ohr fast taub.“
„Seht nach, ob das stimmt!“
Der eine kniete sich hin, schob die langen strähnigen Haare zur Seite und nickte sofort. Als er auch das andere Ohr durchstochen fand, richtete er sich auf.
„Er ist es, kein Zweifel, Senor Capitan.“
„Du bist deiner Sache sicher?“
„Ganz sicher, ich weiß es.“
In diesem Augenblick schlug der Mann die Augen auf. Sie waren seltsam klar, aber es hatte den Anschein, als sähe er nichts, denn sein Blick ging durch die Männer, die ihn schweigend umstanden, hindurch in unbekannte Fernen.
Mühsam verzog er die Lippen, bis seine schwärzlichen Zahnstummel sichtbar wurden.
„Schnell weg, Steuermann“, sagte er klar und deutlich, „sonst töten sie uns.“ Sein Mund verzerrte sich noch mehr. „Wasser“, hauchte er, „die anderen geben mir keins.“
Sie flößten ihm wieder Wasser ein, vorsichtig, in kleinen Schlucken.
Dieser Virgil scheint ein unglaublich zäher Bursche zu sein, dachte der Capitan. Er sah aus, als wäre er schon vor ein paar Tagen gestorben, aber seine Stimme klang unwahrscheinlich klar. Er stammelte auch nicht, aber nachdem er getrunken hatte, fiel er wieder in sich zusammen und blieb erschöpft liegen.
„Bringt ihn nach achtern in meine Kammer“, befahl De Aragon. „Du bleibst bei ihm, und wenn er noch etwas getrunken hat, flößt du ihm Brühe ein, aber nicht zuviel, damit er sich nicht übergibt.“
Während Virgil nach achtern gebracht wurde, studierte De Aragon zusammen mit dem ersten Offizier die Seekarten.
„Irgendwo hier, ganz in der Nähe vielleicht, muß etwas Schreckliches mit dem Schiff passiert sein“, sagte De Aragon. „Vermutlich ist das Schiff von Wilden angegriffen worden, oder Piraten haben es überfallen.“
Er fuhr mit dem Finger die Karte entlang.
„Das hier ist die Insel Kalimantan1), eine sehr große und völlig unerforschte Insel, die die ‚Nuestra Madonna‘ auf südwestlichem Kurs passiert hat. Den Karten nach gibt es hier ein gigantisches Inselreich, und deshalb werden wir an der Küste entlangsegeln, bis wir zwischen diesen beiden Inseln hier den Weg in den Indischen Ozean gefunden haben. Ich werde damit aber warten, bis dieser Mann zu Kräften kommt, damit er uns die Geschichte erzählen kann. Ich möchte laufend über seinen Zustand unterrichtet werden, Lopez.“