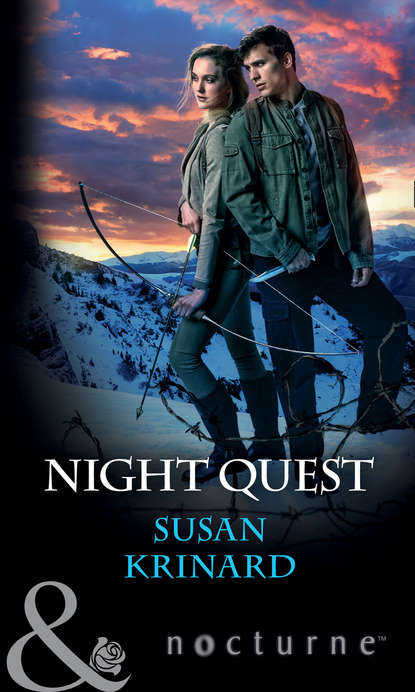Seewölfe Paket 29

- -
- 100%
- +
Als sie ihn einmal losließen, schrie er leise auf und sackte in sich zusammen.
Sie schleppten ihn fort, bis er das Tageslicht sah. Draußen wartete ein Karren, vor den ein Muli gespannt war. Sie warfen ihn auf den Karren und lachten roh.
Die Reise ging nach Yedikule an der südlichen Westmauer, wo die Häuser am Hang standen und sich weiter oben die Festung mit den Kanonen befand. Dort wurden auch die Verbrecher hingerichtet. Es war der „Platz der tausend Ängste“, wie die Türken ihn nannten.
Als sie in der Festung anlangten, zerrten sie Ali Mustafa von dem Eselskarren und stießen ihn auf den Platz, wo die Soldaten standen, die Ali unbeteiligt musterten.
Einer seiner Wächter ging auf einen breitschultrigen Mann zu, der einen roten Fez auf dem Kopf trug.
„Das ist Ali Mustafa Hayri. Die drei Kadis haben ihn zum Tode verurteilt. Er soll nach dem vierten Gebet vor die Kanone gebunden werden. Die Anklage lautet …“
„Ich weiß“, sagte der Hauptmann. „Er ist ein Verräter, ein Spion und ein Zauberer. Er hat den Kadi verflucht. Es wird dem Henker ein besonderes Vergnügen sein, ihn zu richten.“
Ali Mustafa sah die große Kanone, deren Mündung direkt auf das Wasser zeigte. Unter der Festung segelte gerade eine Sambuke vorbei.
„Das vierte Gebet beginnt gleich“, sagte der Hauptmann. „Bindet ihn vor die Kanone. Ein Hundesohn wie er hat kein Recht mehr auf ein letztes Gebet.“
Derbe Fäuste griffen zu und stießen Ali in Richtung der Kanone. Er sah den riesigen Schlund, diese gewaltige Mündung, und schluckte hart.
Die Kugel befand sich schon in dem Rohr, nur das Pulver wurde noch eingefüllt. Sie nahmen ziemlich viel, wie er entsetzt feststellte.
Gleich darauf erschien ein hünenhafter Kerl, der auf seinem riesigen Schädel einen lächerlich kleinen Fez trug. Der Kerl richtete den Blick drohend auf ihn und musterte ihn von oben bis unten, als wollte er berechnen, in wie viele Stücke Ali wohl fliegen würde, sobald die Kanone abgefeuert war.
Ali Mustafa hatte diesen riesigen Fleischberg schon einmal gesehen und wußte, daß es der Henker Omar war, ein Kerl, der fast tagtäglich Hinrichtungen in Istanbul und Umgebung vornahm.
Ali nahm einen schon widerlichen Geruch nach Knoblauch wahr, als der Henker sich ihm näherte. Seine riesigen Hände packten zu und hielten Ali unbarmherzig in einem mörderischen Griff fest. Mit wenigen Handgriffen band ihn der Henker an das Kanonenrohr. Alis Füße berührten gerade noch den Boden. Die Arme hatte er wie in einer liebevollen Umarmung um das Rohr geschlungen.
In diesem Augenblick rief der Muezzin. Es war das vierte Gebet, und es klang anfangs dünn und kehlig vom Minarett, und es dauerte auch sehr lange, als wolle der Muezzin die Hinrichtung hinausschieben.
Ali wußte, daß er sich das alles nur einbildete. Er hatte nicht mehr das richtige Gefühl für die Gegenwart und mit dem Leben schon fast abgeschlossen.
Dennoch sah er jetzt alles überdeutlich und von einer eindringlichen Klarheit. Er sah die Mauern der Festung, den großen Turm und auf der Zinne des Turmes einen dunkelgrauen Vogel, der sich mit aufreizender Langsamkeit das Gefieder putzte.
Du hast es gut, dachte er. Dir stellt keiner nach, dich klagt keiner fälschlicherweise an, und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann fliegst du einfach auf und davon.
Der Vogel verschwand, als der Muezzin das vierte Gebet beendet hatte, und flog davon.
Der Henker, die Soldaten und der Hauptmann erhoben sich und warfen einen Blick zum Himmel.
Ali wurde nicht gefragt, ob er noch etwas zu sagen hatte. Das war hier nicht üblich. Von nun an ging alles sehr schnell.
Dem Henker wurde ein kupfernes Gefäß gereicht, in dem Holzkohle glühte. Er stellte es neben sich auf den Boden und griff zu der Zündlunte, die wie ein langer dünner Stock aussah. Mit einem kritischen Blick überprüfte er noch einmal das Zündpulver, das sich im Zündloch der Kanone befand. Den anderen bedeutete er mit einem Handzeichen, daß sie zurücktreten sollten, wenn die Kanone durch den harten Rückstoß zurückpolterte.
Dann sah er Ali höhnisch in die Augen, nahm den Luntenstock, stieß ihn in die Glut und hob ihn hoch.
Er trat ein wenig zur Seite und senkte das glutende Ende auf das Zündloch.
Ali Mustafa wurde es schwarz vor den Augen, als er das leise feine Knistern hörte. Alle seine Haare richteten sich in diesem fürchterlichen Augenblick auf, und sein Körper wurde taub und gefühllos.
Er hielt die Augen geschlossen. Jeden Augenblick würde es seinen Körper zerfetzen. Er wollte schreien, irgend etwas tun, doch er konnte sich nicht bewegen.
Jetzt! Das Zischen wurde zu einem Fauchen. Gleichzeitig pfiff und knisterte es immer lauter.
Wahnsinnige panische Angst erfaßte ihn. Er hatte schon oft dabeigestanden, wenn eine Kanone abgefeuert wurde, aber dieses grelle zischende Geräusch kannte er nicht und hatte es auch noch nie gehört. Es hatte immer ganz anders geklungen.
Mit aller Gewalt riß er die Augen auf.
Aus dem Zündloch stach eine helle blitzende Flamme, die explosionsartig hinausschoß. Er glaubte auch zu sehen, daß sich in dem Kanonenrohr ein Riß gebildet hatte. Fassungslos und unfähig, sich zu bewegen, sah er zu, wie diese grelle beißende Flamme nach dem Henker schlug und ihm ins Gesicht raste.
Der grobschlächtige Mann stieß einen gellenden, wilden Schrei aus, der bis zum Hafen zu hören sein mußte. Voller Angst und Entsetzen schlug er die Hände vor das Gesicht, aber es war schon zu spät. Die gewaltige Stichflamme hatte sein Gesicht innerhalb kürzester Zeit pechschwarz verfärbt.
Der Henker sah nichts mehr. Immer noch brüllend vor Schmerz, raste er in blinder Panik davon und rannte gegen die Mauer, die seinen Aufprall hart stoppte. Dann fiel er auf den Rücken, wälzte sich auf dem Boden und schrie immer noch wie ein Tier.
Ali Mustafa verstand die Welt nicht mehr. Aus der Kanone schoß nahe beim Zündloch immer noch grelles Feuer heraus. Eine gewaltige Feuerzunge leckte nach allen Seiten. Dazu zischte, fauchte und brauste es.
Der Hauptmann und seine Soldaten rannten blindlings davon und verschwanden durch das Tor, das nach unten zur Treppe führte. Nur ein Mann duckte sich in seiner Angst verstört vor der Mauer, hatte die Arme vor das Gesicht geschlagen und drehte der Kanone den Rücken zu.
Der Schuß aus der Kanone löste sich nicht mehr. Die Pulverladung wurde als riesige Stichflamme durch Zündloch und Riß hinausgeblasen und verlor an Wirkung und Intensität.
Das Rohr glühte jetzt stark, und der Geruch nach verbranntem Metall drang Ali in die Nase. Hinzu gesellte sich noch ein beißender, übelriechender Qualm, der träge aus dem Rohr quoll und ihn einnebelte.
Immer noch verständnislos blickte Ali Mustafa auf das Kanonenrohr. Dann fiel sein Blick auf den Henker, der sich am Boden wand und die Seele aus dem Leib schrie.
Mit den Händen hielt er weiterhin sein entstelltes und verbranntes Gesicht bedeckt, seine säulenförmigen Beine trommelten wie irr auf dem Boden herum.
Der Mann, der an der Mauer kniete, drehte sich vorsichtig um und konnte nicht glauben, was er sah. Da hing Ali Mustafa immer noch vor dem Kanonenrohr, und ihm war nichts passiert, gar nichts. Er hatte nur zähen Pulverqualm einatmen müssen.
Der Soldat erhob sich und schlich furchtsam näher. Das Rohr blickte er dabei mißtrauisch an, und auch Ali warf er einen ungläubigen Blick zu. Dem tobenden Henker näherte er sich allerdings nicht, sondern betrachtete ihn nur verstört.
Nach und nach erschienen der Hauptmann, die Soldaten und die drei Wächter, die Ali hergebracht hatten. Alle waren starr vor Staunen und blickten immer wieder zu der Kanone.
Der Hauptmann war am meisten betroffen. Kopfschüttelnd sah er Ali Mustafa an. Um den Henker kümmerte er sich ebenfalls nicht. Er warf ihm nur einen schnellen Blick zu.
„Ein Wunder ist geschehen, bei Allah!“ rief er bestürzt. „Allah will nicht, daß er den Tod findet.“
„Dann müssen wir ihn losbinden“, flüsterte einer der Männer. „Nach den Gesetzen des heiligen Korans darf er nicht ein zweites Mal mit dem Tode bestraft werden.“
„Dann bindet ihn los“, sagte der Hauptmann. Er schien Angst vor Ali zu haben, denn der schien über die Schwarze Kunst zu verfügen. Wie anders war sonst zu erklären, daß ihm nichts passiert war? Allah hatte schützend seine Hand über ihn gehalten, oder er war ganz einfach ein Scheitan, der sich der dunklen Mächte bediente.
Als sie Ali nur sehr zögernd losbanden, zitterte er am ganzen Körper und sackte langsam in die Knie. Jetzt erst überlief es ihn abwechselnd heiß und kalt. Er sah seine Umwelt nur noch wie durch einen dichten Schleier und hörte kaum die Worte, die gesprochen wurden.
„Was ist mit Omar, dem Henker?“ fragte der Hauptmann. „Seht mal nach, was mit ihm passiert ist.“
Der Henker war für die meisten Männer so unheimlich wie Ali Mustafa, der seinen sicheren Tod überlebt hatte. Aber dieser Henker schlug um sich und brüllte so laut, daß sich keiner an ihn herantraute. Seine Beine strampelten jetzt in der Luft herum. Er sah aus wie ein riesiger auf den Rücken gefallener Käfer, der sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben konnte.
Einer brachte einen Eimer Wasser und leerte ihn über seinem Kopf aus. Das schien die furchtbaren Schmerzen ein wenig zu lindern, denn das nervtötende Gebrüll ließ etwas nach. Dafür verlangte der Henker mit heiserer Stimme nach noch mehr Wasser.
Sie brachten es, bis er sich langsam beruhigte. Dann halfen ihm zwei Männer auf die Beine und fuhren entsetzt zurück, als sie sein Gesicht sahen.
Das war nur noch eine schwarze verkohlte Scheibe, in der blutrote Lippen zu erkennen waren. Die Augen waren verbrannt und verklebt. Er wischte mit seinen ungeschlachten Händen ständig daran herum.
„Ich bin blind!“ schrie er immer wieder. „Allah hat mir mein Augenlicht genommen, als ich den Hundesohn hinrichtete! Was ist denn nur geschehen?“
Der Hauptmann erklärte es ihm.
„Der Schuß ist nicht losgegangen. Beinahe wäre die Kanone explodiert. Ali Mustafa ist nichts passiert, du hast ihn nicht gerichtet.“
„Dafür hat Allah mich gerichtet“, jammerte der Henker. „Dieser Hundesohn von einem Ali Mustafa hat mich verflucht, genau wie er die Kadis verflucht hat. Wo ist dieser räudige Sohn einer verfluchten Wanderhure? Ich bringe ihn eigenhändig um, diesen Bastard!“
„Du wirst niemanden mehr umbringen, Omar“, sagte der Hauptmann kühl. „Dem Gesetz nach darf Ali nicht mehr getötet werden, so steht es geschrieben, und so werden wir es halten.“
„Aber er muß bestraft werden, man kann ihn nicht freilassen. Er ist schuld daran, daß ich jetzt für alle Zeiten blind bin.“
Der Hauptmann schien mit dem Henker nicht gut auszukommen. Er mochte ihn nicht, auch die anderen mochten ihn nicht.
„Ob er daran schuld ist oder nicht, hat nichts mit dir persönlich zu tun. Wir werden noch einmal bei dem Kadi nachfragen. Der wird dann entscheiden, was zu geschehen hat.“
Der Henker wimmerte und begann zu laut zu klagen und zu lamentieren. Nicht nur, daß er erblindet war – auch sein Oberkörper wies schwere Brandwunden auf. Ein Teil seines Hemdes hatte sich ins Fleisch gebrannt.
Der Hauptmann schickte einen Mann los, der den Kadi befragen sollte. Gleichzeitig ließ er einen Arzt holen, der den Henker versorgen und seine Schmerzen lindern sollte.
„Du wirst solange auf der Festung eingesperrt, Ali Mustafa, bis der Kadi über dein weiteres Schicksal entschieden hat“, sagte der Hauptmann. „Aber freue dich nicht zu früh, man wird dich trotzdem gebührend bestrafen.“
Ali Mustafa gab keine Antwort. Ihm war alles gleichgültig. Er empfand weder Freude noch Genugtuung, er empfand überhaupt nichts. Er war dem Tod so nahe gewesen, daß er immer noch nicht glaubte, was er sah und erlebte.
Zwei Männer trugen Ali in das Verlies, weil er nicht laufen oder gehen konnte. Aber diesmal behandelten sie ihn etwas besser, und er erhielt auch etwas zu essen und zu trinken.
Dann mußte er warten.
Er wartete genau drei Stunden, dann war der Mann wieder zurück und hatte ein Schreiben des Kadi mitgebracht.
Der Hauptmann las es und ging persönlich zu Ali Mustafa.
„Der Kadi will dich nicht persönlich sehen“, sagte er. „Aber da du offenbar über geheime Kräfte verfügst, hat er dich begnadigt, damit du diese Kräfte woanders einsetzen kannst. Hier ist das Urteil. Du wirst den Rest deines Lebens auf der großen Galeere verbringen – das heißt lebenslänglich.“
„Galeere?“ fragte Ali leise.
„Ja, als Ruderer, und wenn du sehr fleißig bist, kannst du dich eines Tages bis zum Schlagmann hocharbeiten. Das ist ein sehr ehrenhafter Beruf.“
„Ich kann nicht einmal stehen“, sagte Ali.
„Das ist auch nicht nötig. Auf den Galeeren ist es bequem und gemütlich. Da dürfen alle sitzen, solange sie wollen.“
Der Hauptmann warf Ali noch einen nachdenklichen Blick zu. Dann ging er wortlos hinaus.
Ali Mustafa war mit seinem Kummer allein.
6.
Die Galeere war das größte Schiff der Türken in Istanbul.
Genaugenommen war sie eine Dromone, wie Türken, Griechen und Araber sie bezeichneten. Aber der Ausdruck Galeere hatte sich längst eingebürgert und blieb erhalten.
Sie hatte zwei große Decks für die Ruderer. Das eine befand sich oben und war bei Wind und Wetter ungeschützt. Das andere lag etwas tiefer darunter, nur ein wenig höher als die Wasseroberfläche.
Vorn am Bug trug dieses riesige schwimmende Monstrum einen gewaltigen eisenbeschlagenen Rammsporn in der Form eines fürchterlich häßlichen Schädels mit finsteren und unheilvoll blickenden Augen.
Auf dem Vordeck befand sich ein riesiger Holzwurm, gleich daneben gab es auf jeder Seite große Armbrüste und lange Rohre, aus denen man „Griechisches Feuer“ schleudern konnte. Ein ausgeklügelter Mechanismus sorgte dafür, daß das „Griechische Feuer“ bei widrigen Verhältnissen nicht auf das eigene Deck fiel.
Auf dem Oberdeck konnte auch stehend gerudert werden. Das war dann der Fall, wenn höchste Eile geboten war. Da gab es einen langen Mittelgang, von dem rechts und links in fast endloser Reihe Ruderbänke abzweigten. Bis zu vier Männer saßen jeweils auf diesen Bänken und waren angekettet.
Die Galeere war ein Dreimaster, der außerdem gesegelt werden konnte. Das Ruderdeck war übersichtlich und endete abrupt. Dort folgte ein erhöhtes Deck, auf dem wiederum Riesenarmbrüste und lange Rohre montiert waren. Von diesem Deck ging es weiter zum überdachten Heck, wo eine stabile Holzhütte stand.
Etwa zweihundertvierzig Ruderer hatten auf der Galeere Platz. Dazu kam noch einmal eine Besatzung von mehr als vierzig Leuten.
Einer dieser Ruderer war Ali Mustafa. Er befand sich jetzt seit acht Tagen auf der Galeere.
Direkt neben ihm hockte – klein, verbittert und verkrümmt, ein Türke, der nicht älter war als er selbst. Der Mann hieß Ahmed, und sie hatten sich in den paar Tagen angefreundet, wenn man das so nennen wollte. Dabei war es aber meist nur bei ein paar Worten geblieben, denn wen der peitschenschwingende Aufseher bei einer Unterhaltung erwischte, dem zog er unbarmherzig eins über.
Tam – Tam! Tam – Tam!
Die Schläge dröhnten durch das untere Deck, das von stickiger Luft erfüllt war. Jeder Hieb auf die Trommel erzeugte eine dumpfe Resonanz im Schädel. Mitunter veränderte sich der Rhythmus, dann wurde die Trommel schneller geschlagen, und damit begann das Martyrium.
Die Männer schwitzten, keuchten oder stöhnten. Sie verkrallten sich in diesen gewaltigen Riemen, hatten beide Hände um die großen Holzschäfte gelegt und zerrten wie wild daran. Dabei blieb es auch nicht aus, daß die „Neuen“ öfter mal aus dem Takt gerieten, weil sie sich noch nicht an den Rhythmus der Trommelschläge gewöhnt hatten.
Sie versuchten zwar, den Peitschenschwinger nicht herauszufordern, doch das gelang nicht immer, und so wurde wieder die Peitsche hart eingesetzt.
Manchmal hatten Ali Mustafa und Ahmed nicht die geringste Ahnung, wo sie sich befanden, denn im unteren Deck herrschte ein diffuses Zwielicht, in dem nur die gekrümmten Rücken der anderen Ruderer zu erkennen waren, oder der Schlagmann, der vor seiner gongähnlichen Trommel hockte und den Takt schlug, mit dem die Riemen durchs Wasser gezogen werden sollten.
Hin und wieder beneideten sie die Ruderer auf dem oberen Deck, denn die konnten wenigstens noch etwas sehen. Dafür waren sie jedem Wetter ausgesetzt und konnten sich weder gegen große Hitze noch gegen prasselnden Regen schützen.
Seit sie auf der Galeere waren, bewegte sie nur noch der Gedanke an Flucht.
„Es geht nicht“, sagte Ahmed entsagungsvoll. „Glaube mir, schon viele haben es versucht, aber bisher ist es niemandem gelungen. Wie willst du die Ketten loswerden? Sie laufen am Gang durch die eisernen Ringe und sind an deinem Bein befestigt, angeschmiedet. Ich habe es auch schon oft überlegt, aber es gibt keine Möglichkeit.“
„Vielleicht fällt mir ein Ausweg ein. Man müßte es dann versuchen, wenn die Ruderer ausgewechselt werden oder wir im Hafen liegen.“
„An Deck sind überall Wachen, die passen auf.“
„Auch Wachen werden mal nachlässig oder unaufmerksam.“
„Schön wäre es“, seufzte Ahmed. „Ich warte ja auch nur auf eine solche Gelegenheit. Ich bin unschuldig, so wie viele andere hier auch. Die Bastarde haben mich verleumdet, mir mein Haus weggenommen und mich auf die Galeere geschickt. Ich glaube, daß die Kadis dahinterstecken, die sich bereichern wollen.“
Während sie leise miteinander flüsterten, bewegten sie die Riemen.
„Vielleicht gibt es eine Möglichkeit“, deutete Ali an. Er wollte gerade weitersprechen, als ihn ein schmerzhafter Hieb ins Kreuz traf.
Der Zuchtmeister war lautlos aufgetaucht und schlug zu.
Auf Alis Rücken platzte die Haut auf. Er biß sich vor Schmerz auf die Zunge.
„Bastarde!“ schrie der Zuchtmeister. „Ihr sollt pullen, nicht quatschen! Ihr seid nicht zur Erholung hier! Und du nimm dich ganz besonders in acht, Ali Mustafa!“
Der Kerl schlug noch einmal von der Seite her mit der Peitsche zu. Die Schnüre wickelten sich um Alis Hals. Er ließ den schweren Riemen los und griff mit beiden Händen an die Stelle.
Der Zuchtmeister lachte höhnisch.
„Kein Wasser und kein Essen heute“, sagte er. „Weiterpullen und kräftiger durchziehen, sonst blüht dir morgen das gleiche. Ich werde dich besonders scharf im Auge behalten.“
Ali Mustafa warf seinem Peiniger einen haßerfüllten Blick zu. In seinen Augen standen Tränen der hilflosen Wut, des Schmerzes und der Enttäuschung.
„Einmal komme ich hier heraus“, flüsterte er so leise, daß es nicht einmal Ahmed hörte. „Und dann kannst du verdammter Hundesohn etwas erleben.“
„Hör auf zu flüstern“, zischte Ahmed aus dem Mundwinkel. „Der Kerl beobachtet dich und wartet nur auf eine Gelegenheit, dir eins überzuziehen.“
Ali Mustafa sagte vorerst nichts mehr. Aber in seinen Augen brannte es wie Feuer. Er hätte das alles ja noch hingenommen, wenn er wirklich schuldig gewesen wäre. Aber das war nicht der Fall. Auch bei Ahmed war es so. Er hatte keinem etwas getan, er war nur einigen Männern im Weg gewesen, die sich auf seine Kosten bereichern wollten.
Tam – Tam! Der Rhythmus der Trommelschläge steigerte sich. Die Galeere beschrieb einen Bogen und steuerte ein Ziel an, das im Unterdeck niemand kannte.
Auch diese ständige Ungewißheit zerrte an den Nerven.
Philip Hasard Killigrew, Dan O’Flynn und der Spanier Don Juan de Alcazar hatten ebenfalls eine Exkursion durch Istanbul unternommen. Jung Hasard begleitete die Männer und fungierte wieder als Dolmetscher, der auch hervorragend die Kunst des Feilschens beherrschte und selbst den ausgekochten Händlern mitunter mächtig auf die Nerven ging.
Sie sahen sich alles an – die Bärenführer, die Geigen- und Bratschenspieler, die an allen öffentlichen Plätzen zu finden waren, und auch die Bärenführer, die mit ihren Tieren Kunststücke vollführten.
Sie gingen durch die malerische Altstadt, wo die Häuser uralt und wie hingeduckt standen. Hier gab es ungeahnte Einkaufsmöglichkeiten.
„Ich bedauere schon heute den Tag, an dem wir Istanbul wieder verlassen“, sagte Don Juan. „Es gefällt mir hier ausnehmend gut.“
„Ein paar Tage bleiben wir noch“, sagte Hasard. „Bevor wir weitersegeln, müssen wir uns ja auch noch mit Proviant und frischem Trinkwasser eindecken, weil wir immer noch nicht wissen, wo wir denn eigentlich genau herauskommen.“
Daß es den Weg vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer gab, war ihnen mittlerweile bekannt. Das hatten sie in Erfahrung gebracht. Der weitere Kurs würde nach Griechenland führen, das wußten sie auch, aber es fehlten eben noch ein paar Einzelheiten.
Sie schlenderten durch eine Gasse, in der es intensiv nach Gewürzen aller Art duftete. Der Geruch war fast betäubend und wirkte einschläfernd auf die Sinne.
Die Händler hockten vor ihren Buden oder Ständen und dösten im Sonnenschein vor sich hin. Hin und wieder trabte ein Muli mit seinem Herrn auf dem Rücken vorbei.
Das Hämmern der Silber- oder Kupferschmiede war zu hören. Manche Händler fuhren aus ihrem leichten Schlummer hoch, wenn die vier „Efendis“ vorbeimarschierten. Dann priesen sie lautstark ihre Waren an und überboten sich gegenseitig mit ihrem Geschrei.
Jung Hasard blieb vor einem winzigen Laden stehen. Der Laden war nur eine Bretterbude ohne Fenster.
„Hier gibt es Bücher, Dad, Sir“, sagte er. „Richtige dicke Schwarten und Folianten. Vielleicht finden wir hier auch Karten. Wollen wir uns einmal umsehen?“
„Warum nicht? Wir sind ohnehin auf der Suche nach Karten. Möglicherweise kann der Mann uns weiterhelfen.“
Der Türke, ein älterer Mann mit grauen Haaren und grauem Bart, begann sogleich zu dienern.
„Aladin hat alles, was Sie sich wünschen, Efendis“, radebrechte er zum Erstaunen der Arwenacks.
„Aladin?“ Hasard sah den Alten fragend an. „Aladin hört sich arabisch an.“
„Ich stamme aus Al Iskandariyah, Efendi. Aladin ist ein alter Seemann, viel in der Welt herumgekommen. Aladin versteht viele Sprachen.“
Der Alte wirkte verschmitzt, aber nicht schlitzohrig. Er bewies auch gleich, daß er Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch verstand und auch ganz leidlich sprechen konnte. Er war sogar einer der wenigen, die von England eine Vorstellung hatten, obwohl er noch nicht dagewesen war. Die meisten anderen, auf die sie getroffen waren, hatten nicht einmal gewußt, wo das lag.
Aladin klatschte in die Hände. Daraufhin erschien ein kleines Kerlchen mit einem Hemd, das bis auf den Boden reichte.
Aladin orderte Tee, und das Kerlchen verschwand wieder.
„Wir wollten uns ein wenig umsehen“, sagte Hasard. „Vielleicht finden wir brauchbares Kartenmaterial oder ein paar interessante Bücher. Wir haben nämlich einen sehr belesenen Mann an Bord.“
Die Idee, dem Kutscher eine Freude zu bereiten und ihm ein paar Bücher zu schenken, war Hasard sofort gekommen, als er sich in dem Laden einmal flüchtig umgeblickt hatte.
Aladin begann zu palavern und ließ winzige Teetassen an die Arwenacks verteilen. Das Kerlchen schenkte einen duftenden, sehr aromatischen Tee ein.
„Ich glaube, ich kann Ihnen helfen, Kapitän. Ich kaufe von den Schiffen aus aller Welt immer interessante Sachen auf, die ich dann weiterverkaufe. Ich habe sogar Papageien und zwei kleine Affen. Sie können auch chinesisches Porzellan haben. Ich werde Ihnen alles zeigen, was Sie wünschen.“
Zuerst aber wurde geplaudert, wie das üblich war. Aladin erzählte von seiner früheren Zeit, als er noch die Meere befahren hatte. Vor ein paar Jahren hatte er sich dann in Istanbul zur Ruhe gesetzt. Er hatte ein gutes Auskommen und war mit sich und der Welt zufrieden.
Hasard erzählte ihm in kurzen Sätzen, welchen Weg sie in letzter Zeit zurückgelegt hatten und was ihnen widerfahren war.
„Jetzt wollen wir ins Mittelmeer“, schloß er. „Nach dem Weg haben wir im Schwarzen Meer lange gesucht, wir wissen auch, daß es ihn gibt, nur liegt unser genauer Kurs noch nicht fest.“
Bei Aladin trafen sie endlich auf einen belesenen, erfahrenen und weltoffenen Mann, der wirklich viel gesehen hatte und sich auch hervorragend auskannte.