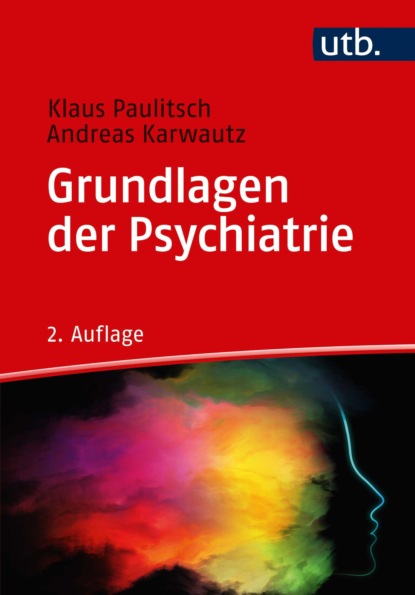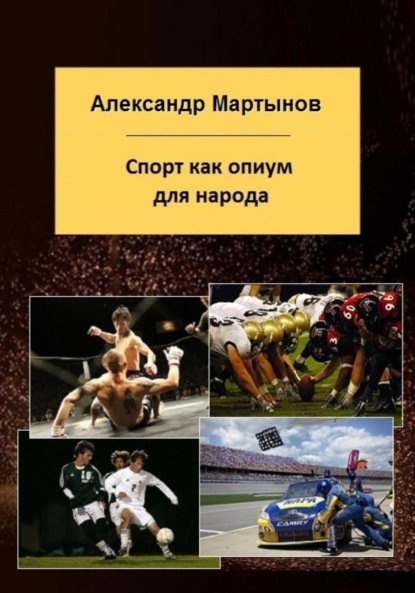- -
- 100%
- +
1.3.1Deutschland
Eine Expertenkommission des deutschen Bundestags erarbeitete 1975 Vorschläge zu einer Umstrukturierung der psychiatrischen Versorgungssituation („Psychiatrie-Enquete“). Zunächst wurde ein Modellprogramm erprobt, anschließend wurden gemeindenahe Versorgungsnetze in die psychiatrische Routinebehandlung integriert. Ambulante und teilstationäre Einrichtungen wurden geschaffen, und die Zahl der belegten Betten in psychiatrischen Anstalten konnte wie in allen anderen europäischen Ländern reduziert werden. Nach der Wiedervereinigung wurde neuerlich eine Kommission der Bundesregierung einberufen, um die psychiatrische Versorgung in den Gebieten der ehemaligen DDR den alten Bundesländern anzugleichen.
1.3.2Schweiz
Auch in der Schweiz richtete man sich in den 70er-Jahren durch Schaffung von Versorgungsregionen, Förderung von alternativen ambulanten Einrichtungen und Errichtung von rehabilitativen Einrichtungen nach den damaligen Grundsätzen der psychiatrischen Gesundheitsversorgung. Die psychiatrische Versorgung ist kantonal geregelt. Einzelne Kantone haben eigene Konzepte entwickelt.
1.3.3Italien
Italien unternahm durch das „Triestiner Gesetz Nr. 180“ im Jahr 1978 eine Abschaffung aller psychiatrischer Kliniken. Nur wenige akutpsychiatrische Betten in Allgemeinspitälern blieben übrig. Dieser radikalste und nicht unumstrittene Reformschritt führte zur Überbelegung von privaten Kliniken und den wenigen akutpsychiatrischen Betten. Dass ausgerechnet in Italien die Auflösung der Großanstalten so drastisch vorangetrieben wurde, geht auf den Italiener Franco Basaglia und seine revolutionären antipsychiatrischen Thesen zurück. Sein utopisches Ziel war es, der Ausgrenzung von Randgruppen ein Ende zu setzen. Die psychiatrische Institution war nach Basaglia ein staatliches Instrument, um gesellschaftskritische Menschen zu internieren und sollte keine Berechtigung im gesundheitspolitischen Bereich haben.
2Psychiatrische Einrichtungen
2.1Vollstationäre Einrichtungen
2.1.1Psychiatrische Abteilungen mit Vollversorgungsauftrag
Eine psychiatrische Abteilung mit vierzig bis achtzig Betten soll einer Region mit etwa 150.000 bis 250.000 Einwohnern zur Verfügung stehen und neben einer akutpsychiatrischen Station auch eine Abteilung für gerontopsychiatrische PatientInnen (Alterspsychiatrie) besitzen. Durch die im Vergleich zu früheren Zeiten geringere Zahl an psychiatrischen Betten hat sich auch die durchschnittliche Belegdauer stark verringert. PatientInnen werden heute bereits nach kurzer Zeit entlassen, dafür aber auch häufiger wieder aufgenommen. Der Begriff „Drehtürpsychiatrie“ charakterisiert die zahlreichen Aufnahmen von chronisch Kranken während eines kurzen Zeitraums. Eine psychiatrische Abteilung mit einem Vollversorgungsauftrag für eine Region dient vorwiegend PatientInnen in einer akuten psychischen Krise wie beispielsweise bei Suizidalität, bei akut psychotischen Symptomen oder Erregungszuständen.
Ausgestattet sind moderne psychiatrische Abteilungen mit Ein- bis Vierbettzimmern, Aufenthaltsräumen, Räumlichkeiten für Ergo- und Physiotherapie, Gruppenräumen, Besprechungszimmern und Bereichen für medizinische Untersuchungen und Interventionen. Anders als auf somatischen Abteilungen sollten Krankenzimmer gleichfalls Wohncharakter haben. Beschränkungsmöglichkeiten, wie etwa Gurtenbetten, sollen für akut selbst- oder fremdgefährliche PatientInnen rasch mobilisierbar sein und stellen eine wesentliche Anforderung dar. Ebenso wichtig ist ein sogenanntes Intensivzimmer („weiches Zimmer“), wenn erregte PatientInnen sich gefährlich verhalten und eine Reizabschirmung benötigen. Die Ausstattung soll an die Erfordernisse angepasst sein und der ständige Kontakt zu BetreuerInnen und Pflegepersonal muss klarerweise gegeben sein.
Neben der Strukturveränderung einer psychiatrischen Abteilung hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte auch ein Mentalitätswandel in den therapeutischen Teams vollzogen. Dominierten früher zahlenmäßig Pflegepersonen und ÄrztInnen in den Stationen, so sind eine Reihe weiterer Berufsgruppen, wie ErgotherapeutInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, MusiktherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen oder SozialarbeiterInnen hinzugekommen, die im therapeutischen Prozess wichtige Funktionen besitzen. Ein großer Teil der Arbeitszeit wird für Teambesprechungen verwendet, wobei gute Kommunikations- und Konfliktfähigkeit des Personals wichtige Anforderungen darstellen. Obwohl jede Berufsgruppe ihren eigenen Kompetenzbereich hat, herrscht im psychiatrischen Krankenhaus im Allgemeinen eine „flachere“ Hierarchie, als sie sonst im Spitalsbereich üblich ist. Die frühere Überwachungspsychiatrie mit ihrem Disziplinierungssystem ist zu einem System therapeutischer Partnerschaft geworden und soll die aktive Zusammenarbeit fördern.
2.1.2Spezialabteilungen
Wenn längere Aufenthalte notwendig sind, können Spezialabteilungen („Kompetenzzentren“) wie Entwöhnungskliniken, Fachkliniken für Persönlichkeitsstörungen, Abteilungen für psychisch kranke Rechtsbrecher (forensische Psychiatrie) oder Rehabilitationsabteilungen für PatientInnen eine Ergänzung darstellen. Universitätskliniken haben vielfach keinen Vollversorgungsauftrag für eine bestimmte Region und können sich neben der Lehre und Forschung auch der Behandlung von speziellen psychiatrischen Krankheitsbildern widmen.
2.2Teilstationäre Einrichtungen
2.2.1Tageskliniken
Tageskliniken sind Übergangseinrichtungen und fungieren als Verbindungsglied zwischen dem stationären Aufenthalt und der ambulanten Betreuung. Die außerhalb der psychiatrischen Abteilung lebenden PatientInnen kommen nur tagsüber in die Institution. Für sie gibt es jeweils eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten. Diese bestehen aus Ergotherapie, Gruppentherapie, Kochkurs, Teilnahme an Freizeitangeboten oder anderen soziotherapeutischen Maßnahmen und haben das Erlernen eines strukturierten Tagesablaufs zum Ziel. Tageskliniken eignen sich einerseits als Alternative zu einem langen, teuren stationären Klinikaufenthalt, anderseits zur Nachbehandlung für jene Periode, in der PatientInnen noch psychisch instabil und rückfallsgefährdet sind. Das „Setting“ in einer Tagesklinik ermöglicht eine Tagesbeschäftigung und die Stimulation von PatientInnen mit Schizophrenie, schwerer Persönlichkeitsstörung, Demenz oder Intelligenzminderung, die in ihren Wohnungen ohne Struktur unterfordert wären und infolge regelrecht verwahrlosen würden.
Eine Tagesstätte ähnelt im Prinzip einer Tagesklinik, bietet jedoch ein kleineres therapeutisches Spektrum.
2.2.2Nachtkliniken und Wohnheime
Nachtkliniken sind für PatientInnen angebracht, die tagsüber einer Beschäftigung nachgehen, aber die Nacht noch im geschützten Umfeld verbringen sollen. Aufgrund der gegenwärtigen schlechten Beschäftigungslage chronisch psychisch Kranker hat diese Betreuungsform an Bedeutung verloren.
Wohnheime sind Unterbringungsmöglichkeiten für PatientInnen ohne familiäres Umfeld und meist ohne Beschäftigung. Dazu müssen die PatientInnen über ein Mindestmaß an sozialen Fertigkeiten verfügen, wie selbständige Hygiene oder die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Langzeitwohnheime werden von Pflegepersonen oder SozialarbeiterInnen betreut. Sie tragen dazu bei, dass ein stimulierendes und reibungsloses Zusammenleben möglich ist. Manchmal sind diese Wohngemeinschaften auch in normalen Wohnungen untergebracht und stehen, je nach Anforderung, auch nicht unter ständiger Betreuung. Nach den großen Psychiatriereformen der 1970er-Jahre wurden vorwiegend Menschen mit Intelligenzminderung oder chronischer Schizophrenie von der Anstalt in betreute Wohnheime und -gruppen umgesiedelt.
2.2.3Geschützte Werkstätten
„Geschützte Werkstätten“ zählt man im weitesten Sinne ebenfalls zu den teilstationären psychiatrischen Einrichtungen. Sie bieten Arbeitsplätze für psychisch kranke oder behinderte Menschen und ermöglichen in einem geschützten Rahmen mit Rücksicht auf die jeweiligen Einschränkungen tätig zu sein. Die Arbeit soll die Menschen auf einen möglichen Berufswiedereinstieg vorbereiten (Rehabilitationswerkstätte) oder eine dauerhafte Alternative zur Arbeit am freien Markt darstellen. Hergestellt werden brauchbare Produkte, etwa in Tischlereibetrieben, die auch zum Verkauf angeboten werden. Viele geschützte Werkstätten erhalten Aufträge aus der freien Wirtschaft und arbeiten finanziell gewinnbringend.
2.3Ambulante Einrichtungen
2.3.1Sozialpsychiatrische Dienste
Der „Psychosoziale Dienst“ (PSD) kann als kooperierende Stelle des Spitals betrachtet werden und bietet Hilfe im Wohnumfeld an. Beschäftigt sind PsychiaterInnen, ErgotherapeutInnen, Pflegepersonen und SozialarbeiterInnen. Der Aufgabenbereich umfasst neben der Zusammenarbeit mit der zuständigen psychiatrischen Abteilung und weiteren psychiatrischen Versorgungseinrichtungen ambulante Betreuung und Beratung, Vorsorge und weiterführende Hilfestellung. Die Arbeit der SozialarbeiterInnen beansprucht unter den Berufsgruppen in der psychosozialen Dienststelle den größten Zeitaufwand. Die größte PatientInnengruppe sind Menschen, die durch chronische psychische Erkrankungen wie etwa Schizophrenie sozial abgestiegen sind. Dementsprechend sollen sozialpsychiatrische Dienststellen einfach, ohne Gesundheitskarte oder auch ohne Voranmeldung von den Betroffenen aufgesucht werden können.
2.3.2Spitals- und Institutsambulanzen
Hier werden PatientInnen nach einem Spitalsaufenthalt vorübergehend ambulant behandelt. Diese vorwiegend für rückfallsgefährdete PatientInnen geschaffenen Ambulanzen haben eine Brückenfunktion zwischen der Spitalsbetreuung („intramural“) und der Therapie im niedergelassenen Bereich („extramural“).
2.3.3Niedergelassene FachärztInnen für Psychiatrie
FachärztInnen für Psychiatrie behandeln PatientInnen aus allen psychiatrischen Diagnosegruppen und stellen das wichtigste Behandlungsangebot im ambulanten Bereich dar. Die Kosten der Behandlung werden von den Krankenkassen getragen.
2.3.4Frei praktizierende PsychotherapeutInnen und FachärztInnen für Psychiatrie
Ein klassisches psychotherapeutisches Setting in einer Privatpraxis eignet sich für PatientInnen, die sozial abgesichert leben, sich an Vereinbarungen und Termine halten und fähig sind, in reflektierender Weise über ihre psychischen Probleme zu sprechen. Dabei kommt es weniger auf die psychiatrische Diagnose, sondern vielmehr auf die Motivation zur psychotherapeutischen Arbeit an.
3Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie und rechtliche Rahmenbedingungen
3.1Vorbemerkung
Die Aufgabe der Psychiatrie ist es, psychisch erkrankte Menschen zu behandeln. Es besteht aber auch die gesetzliche Verpflichtung, die Behandlung manchmal gegen deren Willen durchzuführen, wenn aufgrund einer psychischen Störung eine massive Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Damit unterscheidet sich die Psychiatrie grundlegend von anderen medizinischen Fächern, deren PatientInnen in der Regel freiwillig zur Behandlung kommen und sie als Dienstleistung betrachten. Die Psychiatriereform hat dazu geführt, dass die meisten PatientInnen aus eigenem Betreiben in psychiatrischer Behandlung sind. Ein kleiner Teil jedoch wird noch immer zwangsweise zur stationären Behandlung eingewiesen. Es ist leider eine Tatsache, dass Menschen in psychischen Ausnahmezuständen auch mit polizeilicher Gewalt von zu Hause ins Spital gebracht werden und dort von Pflegepersonen mit Gurten fixiert werden und zur Beruhigung eine Injektion mit einem sedierenden Psychopharmakon erhalten. Solche Szenen sind nicht zu vermeiden, wenn sich die Psychiatrie ihrer gesellschaftlichen Aufgabe stellt. Gälten ausschließlich Selbstbestimmung und Freiheit des Menschen als Handlungsgrundlagen, entspräche dies einer sorglosen bzw. zynischen Haltung, gleich einem Elternteil, der tatenlos zusähe, wie sein Kind alleine über die Straße läuft, nur weil es dies augenblicklich wünscht. Die Psychiatrie stellt somit eine staatliche Instanz dar, welche die ethisch schwierige Aufgabe hat, zu entscheiden, ob eine psychische Auffälligkeit einer zwangsweisen Behandlung bedarf oder nicht. Zwangseinweisungen und -maßnahmen können aber traumatisierend für Betroffene sein und Alternativen wären wünschenswert. Es gibt Versuche, schizophrene PatientInnen ohne Medikamente und ohne Zwangsmaßnahmen zu behandeln. Diese auch als „Soteria“ bezeichnete Idee wurde in der Schweiz entwickelt und beruht auf der Annahme, das zwischenmenschliche Beziehungen in einer ruhigen Umgebung ebenso wirksam sein können wie eine medikamentöse Sedierung. In Spezialabteilungen werden PatientInnen in psychischen Krisen „rund um die Uhr“ auch von Laien begleitet und betreut. Um solche Projekte im Gesundheitssystem großflächig zu etablieren, werden jedoch positive Studien und Forschungsarbeiten sowie finanzielle Mittel für die personalintensive Betreuung benötigt.
3.2Zwangsmaßnahmen und Unterbringung
Anfang der 1990er-Jahre wurden in den europäischen Ländern neue gesetzliche Bestimmungen beschlossen, welche die Aufnahmen und Behandlungen in psychiatrischen Krankenhäusern regeln sollen. Für eine Zwangseinweisung ähneln sich die Voraussetzungen in den meisten Ländern. Neben dem Vorliegen einer psychischen Störung müssen üblicherweise eine akute Selbstgefährdung (Gefahr des Selbstmords) und/oder eine Gefahr für andere Personen (aggressive Impulsdurchbrüche) gegeben sein.
In Österreich sind Aufnahmen und Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Abteilungen seit 1991 durch das Unterbringungsgesetz (UbG, Novellierung 2010) geregelt. Voraussetzungen sind:
1.Die betreffende Person leidet an einer psychischen Krankheit.
2.Im Zusammenhang mit der psychischen Krankheit liegt eine erhebliche und ernste Gefährdung des eigenen Lebens/der eigenen Gesundheit oder des Lebens/Gesundheit anderer vor.
3.Die Person kann nicht anders (vor allem außerhalb des Krankenhauses) ausreichend ärztlich behandelt werden.
Eine Einweisung gegen den Willen eines Patienten erfolgt durch einen Arzt des öffentlichen Dienstes (Amtsarzt), der bei Vorliegen der Voraussetzung eine ärztliche Bescheinigung ausstellen kann. Bei Gefahr in Verzug können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Polizei) einen Betroffenen auch ohne ärztliche Bescheinigung einer psychiatrischen Untersuchung zuführen. Ein Psychiater der Abteilung (Abteilungsvorstand oder dessen Vertreter bzw. ein Facharzt) muss unverzüglich die Voraussetzung der Unterbringung überprüfen und ein ärztliches Unterbringungszeugnis ausstellen, wenn es bis dahin nicht gelungen ist, den Betroffenen zu einer freiwilligen Aufnahme zu bewegen. Aus dem Zeugnis muss hervorgehen, dass aufgrund einer psychischen Störung akute Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Parallel dazu ist das zuständige Gericht und ein Patientenanwalt zu verständigen. In einer innerhalb von vier Tagen anberaumten Erstanhörung wird die Zulässigkeit der Unterbringung überprüft. Nach weiteren 14 Tagen findet eine mündliche Verhandlung in der psychiatrischen Abteilung statt, bei der neben dem Patienten und seinem Arzt ein Richter, ein psychiatrischer Sachverständiger und ein Patientenanwalt teilnehmen. Der Richter bestimmt, ob eine weitere Anhaltung zulässig ist und kann eine Unterbringungsdauer von bis zu drei Monaten ab Einweisung festlegen. Der behandelnde Arzt kann sie innerhalb dieses Zeitraums jedoch jederzeit aufheben. Eine Unterbringung (Anhaltung eines Patienten gegen seinen Willen) wird für zulässig erklärt, nicht nur wenn Beschränkungsmaßnahmen angewandt werden müssen, sondern auch wenn davon auszugehen ist, dass ein baldiger Rückfall drohe, wenn der Betroffene die Behandlung abbrechen möchte. Zu Beschränkungsmaßnahmen zählt man u. a. die Hinderung des Patienten, die Station zu verlassen, etwa indem man sie versperrt, Steckgitter am Bettrand befestigt oder – als ultima ratio – den Betroffenen mit Gurten beschränkt. Auch elektronische Warnsysteme oder sedierende Medikamente, die gegen den Willen verabreicht werden, sind Maßnahmen, die nur dann durchgeführt werden, wenn eine Unterbringung vorliegt. Die psychiatrischen Abteilungen sollten aber „offen“ geführt werden. Damit ist gemeint, dass der Stationsbereich nicht abgesperrt werden soll und von PatientInnen jederzeit verlassen werden kann. In einem geschlossenen Bereich dürfen Personen nur nach dem Unterbringungsgesetz aufgenommen werden. Da ein Großteil der PatientInnen aber freiwillig in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen wird, sind geschlossene Bereiche in der Vollversorgung eine Rarität geworden.
In Deutschland kann bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung eines Patienten eine Unterbringung (Freiheitsentziehung) ausgesprochen werden, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt und aufgrund dieser die Gefahr für den Betroffenen nicht anders abgewendet werden kann. Dies erfolgt nach den Landesunterbringungsgesetzen, wobei zwischen den einzelnen Gesetzen der verschiedenen Bundesländer bzw. nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen (PSYCH-KG) Unterschiede bestehen. In der Regel wird das Verfahren von der Polizei oder von einem Amt für öffentliche Ordnung eingeleitet. Liegt ein Notfall vor, kann jeder Arzt einen Patienten in eine Klinik für Psychiatrie einweisen. Im Krankenhaus nimmt der Psychiater zur Unterbringung Stellung und der Richter entscheidet, ob die Unterbringung gerechtfertigt ist. Eine „fürsorgliche Zurückhaltung“ in einer psychiatrischen Klinik ist möglich, wenn sich der Betroffene in einer Klinik befindet und Gründe für eine Unterbringung vorliegen. Zwangs- und Sicherungsmaßnahmen sind zu dokumentieren und nur so lange statthaft, wie die Situation es erzwingt. Eine Entlassung aus der Unterbringung erfolgt durch gerichtliche Anwendung, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.
In der Schweiz spricht man von „Fürsorglicher Freiheitsentziehung“ (Art. 397 ZBG), die bei bestimmten medizinischen oder psychosozialen Voraussetzungen angewandt werden kann, um Betroffene in eine geeignete Anstalt zu bringen oder zurückzubehalten. Das Recht zur unmittelbaren Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Abteilung ist in den einzelnen Kantonen jedoch unterschiedlich geregelt. Vorläufige Einweisungen können von KantonsärztInnen, von den praktizierenden ÄrztInnen oder von den Gesundheitsämtern ausgehen. Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, ist die Hinzuziehung eines psychiatrischen Sachverständigen notwendig und der Patient muss wieder entlassen werden, sobald es das Zustandsbild erlaubt. Ein ärztliches Zeugnis muss neben der psychopathologischen Symptomatik auch Angaben über deren vermutliche Ursache und über die zu erwartenden Folgen für die betroffene Person oder Dritte enthalten.
IIITherapieverfahren
K. Paulitsch
1Psychopharmakotherapie
1.1Einleitung
Psychopharmaka sind Substanzen, die auf cerebrale Strukturen einwirken (psychotrope Substanzen). Sie regulieren Hirnfunktionen und modifizieren psychische Abläufe. Die Wirkung entfaltet sich an den Synapsen (Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen) durch Beeinflussung der Botenstoffe (Neurotransmitter). Diese Überträgersubstanzen regulieren die neuronale Erregung und elektrische Weiterleitung zwischen den einzelnen Nervenzellen. Die wichtigsten durch Psychopharmaka beeinflussbaren Neurotransmitter sind Noradrenalin, Serotonin, Dopamin, Acetylcholin und GABA (Gammaaminobuttersäure). Sie werden in kleinen Bläschen (Vesikeln) in den Nervenenden gespeichert und besetzen, nachdem sie durch einen elektrischen Impuls freigesetzt wurden, den nachgeschalteten Rezeptor einer benachbarten Nervenzelle. Im synaptischen Spalt erfolgt entweder der Abbau der Überträgersubstanzen oder sie werden wieder in die Bläschen der Nervenenden aufgenommen und inaktiviert.
Wirksame Psychopharmaka wurden erst in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckt. Den Durchbruch schaffte das 1952 entwickelte Chlorpromazin durch Jean Delay und Pierre Deniker, die zufällig die antipsychotische Wirkung der Substanz entdeckten. Bis dahin konnten Symptome psychisch kranker Menschen nur unspezifisch mit Opium, Alkohol oder Barbituraten gelindert werden. Bald nach Entwicklung des ersten Neuroleptikums (Antipsychotikums) Chlorpromazin wurde 1954 Meprobamat als erster Tranquilizer und 1957 von Roland Kühn das erste Antidepressivum (Imipramin) entwickelt. Die antimanische Wirkung von Lithium wurde bereits 1949 von John Cade entdeckt und 1967 seine phasenprophylaktische Wirkung.
Seither gehören Psychopharmaka zu den am häufigsten verordneten Medikamenten, obwohl in der Bevölkerung falsche Vorstellungen über deren Wirkungsweise bestehen. „Chemische Zwangsjacke“, „Pillenkeule“, „mit Medikamenten vollgestopft“ sind nur einige negative Attribute für die Pharmakotherapie. Die Vorurteile Medikamenten gegenüber führen allzu oft zur Stigmatisierung jener Personen, die diese zur Behandlung dringend benötigen. Nach Meinung aber fast aller psychiatrischer und psychiatriehistorischer Forscher hat die Entwicklung der Psychopharmaka in den 50er-Jahren wesentlich zu den Reformen in der Psychiatrie und zur „Öffnung“ der Anstalten beigetragen. Viele psychische Erkrankungen wie Psychosen, Depressionen, Angsterkrankungen, Schlafstörungen oder Erregungszustände können durch Medikamente effizient behandelt werden. Im klinischen Alltag sind daher Psychopharmaka unentbehrlich. Die Behandlungsstrategien sind in den letzten Jahren differenzierter geworden, aber man ist noch weit davon entfernt, über ein passendes Medikament für jede psychische Störung zu verfügen und die biochemischen Zusammenhänge im Einzelnen zu verstehen. Die Verordnung erfordert viel Erfahrung, setzt einen Gesamtbehandlungsplan voraus und soll nur bei bestehender Indikation erfolgen. Grundlage ist eine gute Arzt-Patient-Beziehung, in der psychosoziale Hintergründe und die Persönlichkeit des Patienten berücksichtigt werden. Der Arzt ist zwar der Experte, der Betroffene bringt aber das nicht minder wichtige individuelle Erfahrungswissen ein.
Spricht man von Psychopharmaka, sollte man generell zwischen zwei Gruppen differenzieren, die unterschiedlich zu bewerten sind: Die erste Gruppe umfasst jene Medikamente, die von PatientInnen nur vorübergehend eingenommen werden sollen, da sie ein Abhängigkeitspotenzial aufweisen und Langzeitschäden zu befürchten sind. Hierzu zählt man vorwiegend die Tranquilizer (v. a. Benzodiazepine). Zur zweiten Gruppe zählt man jene Medikamente, bei denen keine Suchtgefahr besteht und die wegen guter Verträglichkeit langfristig zur psychischen Stabilisierung verabreicht werden können. Dies sind vor allem Antidepressiva und Phasenprophylaktika, aber auch Antipsychotika und Antidementativa.
1.2Antidepressiva
Als Antidepressiva werden nicht suchterzeugende und gut verträgliche Medikamente bezeichnet, die vorwiegend zur Behandlung von Depressionen entwickelt wurden und sich durch eine stimmungsaufhellende und antriebsnormalisierende Wirkung (manchmal auch psychomotorisch dämpfend) auszeichnen. Antidepressiva werden zunehmend auch bei anderen Symptomen wie Ängsten, Zwängen oder Schmerzen eingesetzt und gelten als eine der am häufigsten verordneten Medikamente überhaupt.